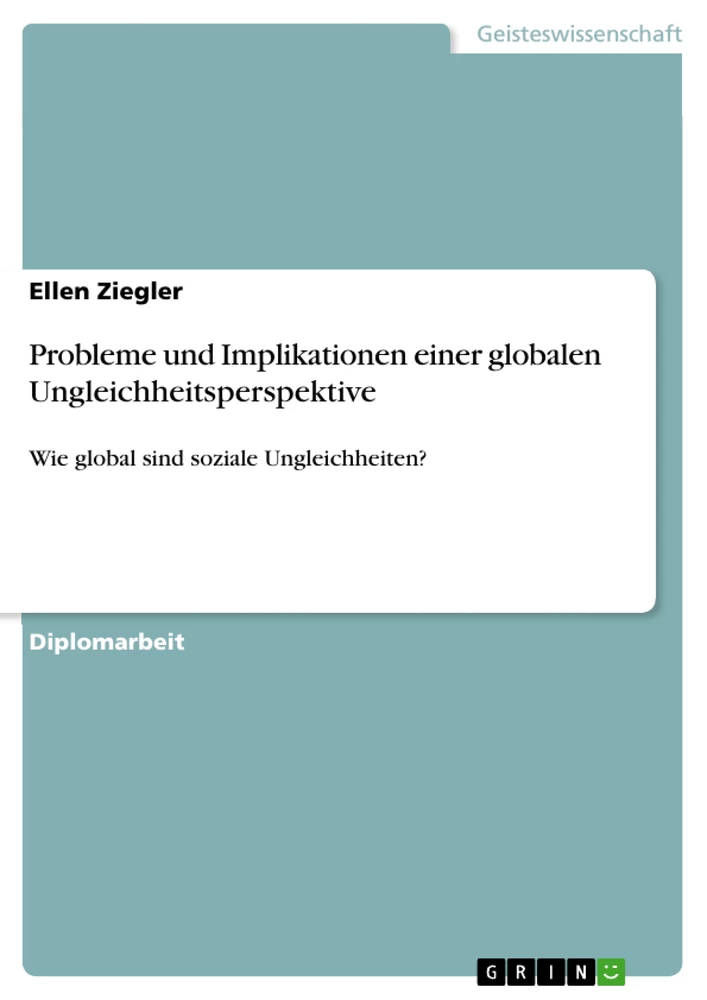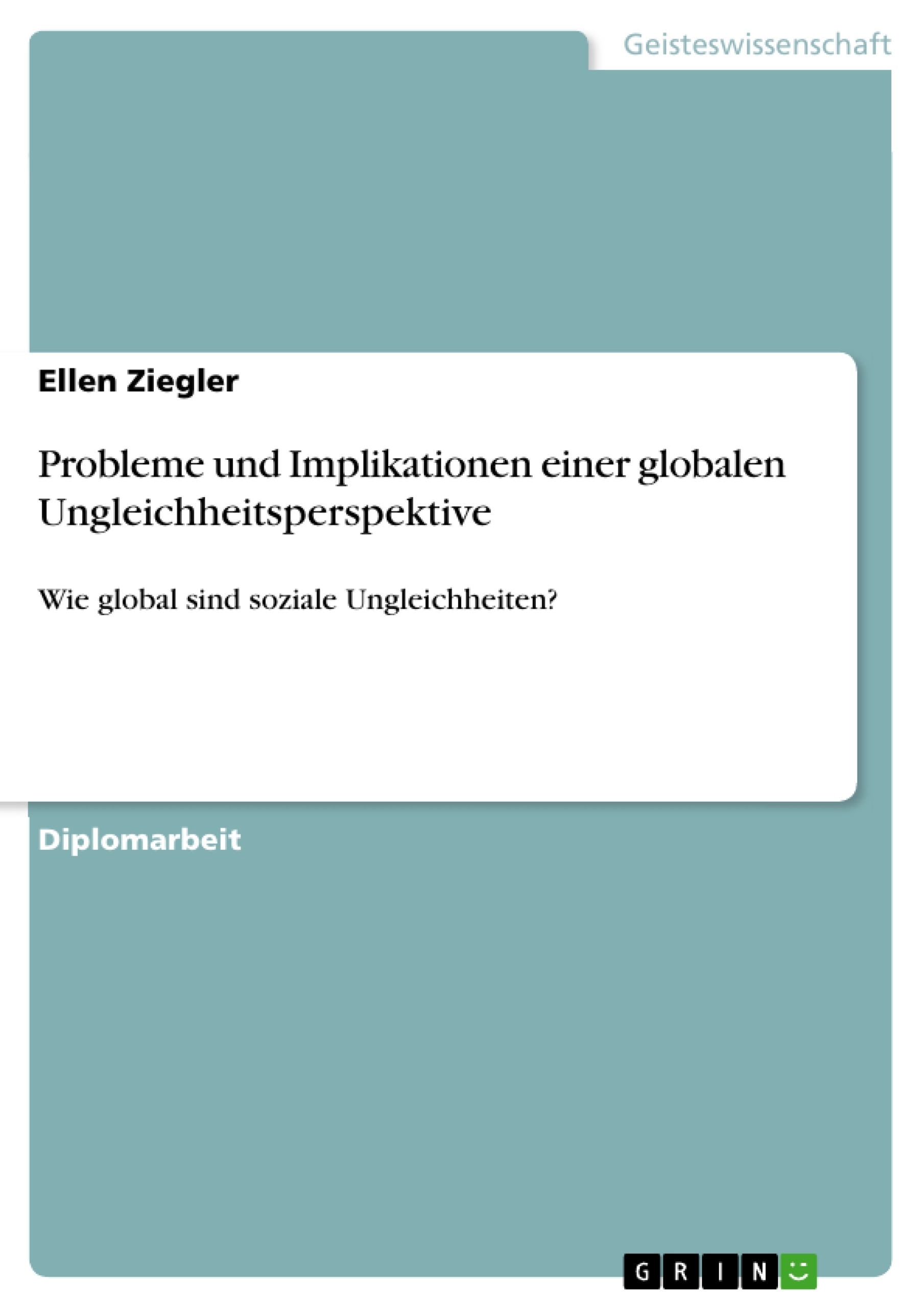In einer Welt, in der die nationalen Grenzen der Wirklichkeitswahrnehmung zunehmend zerbrechen, in der ein nie dagewesener Überfluss vorhanden ist; in einer Welt in der Mangel und Armut zur Tagesordnung gehören, muss die Soziologie, laut Reinhard Kreckel, einen neuen Rahmen für die Erfassung von sozialen Ungleichheiten entwickeln. Dabei muss eine Abkehr von der nationalen hin zur globalen Sichtweise stattfinden (vgl. Kreckel S. 3ff.). Durch die Globalisierung, so Ulrich Beck, wird der nationalstaatliche Rahmen zur Erfassung von sozialen Ungleichheiten aufgebrochen und es entsteht ein Perspektivenwechsel hin zu globalen Ungleichheiten (vgl. Beck 1997 S. 28ff.). Ausgehend von den Überlegungen von Kreckel und Beck, soll das Ziel dieser Diplomarbeit sein, die Implikationen und Probleme der globalen Ungleichheitsforschung offenzulegen. Bedenkt man, dass die Einkommensunterschiede zwischen den Nationen größer sind, als innerhalb einer einzigen Nation, und dass die Ungleichheiten innerhalb eines Landes nur von einem Viertel bis zu einem Drittel durch interne Faktoren erklärbar sind, d. h. das 65 – 75 Prozent durch den globalen Gesamtkontext bestimmt werden, scheint ein Blick über die nationalen Grenzen hinaus unerlässlich (vgl. Firebaugh 2003 S. 365f.; Kreckel 2006 S. 4). Die globale Sichtweise ist weitaus mehr als die Summe aller Nationalstaaten und deren Beziehungen. Sie ist vielmehr als „die“ Gesamtheit zu verstehen und bildet daher einen eigenen Untersuchungsgegenstand (vgl. Greve / Heintz 2005 S. 89). Globale Ungleichheitsstrukturen, so scheint es, gewinnen durch die fortschreitende Globalisierung immer mehr an Bedeutung. Die Soziologie, die Ökonomie aber auch die Internationale Politik sind sich in den letzten Jahrzehnten der Brisanz der globalen Ungleichheiten und der Armut bewusst geworden, so erfolgt die Erhebung und Generierung von globalen Daten durch die Vereinten Nationen und die Weltbank. Das Gebiet der sozialen Ungleichheiten wurde im Rahmen des Nationalstaates theoretisch und methodisch sehr gut ausgebaut. Durch die Erfassung von globalen, sozialen Ungleichheiten, wird ein neuer Wirklichkeitsbereich erzeugt, welcher nicht mehr nur durch den nationalstaatlichen Rahmen gedeckt werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Gedanken und Übersicht
- Die theoretischen Probleme einer globalen Ungleichheitsperspektive
- Die Phänomene „Globalisierung“ und „Soziale Ungleichheit“ – Eine Begriffs bestimmung
- Was ist Globalisierung?
- Die Kontroverse um den Beginn der Globalisierung
- Was sind globale Ungleichheiten? Der Versuch einer Begriffs bestimmung
- Der Capability-Ansatz als Grundlage für globale Ungleichheiten?
- Der Capability-Ansatz von Amartya Sen und Martha Nussbaum
- Der Human Development Index als Weiterentwicklung des Capability-Ansatz
- Die „Weltgesellschaft“ als Analysebasis von globalen Ungleichheiten?
- Eine kurze Einführung zur Weltgesellschaft
- Von der Modernisierungstheorie zum kapitalistischen Weltsystem
- Das Weltsystem nach Immanuel Wallerstein
- Drei Welten in einem System – Über die Ungleichheiten im kapitalistischen Weltsystem
- Wie entstand das Gefälle zwischen Zentrum und Peripherie?
- Kritikpunkte am Weltsystem nach Immanuel Wallerstein
- Die Bielfelder Weltgesellschaft als globales Interaktionsfeld - Eine kurze Einführung
- Innovationen und Mechanismen in der Weltgesellschaft
- Die Bedeutung der sozialen Ungleichheitsstrukturen in der Weltgesellschaft - Eine kritische Auseinandersetzung
- Zentrum und Peripherie in der Weltgesellschaft
- Soziale Ungleichheiten, Globalisierung und die Rolle der Nationalstaaten
- Die Entwicklung sozialer Ungleichheitsstrukturen im Nationalstaat
- Die Entwicklung sozialer Ungleichheiten im Globalisierungsprozess innerhalb der Nationalstaaten
- Die Phänomene „Globalisierung“ und „Soziale Ungleichheit“ – Eine Begriffs bestimmung
- Die methodisch-empirischen Probleme der globalen Ungleichheitsforschung
- Die Konzepte der globalen Ungleichheitsstrukturen
- Die Entwicklung der globalen Ungleichheitsstrukturen – Ein kurzer Überblick
- Die internationalen Einkommenungleichheiten zwischen 1820-1950 – Der große Anstieg
- Der Wandel der Einkommenungleichheiten im späten 20. Jahrhundert – Die große Kehrtwende?
- Globale Einkommenungleichheiten im späten 20. Jahrhundert - Divergenz
- Globale Einkommenungleichheiten im späten 20. Jahrhundert - Konvergenz
- Die globalen Einkommenungleichheiten aller Weltbürger
- Der Human Development Index als mehrdimensionales Maß
- Der Sonderfall Asien
- Die Entwicklung der globalen Armut
- Die methodischen Probleme der globalen Ungleichheitsforschung - Ein kurzer Abriss
- Ausblick, Diskussion und finale Schlussfolgerungen
- „Proletarier aller Länder vereinigt euch!“ - Zur Entstehung einer globalen „Sozialen Frage“?
- „Should we worry about income inequality?“
- Zusammenfassende Gedanken und Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Probleme und Implikationen einer globalen Ungleichheitsperspektive. Sie befasst sich mit der theoretischen und methodisch-empirischen Herausforderung, soziale Ungleichheiten in einem globalen Kontext zu untersuchen und zu verstehen.
- Die Analyse der Konzepte „Globalisierung“ und „Soziale Ungleichheit“
- Die kritische Auseinandersetzung mit verschiedenen theoretischen Ansätzen, die sich mit globalen Ungleichheiten befassen, wie dem Capability-Ansatz und dem Weltsystem nach Immanuel Wallerstein
- Die Untersuchung der methodischen Herausforderungen bei der Erforschung globaler Ungleichheiten, insbesondere im Hinblick auf die Messung und vergleichende Analyse von Einkommen, Armut und Human Development
- Die Diskussion über die Bedeutung von globalen Ungleichheiten für die Gestaltung einer gerechten und nachhaltigen Welt
- Die Analyse der Rolle von Nationalstaaten und globalen Institutionen im Kontext von globalen Ungleichheiten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung in die Thematik der globalen Ungleichheit und skizziert die zentralen Fragestellungen und Ziele der Arbeit. Das zweite Kapitel befasst sich mit den theoretischen Problemen einer globalen Ungleichheitsperspektive. Es werden die Konzepte „Globalisierung“ und „Soziale Ungleichheit“ definiert und verschiedene Ansätze zur Analyse globaler Ungleichheiten vorgestellt, darunter der Capability-Ansatz und das Konzept der Weltgesellschaft. Das dritte Kapitel widmet sich den methodisch-empirischen Problemen der globalen Ungleichheitsforschung. Es werden verschiedene Indikatoren zur Messung globaler Ungleichheiten diskutiert, wie der Human Development Index und die Armutsrate, sowie die Herausforderungen bei der vergleichenden Analyse von Daten aus verschiedenen Ländern und Regionen. Das vierte Kapitel bietet einen Ausblick auf die zentralen Erkenntnisse der Arbeit und diskutiert die Implikationen der Ergebnisse für die Gestaltung einer gerechteren Welt.
Schlüsselwörter
Globale Ungleichheit, Globalisierung, Soziale Ungleichheit, Capability-Ansatz, Weltsystem, Human Development Index, Armut, Einkommensungleichheit, Methodische Herausforderungen, Nationale und Internationale Politik
Häufig gestellte Fragen
Warum ist eine globale Sichtweise auf soziale Ungleichheit notwendig?
Laut Reinhard Kreckel und Ulrich Beck zerbrechen nationale Grenzen der Wahrnehmung. Da 65–75% der Ungleichheit durch den globalen Kontext bestimmt werden, reicht der nationalstaatliche Rahmen nicht mehr aus.
Was besagt der Capability-Ansatz von Amartya Sen?
Dieser Ansatz betrachtet Ungleichheit nicht nur über das Einkommen, sondern über die tatsächlichen Verwirklichungschancen (Fähigkeiten) der Menschen, ihr Leben zu gestalten.
Welche Rolle spielt das „Weltsystem“ nach Immanuel Wallerstein?
Wallerstein analysiert die Welt als ein kapitalistisches System, das in Zentrum, Semiperipherie und Peripherie unterteilt ist, wodurch strukturelle Abhängigkeiten und Gefälle entstehen.
Was ist der Human Development Index (HDI)?
Der HDI ist ein mehrdimensionales Maß, das neben dem Einkommen auch Faktoren wie Bildung und Lebenserwartung einbezieht, um die Entwicklung von Ländern vergleichbar zu machen.
Welche methodischen Probleme gibt es in der globalen Ungleichheitsforschung?
Herausforderungen liegen in der Generierung vergleichbarer Daten weltweit sowie in der Frage, ob man Ungleichheit zwischen Nationen oder zwischen allen Weltbürgern misst.
Gibt es eine globale „soziale Frage“?
Die Arbeit diskutiert, ob durch die Globalisierung eine weltweite soziale Frage entsteht, ähnlich der Proletarisierung im 19. Jahrhundert, die neue politische Antworten erfordert.
- Citar trabajo
- Ellen Ziegler (Autor), 2009, Probleme und Implikationen einer globalen Ungleichheitsperspektive, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167540