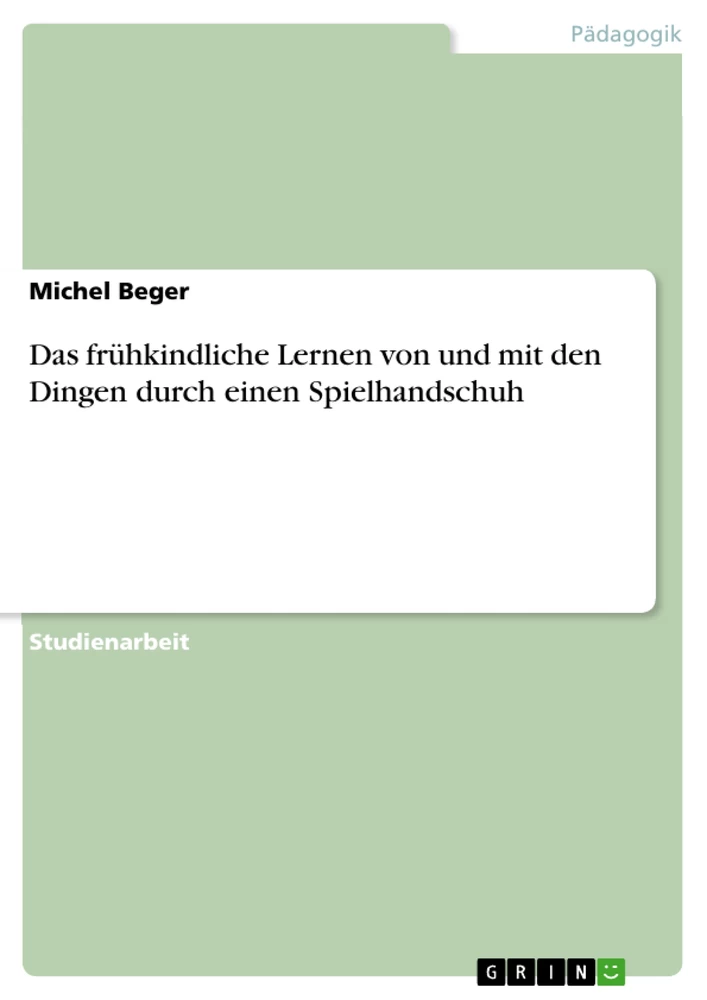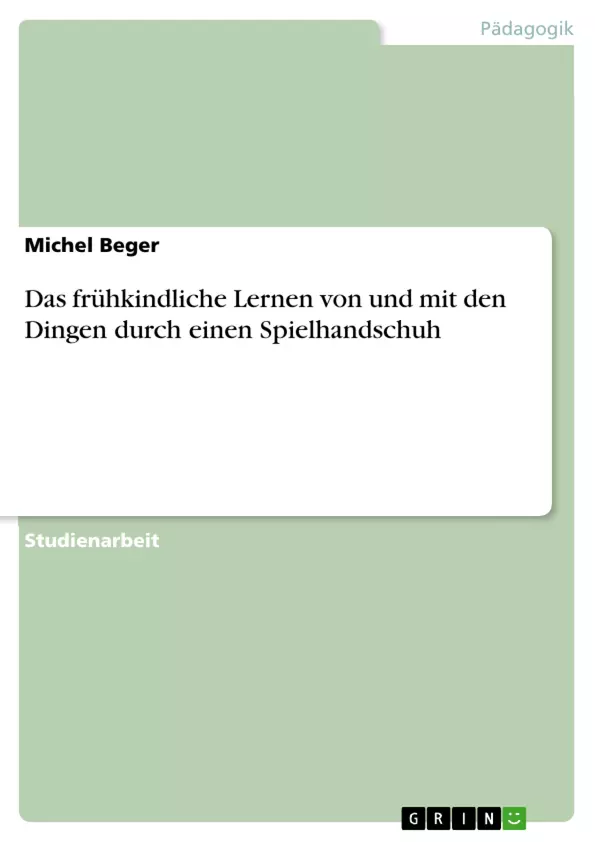Ich möchte in dieser Arbeit darlegen, wie beim Spielen Lernprozesse durchlaufen werden. Bezogen auf den Umgang eines Babys mit einem Spielhandschuh werde ich aufzeigen, wie es mit diesem umgeht und welche Schlüsse daraus gezogen werden können. Zudem werde ich dies sowohl aus pädagogischer als auch aus psychologischer Sichtweise betrachten. Dazu werde ich anfänglich den Dingbegriff näher beleuchten.
Im Anschluss werde ich dann den „Spielhandschuh“ in Hinblick auf seine Beschreibung und Entstehung erläutern. Danach stelle ich die hier zugrundeliegende Versuchsperson vor und ordne diese anhand der Entwicklungstheorie von Piaget ein. Anhand eigens durchgeführter Beobachtungen erläutere ich folgend den Umgang des Kindes mit dem Spielhandschuh, wobei ich zunächst auf die Wahrnehmung und daraus resultierende Handlungen eingehe und schließlich die Identifizierung des Spielhandschuhs thematisiere.
Im letzten Kapitel fasse ich die wichtigsten Ergebnisse zusammen und bringe weitere Themenfelder bzgl. des Spielhandschuhs an.
Inhaltsverzeichnis
- SPIELEN UND LERNEN
- DIE DINGE
- DAS DING,,SPIELHANDSCHUH“
- ENTWICKLUNGSTHEORETISCHE EINORDNUNG DER VERSUCHSPERSON
- DIE BEOBACHTUNGEN
- WAHRNEHMUNG UND HANDLUNG
- DIE IDENTIFIZIERUNG DER DINGE
- ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Lernprozesse, die beim Spielen von Babys stattfinden. Am Beispiel des Spielhandschuhs soll gezeigt werden, wie ein Baby mit diesem umgeht und welche Schlüsse daraus gezogen werden können. Die Analyse erfolgt aus pädagogischer und psychologischer Sicht.
- Die Bedeutung des Spielens für die kindliche Entwicklung
- Der Dingbegriff und seine verschiedenen Klassifikationen
- Der Spielhandschuh als Objekt der Wahrnehmung und Handlung
- Die Rolle des Tastsinns in der frühen kindlichen Entwicklung
- Die Bedeutung von Erfahrungen für den Lernprozess
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Bedeutung des Spielens für die kindliche Entwicklung und definiert den Begriff des Lernens im Kontext der frühen Kindheit. Das zweite Kapitel widmet sich dem Dingbegriff und seinen verschiedenen Klassifikationen nach Mollenhauer (1998), wobei die Dinge als Zeichen, Werkzeuge und Wahrnehmungsinhalte vorgestellt werden.
Das dritte Kapitel beschreibt den Spielhandschuh als Objekt der Untersuchung. Es werden die Materialien und die verschiedenen „Spielzeugdinge“ am Spielhandschuh erläutert. Das vierte Kapitel stellt die Versuchsperson vor und ordnet sie anhand der Entwicklungstheorie von Piaget ein. Das fünfte Kapitel präsentiert die Beobachtungen zum Umgang des Babys mit dem Spielhandschuh, wobei sowohl die Wahrnehmung und die daraus resultierenden Handlungen als auch die Identifizierung des Spielhandschuhs beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Frühkindliche Entwicklung, Spielen, Lernen, Dingbegriff, Spielhandschuh, Wahrnehmung, Handlung, Identifizierung, Entwicklungstheorie, Piaget, Beobachtung, Tastsinn, Erfahrung.
Häufig gestellte Fragen
Wie lernen Babys durch den Umgang mit Dingen?
Babys nutzen ihre Sinne, insbesondere den Tastsinn, um Objekte zu erkunden. Durch Greifen, Fühlen und Beobachten entstehen erste kognitive Schemata und Lernprozesse.
Was ist ein Spielhandschuh in der pädagogischen Beobachtung?
Ein Spielhandschuh ist ein pädagogisches Hilfsmittel mit verschiedenen Texturen und Anhängseln, das die Wahrnehmung und Handlungsfähigkeit des Säuglings stimuliert.
Welche Rolle spielt Piagets Entwicklungstheorie hierbei?
Piagets Theorie hilft dabei, die Handlungen des Kindes in Entwicklungsphasen (wie die sensomotorische Phase) einzuordnen und das Verständnis von Objektpermanenz und Identifizierung zu erklären.
Was versteht Mollenhauer unter Dingen als „Zeichen“?
Dinge sind für Kinder nicht nur materielle Objekte, sondern fungieren als Träger von Bedeutungen, Werkzeuge für Handlungen oder Inhalte der reinen Wahrnehmung.
Warum ist der Tastsinn in der frühen Kindheit so wichtig?
Der Tastsinn ist einer der ersten voll entwickelten Sinne und ermöglicht dem Baby die primäre Interaktion mit seiner Umwelt, was die Basis für alle weiteren Lernschritte bildet.
- Quote paper
- Michel Beger (Author), 2011, Das frühkindliche Lernen von und mit den Dingen durch einen Spielhandschuh, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167576