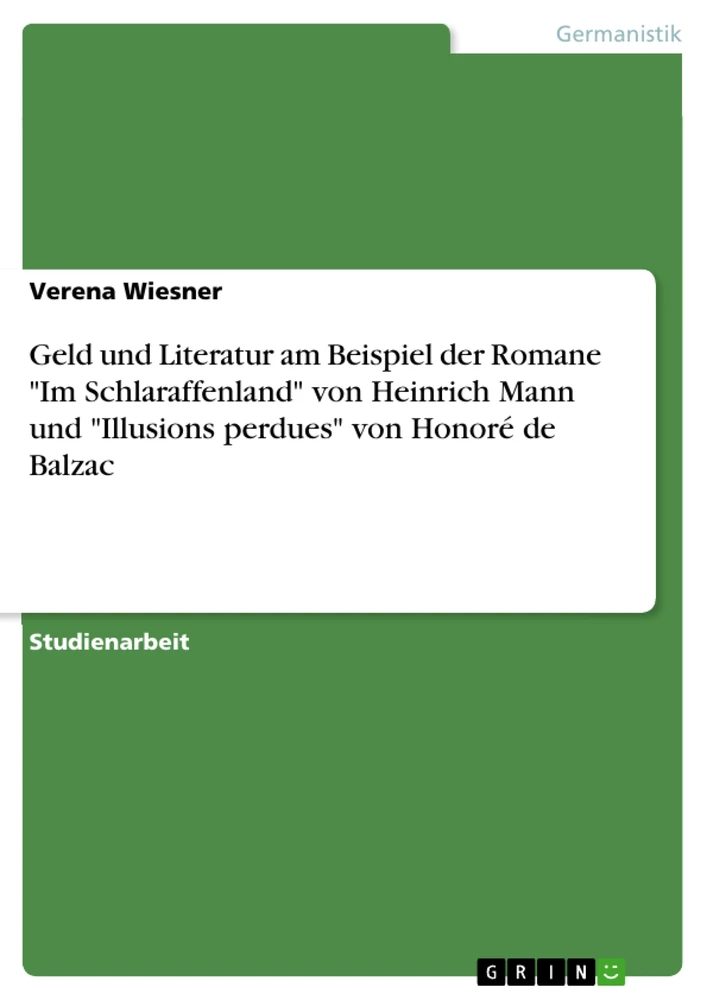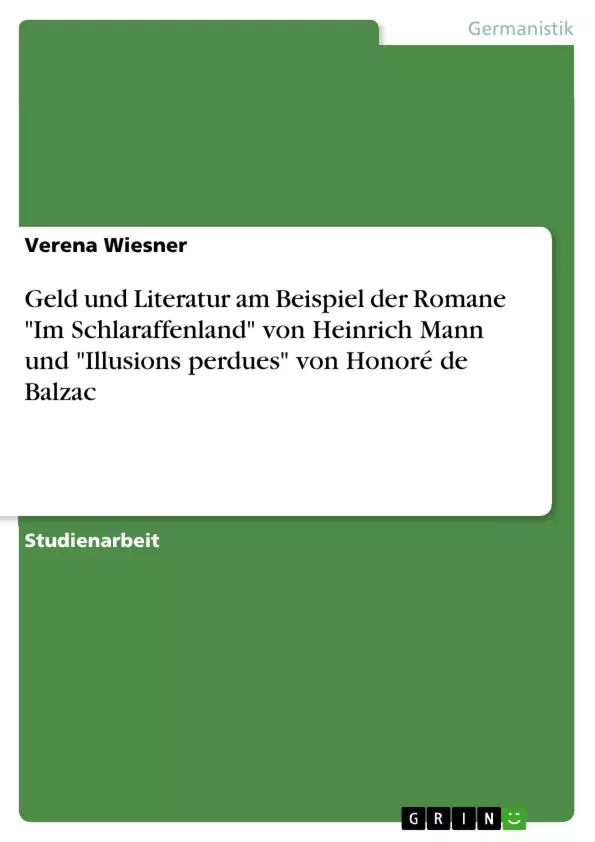Thema dieser Seminararbeit ist das Verhältnis von Geld und Literatur am Beispiel
der Romane Illusions perdues (1837-1843) von Honoré de Balzac und Im
Schlaraffenland (1900) von Heinrich Mann. Es wird dabei sowohl das Verhältnis der
Autoren zum Geld behandelt als auch die Darstellung des Geldes in der Literatur und
im speziellen die Darstellung des Verhältnisses von „Geld“ und „Literatur“. Ein
wesentliches Augenmerk wird also auf die Ausgestaltung des Kulturbetriebs in den
Romanen gelegt, in dem sich die Beziehung von „Geld“ und „Literatur“ besonders
aufschlussreich festmachen lässt.
Die Arbeit gliedert sich folgendermaßen:
Erstens, wird der Kulturbetrieb in den Romanen geschildert wird. Den Begriff
Kulturbetrieb verstehe ich hier als weit gefasst, der sowohl den Literaturbetrieb im
engeren Sinn als auch den Journalismus und das Theater einschließt. Eine oft
angewendete Theorie des Literaturbetriebs hat Pierre Bourdieu in die Die Regeln der
Kunst. Genese und Struktur des literarischen Feldes entworfen, in der man auch die
Struktur des kulturellen Feldes innerhalb der Romane wiederkennt. Bourdieu’s
bekannte Typologie der Autoren soll in der Seminararbeit auf die sich im
Literaturbetrieb zu positionieren versuchende Protagonisten der Romane
angewendet werden. Die Typologie von Autoren, die sich im literarischen Feld eine
Position suchen, ist bei Bourdieu zweiseitig: Auf der einen Seite gibt es den
heteronomen Pol, wo sich Autoren finden, die für schnellen Geldgewinn arbeiten und
sich an den Markt bzw. an die Nachfrage anpassen. Sie streichen zwar kurzfristige
Gewinne ein, können sich aber langfristig selten eine anerkannte Position innerhalb
des Literaturbetriebs schaffen. Auf der anderen Seite gibt es den autonomen Pol, an
dem, die sich befindenden Autoren an Werten wie der Autonomie der Kunst
orientieren. Am autonomen Pol kann man sich langfristig positionieren, aber man
muss meist auf kurzfristige Gewinne verzichten.
Zweitens, wird das Verhältnis der Autoren zum Geld betrachtet und ob
autobiographische Züge in den Romanen feststellbar sind. Hier erfolgt eine Bestandsaufnahme der finanziellen Situation der Autoren zum Zeitpunkt des
Verfassens der jeweiligen Romane. Außerdem wird erörtert, ob autobiographische
Bezüge in den Romanen feststellbar sind.
Drittens, wird das Thema des Geldes in den Romanen behandelt und wie die
einzelnen Protagonisten im Bezug zum Geld und dem Umgang mit ihm stehen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Die Romane und der Kulturbetrieb
- I.1. Unterschiede & Parallelen
- I.2. Protagonisten, Geld und die Typologie der Autoren
- II. Autoren, Geld und autobiographische Aspekte der Romane
- III. Das Thema des Geldes
- III.1. Einzelne Protagonisten und ihr Bezug zum Geld
- IV. Zusammenfassung
- V. Anhang
- V.1. Grafik
- VI. Literatur
- VI.1. Primärliteratur
- VI.2. Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht das Verhältnis von Geld und Literatur anhand der Romane „Illusions perdues“ (Honoré de Balzac) und „Im Schlaraffenland“ (Heinrich Mann). Die Arbeit beleuchtet sowohl die Beziehung der Autoren zum Geld als auch die Darstellung des Geldes in den Romanen, insbesondere im Kontext des Kulturbetriebs (Literatur, Journalismus, Theater). Die Analyse stützt sich auf Bourdieus Theorie des Literaturbetriebs.
- Der Einfluss des Kulturbetriebs auf Literatur und Autoren
- Die Darstellung des Geldes als zentrales Thema in beiden Romanen
- Die Beziehung zwischen den Protagonisten und ihrer finanziellen Situation
- Autobiographische Elemente in den Romanen im Bezug auf die finanzielle Situation der Autoren
- Anwendung von Bourdieus Typologie der Autoren auf die Romanfiguren
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Seminararbeit ein: die Beziehung zwischen Geld und Literatur, untersucht an Hand von Balzac's „Illusions perdues“ und Manns „Im Schlaraffenland“. Sie skizziert den Forschungsansatz, der sowohl das Verhältnis der Autoren zum Geld als auch die Darstellung des Themas in den Romanen umfasst, mit besonderem Augenmerk auf den Kulturbetrieb. Die Arbeit kündigt die Gliederung an und erwähnt die Anwendung von Bourdieus Theorie des Literaturbetriebs auf die Protagonisten.
I. Die Romane und der Kulturbetrieb: Dieses Kapitel untersucht den Kulturbetrieb in beiden Romanen, umfassend Literatur, Journalismus und Theater. Es wird auf Bourdieus Theorie des literarischen Feldes Bezug genommen und dessen Typologie der Autoren (heteronomer und autonomer Pol) auf die Protagonisten angewendet. Der Fokus liegt auf der Interaktion von Literatur und ökonomischen Realitäten innerhalb des dargestellten Kulturbetriebs, wobei die Unterschiede und Parallelen zwischen den Romanen herausgearbeitet werden.
II. Autoren, Geld und autobiographische Aspekte der Romane: Dieses Kapitel analysiert die finanzielle Situation von Balzac und Mann zum Zeitpunkt des Schreibens ihrer Romane und untersucht mögliche autobiographische Elemente in Bezug auf die Darstellung von Geld und Erfolg. Es wird geprüft, inwiefern die persönlichen Erfahrungen der Autoren die literarische Gestaltung beeinflusst haben und ob sich Parallelen zwischen den Autoren und ihren Romanfiguren feststellen lassen.
III. Das Thema des Geldes: Dieses Kapitel befasst sich mit der Darstellung des Geldes als zentrales Thema in beiden Romanen. Es untersucht, wie die Protagonisten mit Geld umgehen und welche Rolle es in ihren Leben spielt. Die Analyse konzentriert sich auf die verschiedenen Aspekte des Verhältnisses der Figuren zum Geld, von finanzieller Not bis hin zum Streben nach Reichtum und dem Einfluss auf ihre Handlungen und Beziehungen.
Schlüsselwörter
Geld, Literatur, Kulturbetrieb, Bourdieu, Balzac, Mann, Illusions perdues, Im Schlaraffenland, Autoren-Typologie, Autobiographie, Realismus, Journalismus, finanzieller Erfolg.
Häufig gestellte Fragen zu "Geld und Literatur: Eine Analyse von Balzacs 'Illusions perdues' und Manns 'Im Schlaraffenland'"
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit untersucht das komplexe Verhältnis von Geld und Literatur anhand der Romane „Illusions perdues“ (Honoré de Balzac) und „Im Schlaraffenland“ (Heinrich Mann). Sie beleuchtet die Beziehung der Autoren zum Geld und die Darstellung des Geldes in den Romanen, insbesondere im Kontext des Kulturbetriebs (Literatur, Journalismus, Theater).
Welche theoretische Grundlage wird verwendet?
Die Analyse stützt sich auf Pierre Bourdieus Theorie des Literaturbetriebs, insbesondere seine Typologie der Autoren (heteronomer und autonomer Pol), um die Romanfiguren zu charakterisieren und ihre Position im literarischen Feld zu bestimmen.
Welche Aspekte des Kulturbetriebs werden untersucht?
Die Arbeit analysiert den Einfluss des Kulturbetriebs auf Literatur und Autoren, indem sie die Interaktion von Literatur und ökonomischen Realitäten innerhalb des dargestellten Kulturbetriebs (Literatur, Journalismus, Theater) in beiden Romanen untersucht.
Wie wird das Thema "Geld" in den Romanen behandelt?
Die Arbeit analysiert die Darstellung des Geldes als zentrales Thema in beiden Romanen. Sie untersucht, wie die Protagonisten mit Geld umgehen, welche Rolle es in ihren Leben spielt und wie es ihre Handlungen und Beziehungen beeinflusst, von finanzieller Not bis hin zum Streben nach Reichtum.
Welche Rolle spielen autobiographische Aspekte?
Die Arbeit untersucht mögliche autobiographische Elemente in den Romanen im Bezug auf die finanzielle Situation der Autoren Balzac und Mann. Es wird geprüft, inwiefern die persönlichen Erfahrungen der Autoren die literarische Gestaltung beeinflusst haben und ob sich Parallelen zwischen den Autoren und ihren Romanfiguren feststellen lassen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, vier Hauptkapitel (Die Romane und der Kulturbetrieb; Autoren, Geld und autobiographische Aspekte der Romane; Das Thema des Geldes; Zusammenfassung), einen Anhang mit einer Grafik und ein Literaturverzeichnis (Primär- und Sekundärliteratur).
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Geld, Literatur, Kulturbetrieb, Bourdieu, Balzac, Mann, Illusions perdues, Im Schlaraffenland, Autoren-Typologie, Autobiographie, Realismus, Journalismus, finanzieller Erfolg.
Wo finde ich eine detaillierte Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Die Arbeit enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, welche die jeweiligen Forschungsfragen und Ergebnisse kurz beschreibt. Diese Zusammenfassungen liefern einen Überblick über den Inhalt und die Argumentationslinie jedes Kapitels.
- Quote paper
- Verena Wiesner (Author), 2010, Geld und Literatur am Beispiel der Romane "Im Schlaraffenland" von Heinrich Mann und "Illusions perdues" von Honoré de Balzac, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167667