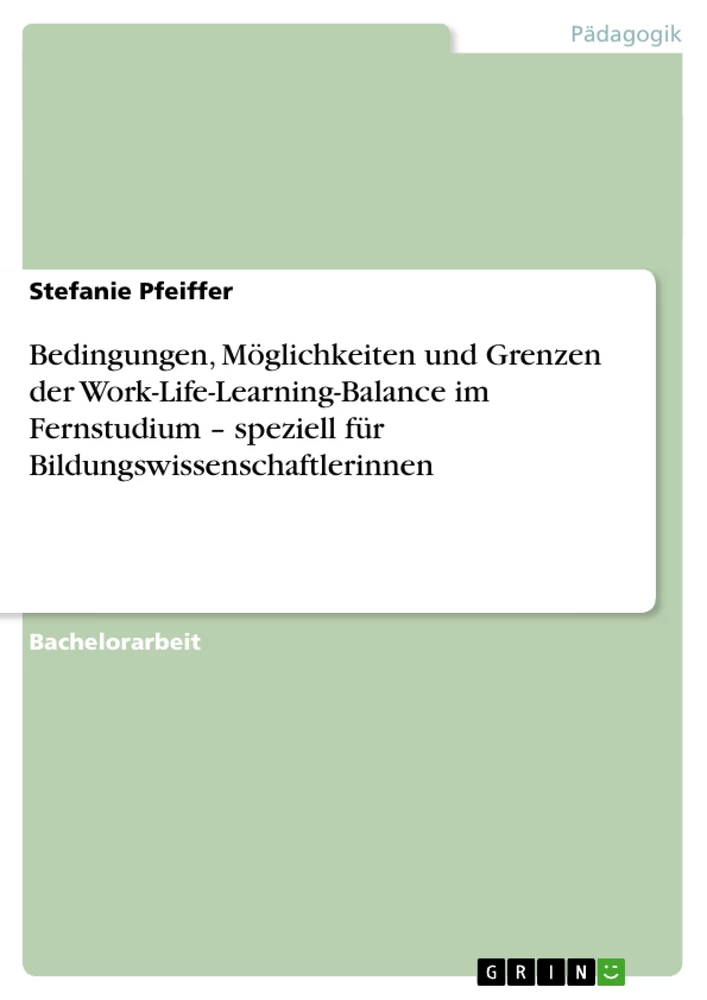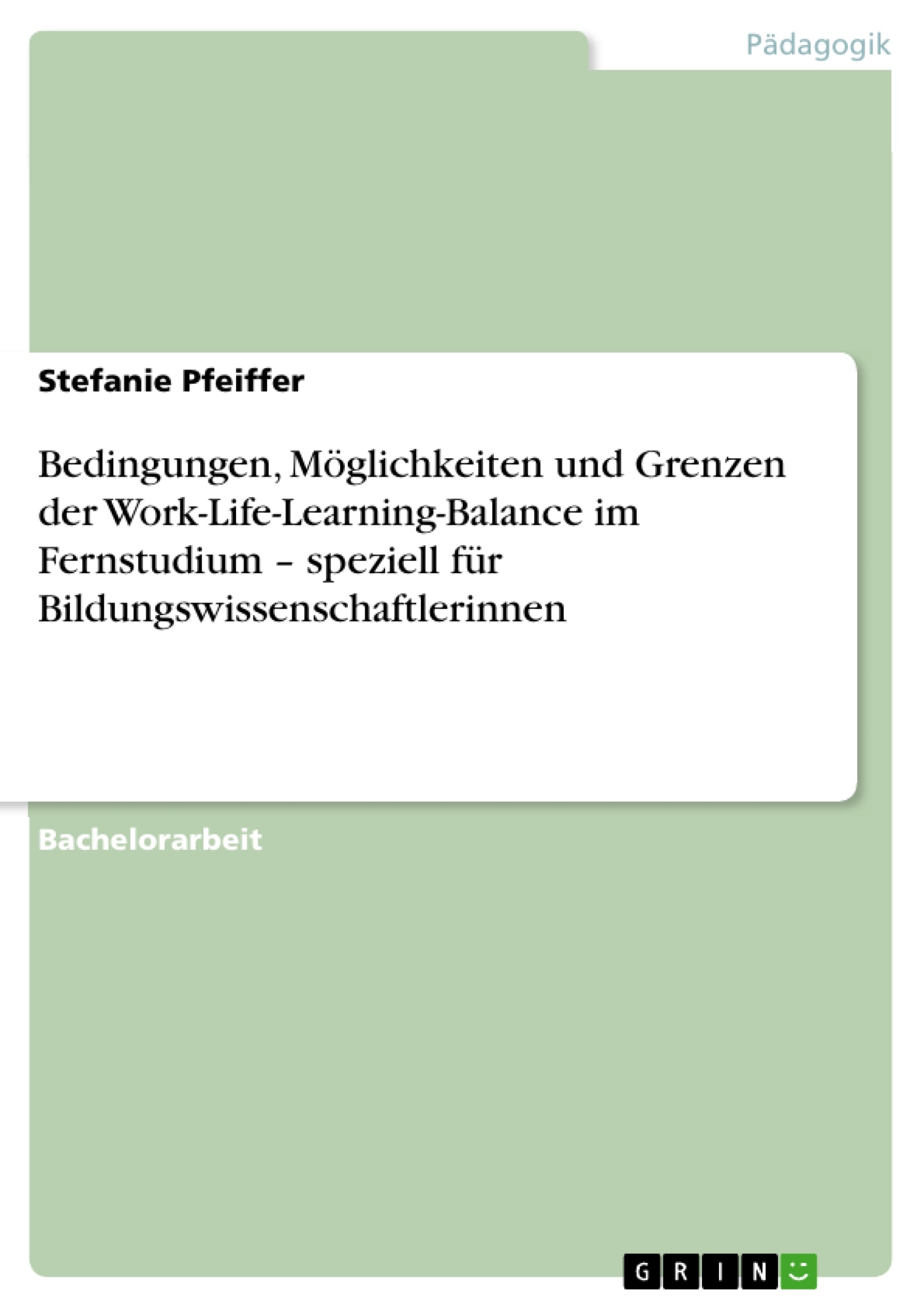Die Veröffentlichungen in unserer Gesellschaft zum Thema „Work-Life Balance“ nehmen immer mehr zu. Jeder versucht Möglichkeiten aufzuführen, um den Alltag und Berufsleben mit mehr Gleichgewicht gestalten zu können (vgl. Resch, 2003, S. 1). Noch nie war die Zahl der Angebote für Yoga, Entspannung, etc. so zentral an der Tagesordnung wie heute (vgl. Möhlmann, 2008, o. S.). Auch das Verreisen steht bei vielen Menschen in Deutschland an vorderster Stelle, um dem Stress zu entfliehen und im Urlaubsdomizil Entspannung zu finden.
Doch wie lässt sich wirklich eine Balance zwischen den drei Feldern Arbeit, Familienleben und Weiterbildung herstellen? Dazu soll diese Arbeit einen Beitrag leisten, indem sie Einblicke in die komplexen Zusammenhänge zwischen Arbeit, Familie und Weiterbildung ermöglicht.
Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit liegt auf der Perspektive von Bildungswissenschaftlerinnen, weshalb die Situation der Männer in dieser Arbeit keine Berücksichtigung findet. Ein Vergleich von Männern und Frauen im Fach Bildungswissenschaften ist ebenso nicht Teil dieser Arbeit. Wo in dieser Arbeit nur Frauen gemeint sind, werden diese mit der weiblichen Form benannt. Sind Frauen und Männer gemeint, gerade auch im Bezug auf Aussagen an-derer Autorinnen oder Autoren, wird die männliche Form verwendet. Die Begriffe „Work-Life Balance“, „Work-Life-Learning-Balance“ und „Lebenslanges Lernen“ werden in dieser Arbeit als Eigennamen verwendet, weshalb sie nicht gesondert gekennzeichnet werden. Zudem werden die mit Fußnoten gezeichneten Begriffe im Glossar erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- I. Theorieteil
- II. Empirieteil
- III. Schlussteil
- 1. Einleitung
- 2. Work-Life-Learning-Balance
- 2.1 Was versteht man unter Work-Life-Learning-Balance?
- 2.1.1 Zum Begriff Work-Life Balance und die Bedeutungszunahme des Lernens in der Gesellschaft
- 2.1.2 Eingrenzung von Work-Life Balance für diese Arbeit
- 2.1.3 Berufliche Sozialisation
- 2.1.4 Lebenslanges Lernen
- 2.1.5 Zusammenfassende Bedeutung von Work-Life-Learning-Balance
- 2.2 Zusammenfassung von Kapitel 2
- 3. Sozialer Wandel 21 als Rahmen für die Work-Life-Learning-Balance
- 3.1 Sozioökonomische Entwicklungstrends
- 3.1.1 Globalisierung
- 3.1.2 Strukturwandel der Arbeit
- 3.1.3 Individualisierung und Pluralisierung
- 3.1.4 Demographische Verschiebungen
- 3.2 Historische Hintergründe in Deutschland zur Stellung von Frau und Beruf
- 3.2.1 Die Ausgangssituation der Frauenbewegungen
- 3.2.2 Bemühungen und Ergebnisse der bürgerlichen und der proletarischen Frauenbewegungen bis zum Ende des I. Weltkriegs
- 3.2.3 Frau und Beruf ab 1933 bis zum Wiederaufbau in der Nachkriegszeit
- 3.3 Gender Aspekte - Gender Mainstreaming
- 3.3.1 Definition und Bedeutung von Gender Mainstreaming
- 3.3.2 Gender Mainstreaming in deutschen Betrieben
- 3.4 Bildungswissenschaft als Profession
- 3.4.1 Bildungswissenschaftlerinnen – Anerkennung in Familie und Arbeit wichtig
- 3.4.2 Bildungswissenschaft als Profession
- 3.4.3 Bildungswissenschaft als akademischer Beruf schwer mit Familie vereinbar
- 3.5 Zusammenfassung von Kapitel 3
- 4. Work-Life-Learning-Balance und Arbeits(un)zufriedenheit - Gute Arbeitsbedingungen als Hauptrolle für Balance
- 4.1 Kennzeichen guter Arbeitsbedingungen
- 4.2 Arbeits(un)zufriedenheit
- 4.2.1 Arbeitszufriedenheit und Arbeitsmotivation
- 4.2.2 Zur Zweifaktoren-Theorie der Arbeitszufriedenheit und seiner Kritik
- 4.2.3 Arbeits(un)zufriedenheit und Arbeitsleistung
- 4.3 Bessere Arbeitsbedingungen führen zu geringeren Ausfällen
- 4.4 Bildungswissenschaftliche Tätigkeitsfelder
- 4.5 Zusammenfassung von Kapitel 4
- 5. Work-Life-Learning-Balance im professionellen Beruf der Bildungswissenschaft macht „Investive Arbeitszeitpolitik“ nötig
- 5.1 Arbeitszeitflexibilisierung in der Arbeitswelt wird immer wichtiger
- 5.1.1 Motive zur Einführung der Arbeitszeitflexibilisierung und seine Modelle
- 5.2 Nutzen aus der Arbeitszeitflexibilisierung – „investive Arbeitszeitpolitik“
- 5.2.1 Investive Arbeitszeitpolitik - Arbeitszeit zugunsten von Weiterbildung
- 5.2.2 Verbindung von Arbeitszeiten mit Lernzeiten durch Lernzeitkonten
- 5.3 Weiterbildung in der Wissensgesellschaft wird immer bedeutender
- 5.3.1 Überblick der Weiterbildungssituation von Diplom-Pädagogen in Deutschland
- 5.3.2 Flexiblere Weiterbildung im Fernstudium im Vergleich zum Präsenzstudium
- 5.3.3 Lerntheoretische Hintergründe des heutigen Fernstudiums
- 5.3.4 Forschungspraktische Hintergründe der FernUni Hagen
- 5.4 Zusammenfassung von Kapitel 5
- 6. Analyse der Work-Life-Learning-Balance im Fernstudium
- 6.1 Theoretische Vorüberlegungen und Erstellung der Leitfragen
- 6.1.1 Formulieren der Untersuchungsfrage
- 6.1.2 Wahl einer Erklärungsstrategie
- 6.1.3 Bestimmung der Einflussfaktoren für diese Arbeit
- 6.1.4 Kategorien zur Erstellung der Leitfragen für Haupt- und Nachfragen
- 6.1.5 Theoretisches Modell: Kausalmechanismen der Sachdimensionen "Bedingungen, Möglichkeiten, Grenzen" zueinander
- 6.1.6 Zusammenhänge zwischen den einzelnen Begünstigungen der drei Felder Arbeit, Familie und Studium
- 6.1.7 Hypothesen aus den Zusammenhängen der drei Einflussfaktoren
- 6.2 Durchführung und Auswertung der Interviews
- 6.2.1 Untersuchungsstrategie
- 6.2.2 Die Fall-, Methoden-, und Ortsauswahl
- 6.2.3 Erstellung des Leitfragebogens für Betroffenen- und Expertinneninterviews und Vorstudien
- 6.2.4 Durchführung der Interviews und Transkription
- 6.2.5 Technische Vorbereitung der Extraktion und Erstellung des Kategoriensystems
- 6.2.6 Durchführung der Extraktion und Anpassung des Kategoriensystems
- 6.2.7 Aufbereitung der Daten
- 6.3 Auswertung und Interpretation
- 6.3.1 Ablauf der Auswertung
- 6.3.2 Vergleichende Analyse der Kausalmechanismen I-V
- 6.3.3 Interpretation der Kausalmechanismen aus Informationsbasis I
- 6.3.4 Interpretation der Kausalmechanismen aus Informationsbasis II
- 6.3.5 Interpretation der Kausalmechanismen aus Informationsbasis III
- 6.3.6 Interpretation der Kausalmechanismen aus Informationsbasis IV
- 6.3.7 Interpretation der Kausalmechanismen aus Informationsbasis V
- 6.4 Zusammenfassung von Kapitel 6
- 7. Diskussion und Ergebnisse
- 7.1 Diskussion der Kausalmechanismen
- 7.1.1 Übereinstimmung der Kausalmechanismen aus dem Modell mit allen Interviews
- 7.1.2 Übereinstimmungen der Kausalmechanismen aus dem Modell mit vier von fünf Interviews
- 7.1.3 Streuung der Kausalmechanismen innerhalb einer Sachdimension
- 7.1.4 Keine Übereinstimmung der Kausalmechanismen aus dem Modell
- 7.2 Ergebnisse
- 7.3 Geltungsbereich, Interpretation der Ergebnisse und neue Anhaltspunkte
- 7.4 Zusammenfassung von Kapitel 7
- 8. Zusammenfassung und Fazit
- Work-Life-Learning-Balance im Kontext des Fernstudiums
- Einfluss sozioökonomischer Faktoren auf die Work-Life-Learning-Balance
- Arbeitszufriedenheit und ihre Auswirkungen auf die Vereinbarkeit
- Flexibilität von Arbeitszeit und Weiterbildungsmöglichkeiten
- Gender-Aspekte und die spezifische Situation von Bildungswissenschaftlerinnen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Bedingungen, Möglichkeiten und Grenzen der Work-Life-Learning-Balance im Fernstudium, speziell für Bildungswissenschaftlerinnen. Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis der Herausforderungen und Chancen zu entwickeln, die mit der Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Fernstudium verbunden sind.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Work-Life-Learning-Balance im Fernstudium für Bildungswissenschaftlerinnen ein und skizziert die Forschungsfrage und die Methodik der Arbeit. Es begründet die Relevanz der Thematik und liefert einen Überblick über den Aufbau der Arbeit.
2. Work-Life-Learning-Balance: Kapitel 2 definiert den Begriff Work-Life-Learning-Balance und setzt ihn in den Kontext von Work-Life-Balance und lebenslangem Lernen. Es analysiert die Bedeutung der beruflichen Sozialisation und legt die Grundlage für das Verständnis des Forschungsgegenstandes.
3. Sozialer Wandel 21 als Rahmen für die Work-Life-Learning-Balance: Dieses Kapitel beleuchtet den sozioökonomischen Wandel, die historische Entwicklung der Stellung der Frau im Beruf in Deutschland und den Gender-Aspekt (Gender Mainstreaming) im Kontext der Work-Life-Learning-Balance für Bildungswissenschaftlerinnen. Es beschreibt die Herausforderungen, denen sich Frauen in diesem Berufsfeld gegenübersehen.
4. Work-Life-Learning-Balance und Arbeits(un)zufriedenheit: Kapitel 4 untersucht den Zusammenhang zwischen guten Arbeitsbedingungen, Arbeitszufriedenheit und der Work-Life-Learning-Balance. Es analysiert Kennzeichen guter Arbeitsbedingungen und deren Einfluss auf die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Studium, besonders im Hinblick auf die spezifischen Arbeitsfelder von Bildungswissenschaftlerinnen.
5. Work-Life-Learning-Balance im professionellen Beruf der Bildungswissenschaft macht „Investive Arbeitszeitpolitik“ nötig: Dieses Kapitel befasst sich mit der Bedeutung von flexiblen Arbeitszeitmodellen ("investive Arbeitszeitpolitik") und Weiterbildungsmöglichkeiten im Kontext der Work-Life-Learning-Balance. Es beleuchtet die Bedeutung von Lernzeitkonten und die Situation der Weiterbildung im Fernstudium im Vergleich zum Präsenzstudium für Diplom-Pädagogen in Deutschland.
6. Analyse der Work-Life-Learning-Balance im Fernstudium: Kapitel 6 beschreibt die empirische Untersuchung. Es erläutert die Forschungsmethodik, die Auswahl der Teilnehmerinnen und die Auswertung der Interviews. Es werden die Ergebnisse der Interviews präsentiert und interpretiert.
Schlüsselwörter
Work-Life-Learning-Balance, Fernstudium, Bildungswissenschaftlerinnen, Arbeitszufriedenheit, Flexibilisierung der Arbeitszeit, Gender Mainstreaming, Lebenslanges Lernen, Sozioökonomischer Wandel, Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Studium, Qualitative Forschung, Interview.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Work-Life-Learning-Balance im Fernstudium für Bildungswissenschaftlerinnen
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Bedingungen, Möglichkeiten und Grenzen der Work-Life-Learning-Balance für Bildungswissenschaftlerinnen im Fernstudium. Sie analysiert die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Fernstudium und beleuchtet die Herausforderungen und Chancen dieses Kontextes.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: Work-Life-Learning-Balance im Fernstudium, Einfluss sozioökonomischer Faktoren (Globalisierung, Strukturwandel, Individualisierung, demografische Veränderungen), Arbeitszufriedenheit und deren Auswirkungen auf die Vereinbarkeit, flexible Arbeitszeitmodelle und Weiterbildungsmöglichkeiten, Gender-Aspekte und die spezifische Situation von Bildungswissenschaftlerinnen, sowie eine empirische Untersuchung mittels Interviews.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in einen Theorieteil, einen Empirieteil und einen Schlussteil. Der Theorieteil umfasst Kapitel zu den Begriffen Work-Life-Learning-Balance, sozialem Wandel, Arbeitszufriedenheit und flexiblen Arbeitszeitmodellen. Der Empirieteil beschreibt die qualitative Studie mit Interviews und deren Auswertung. Der Schlussteil diskutiert die Ergebnisse und zieht ein Fazit.
Welche Methoden wurden verwendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Forschungsmethode. Im Empirieteil werden Interviews mit Bildungswissenschaftlerinnen im Fernstudium durchgeführt und ausgewertet, um die Work-Life-Learning-Balance zu analysieren. Es wird ein Leitfaden für die Interviews verwendet, die Daten werden transkribiert und nach einem Kategoriensystem ausgewertet.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse der Interviews werden im Hinblick auf die Kausalmechanismen zwischen den Einflussfaktoren "Bedingungen, Möglichkeiten, Grenzen" analysiert und interpretiert. Die Arbeit vergleicht die Ergebnisse mit dem theoretischen Modell und diskutiert Übereinstimmungen und Abweichungen. Es werden Schlussfolgerungen für die Work-Life-Learning-Balance im Fernstudium gezogen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Work-Life-Learning-Balance, Fernstudium, Bildungswissenschaftlerinnen, Arbeitszufriedenheit, Flexibilisierung der Arbeitszeit, Gender Mainstreaming, Lebenslanges Lernen, Sozioökonomischer Wandel, Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Studium, Qualitative Forschung, Interview.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis der Herausforderungen und Chancen der Work-Life-Learning-Balance im Fernstudium für Bildungswissenschaftlerinnen zu entwickeln. Sie soll Erkenntnisse liefern, wie die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Fernstudium verbessert werden kann.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Bildungswissenschaftlerinnen im Fernstudium, Hochschulen, Arbeitgeber im Bildungsbereich und alle, die sich mit der Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Weiterbildung beschäftigen.
Wo kann ich die vollständige Arbeit einsehen?
Die vollständige Arbeit ist [hier den Zugang zur Arbeit einfügen, z.B. "auf Anfrage bei der Autorin erhältlich"].
- Citar trabajo
- Stefanie Pfeiffer (Autor), 2009, Bedingungen, Möglichkeiten und Grenzen der Work-Life-Learning-Balance im Fernstudium – speziell für Bildungswissenschaftlerinnen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167707