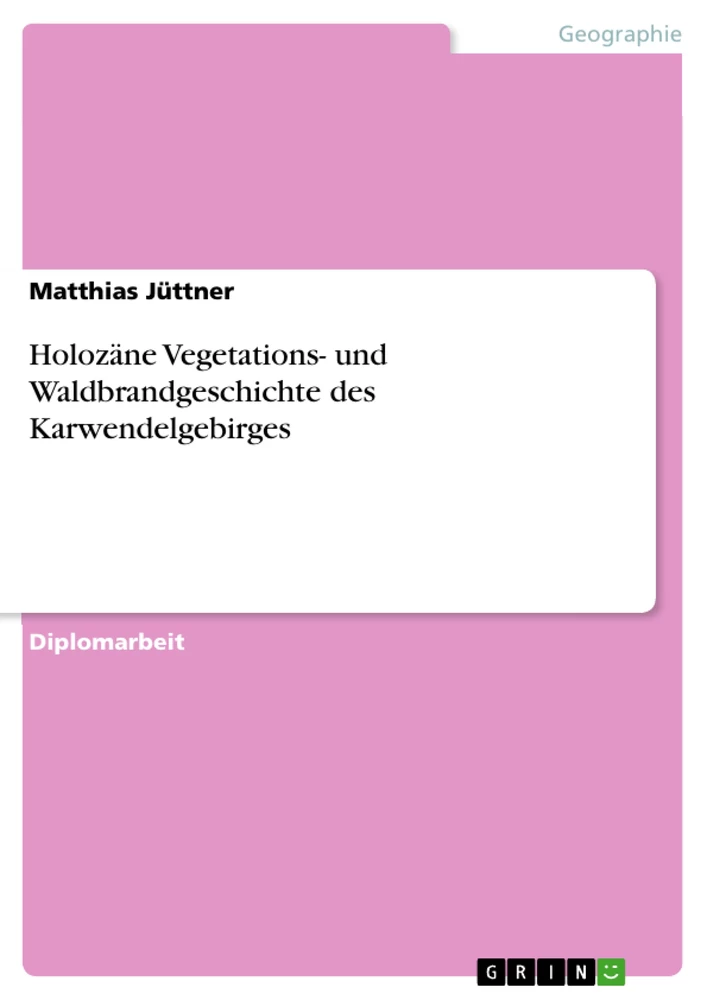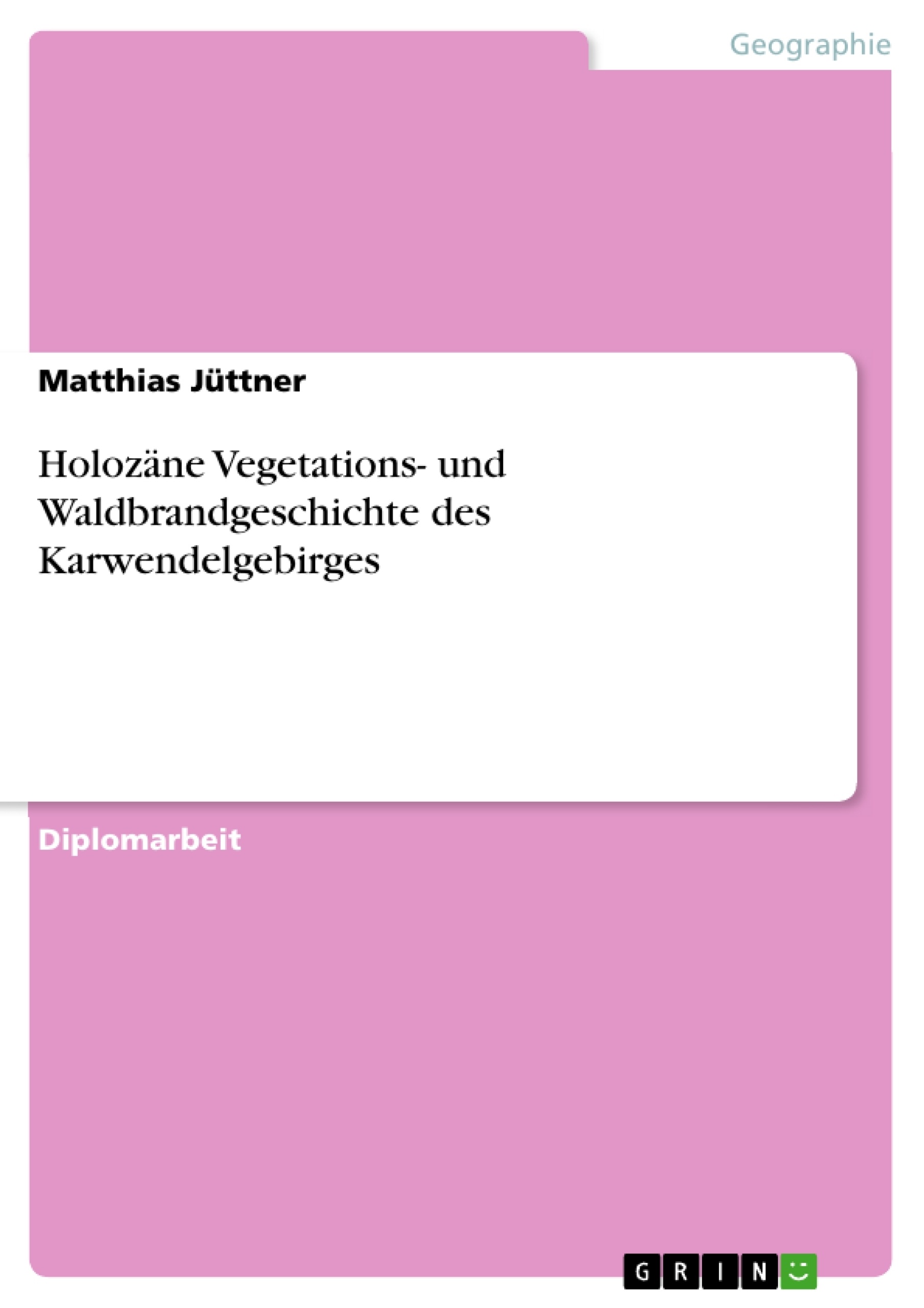In einer Zusammenarbeit der Universitäten Innsbruck und Augsburg wurde ein von der DFG gefördertes Projekt ins Leben gerufen welches sich mit den Auswirkungen von Bränden an Gebirgshängen beschäftigt. Im Rahmen dieses Projekts wurden verschiedene Hänge im Karwendelgebirge untersucht, beispielsweise im Hinblick auf die Auswirkungen von Feuerereignissen auf Vegetationssukzessionen und Hangabtragsparameter untersucht, so wie versucht durch Archiv- und Recherchearbeit die Brandgeschichte des Gebiets zu rekonstruieren. Zu diesem Zweck wurde auch das Halslkopfmoor untersucht. Durch eine Pollenanalyse sollte die holozäne Vegetationsgeschichte rekonstruiert, und im Zuge dessen anhand mikroskopischer Holzkohlepartikel auch die holozäne Brandgeschichte näher beleuchtet werden. Neben dem Nutzen für das Projekt ist die Wahl des Halslkopfmoores in zusätzlicher Hinsicht interessant. Obwohl aus den nördlichen Kalkalpen bereits einige palynologische Untersuchungen von Mooren vorliegen (BORTENSCHLAGER 1984, WAHLMÜLLER 1985, OEGGL 1988, WALDE 1999) ist unmittelbar in der Nähe des Untersuchungsgebiets noch keine Pollenanalyse vorgenommen worden. Die vorliegende Arbeit liefert also einen zusätzlichen Punkt im Netzwerk bereits bestehender Arbeiten der hilft die Vegetationsgeschichte des Nordtiroler Alpenraumes genauer rekonstruieren und verstehen zu können. Die relativ abgelegene und hohe Lage des Halslkopfmoores ist zudem interessant bezüglich der Frage wie stark der Mensch durch seine Nutzung auch eher ungünstigere Standpunkte erschlossen hat, sind die anderen Arbeiten doch eher entlang des nutzerisch günstigeren Inntales gelegen.
Die Vorliegende Arbeit gibt zunächst eine geographische Beschreibung des Untersuchungsgebietes wieder und erläutert dann die angewandten Methoden bei der Feld- und Laborarbeit. Im Ergebnisteil werden dann die erstellten Pollendiagramme beschrieben und analysiert. Abschließend erfolgt eine Gesamtbetrachtung der Vegetationsgeschichte Nordtirols durch den Vergleich mit anderen Arbeiten aus dem Gebiet.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Geographie und Geologie des Karwendelgebirges
- 2.1 Abgrenzung des Karwendelgebirges
- 2.2 Klima
- 2.3 Geologie
- 2.3.1 Mittlere Trias
- 2.3.2 Obere Trias
- 2.3.3 Jura (Lias,Dogger,Malm)
- 2.3.4 Kreide
- 2.4 Geographische Lage des Halslkopfmoores
- 3. Material und Methoden
- 3.1 Feldmethoden
- 3.2 Labormethoden
- 3.2.1 Probenentnahme
- 3.2.2 Chemische Aufbereitung der Proben
- 3.2.2.1 Salzsäurebehandlung
- 3.2.2.2 Kalilauge (KOH)
- 3.2.2.3 Waschen der Proben
- 3.2.2.4 Flusssäure (HF)
- 3.2.2.5 Acetolyse nach Erdtman
- 3.2.2.6 Ultraschall
- 3.2.2.7 Konservierung
- 3.2.3 Pollenanalyse
- 3.2.3.1 Bestimmungsmerkmale von Pollenkörnern
- 3.2.3.2 Lichtmikroskopische Auszählung
- 3.2.4 Holzkohleanalyse
- 4. Ergebnisse
- 4.1 Sedimentbeschreibung
- 4.2 Besiedelungsgeschichte
- 4.3 Beschreibung der lokalen Pollenzonen (LPZ)
- 4.4 Vegetationsentwicklung und Landnutzung
- 5. Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Diplomarbeit untersucht die holozäne Vegetations- und Waldbrandgeschichte des Karwendelgebirges anhand pollenanalytischer Untersuchungen im Halslkopfmoor. Sie strebt eine detaillierte Rekonstruktion der Vegetationsentwicklung und des menschlichen Einflusses auf diese über die vergangenen 10.000 Jahre an.
- Rekonstruktion der holozänen Vegetationsgeschichte des Halslkopfmoores
- Analyse des Einflusses menschlicher Landnutzung auf die Vegetation
- Untersuchung der holozänen Brandgeschichte anhand von Holzkohleanalysen
- Vergleich der Ergebnisse mit anderen Pollenprofilen aus dem Nordtiroler Raum
- Erarbeitung von Schlussfolgerungen zum Wechselspiel zwischen natürlicher Vegetationsentwicklung und menschlicher Einflussnahme
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Kapitel 1: Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik der Diplomarbeit ein und beschreibt die Motivation und den wissenschaftlichen Hintergrund der Untersuchungen. Sie stellt das Projekt zur Erforschung der Auswirkungen von Bränden an Gebirgshängen vor und erklärt die Auswahl des Halslkopfmoores als Untersuchungsgebiet.
- Kapitel 2: Geographie und Geologie des Karwendelgebirges: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte geographische und geologische Beschreibung des Karwendelgebirges. Es behandelt die Abgrenzung des Gebirges, das Klima, die Geologie und die Lage des Halslkopfmoores innerhalb des Gebirges.
- Kapitel 3: Material und Methoden: In diesem Kapitel werden die angewandten Methoden für die Feld- und Laborarbeit ausführlich dargestellt. Es erläutert die Probenahme, die chemische Aufbereitung der Proben, die Pollenanalyse und die Holzkohleanalyse.
- Kapitel 4: Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der pollenanalytischen Untersuchungen, einschließlich der Sedimentbeschreibung, der Besiedelungsgeschichte, der Beschreibung der lokalen Pollenzonen und der Vegetationsentwicklung sowie der Landnutzung.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Diplomarbeit konzentriert sich auf die Themengebiete der Pollenanalyse, der Vegetationsgeschichte, der Waldbrandgeschichte und der Landnutzung im Karwendelgebirge. Wichtige Schlüsselbegriffe sind daher Pollenstratigraphie, holozäne Vegetationsentwicklung, Brandereignisse, Holzkohleanalyse, anthropogener Einfluss und Landnutzungsphasen.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird die Waldbrandgeschichte des Karwendelgebirges rekonstruiert?
Die Rekonstruktion erfolgt durch die Analyse von mikroskopischen Holzkohlepartikeln, die in den Sedimentschichten des Halslkopfmoores gefunden wurden.
Was ist eine Pollenanalyse?
Bei einer Pollenanalyse (Palynologie) werden fossile Pollenkörner aus Mooren untersucht, um die Vegetationsentwicklung über Jahrtausende hinweg nachzuvollziehen.
Welche Rolle spielt der Mensch in der Vegetationsgeschichte dieses Gebiets?
Die Arbeit untersucht, wie stark der Mensch durch Landnutzung auch entlegene Hochlagen des Karwendels erschlossen und die natürliche Waldzusammensetzung verändert hat.
Welchen Zeitraum deckt die Untersuchung ab?
Die Studie befasst sich mit dem Holozän, also dem Zeitraum der letzten ca. 10.000 Jahre nach der letzten Eiszeit.
Warum wurde das Halslkopfmoor als Untersuchungsort gewählt?
Es liegt in einer relativ abgelegenen und hohen Lage, für die bisher noch keine detaillierten Pollenprofile vorlagen, was die Forschungslücke im Nordtiroler Alpenraum schließt.
- Quote paper
- Matthias Jüttner (Author), 2010, Holozäne Vegetations- und Waldbrandgeschichte des Karwendelgebirges, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167728