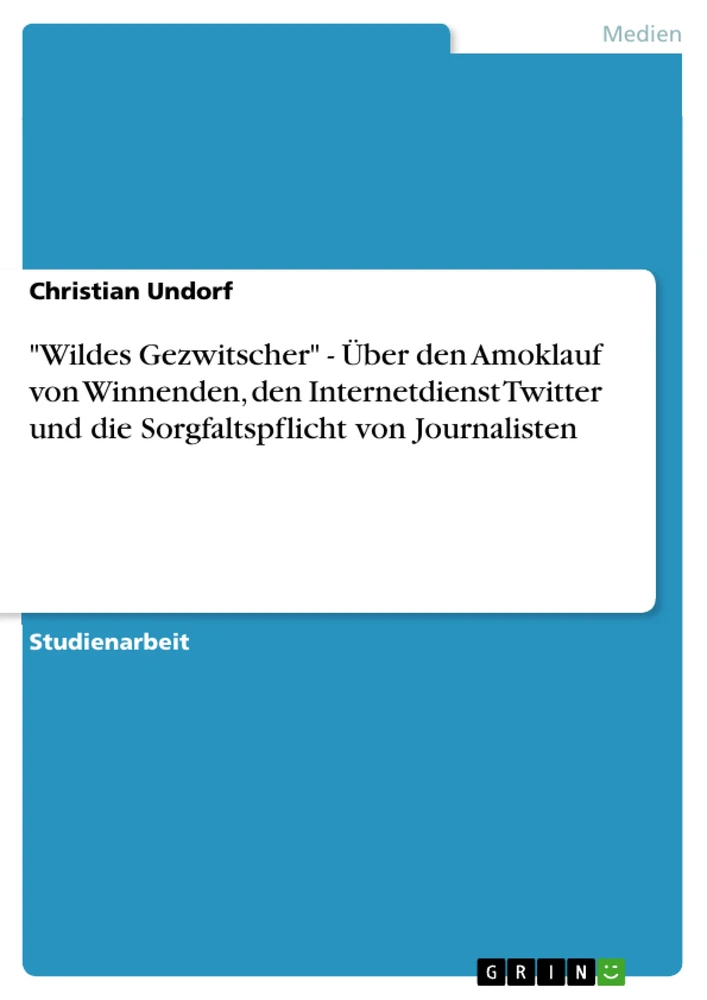Eine Twitter-Nachricht, gesendet am 11. März 2009 um 10:37 Uhr, gilt als eine der ersten öffentlichen Mitteilungen zu einem der tragischsten Ereignisse des Jahres 2009 in Deutschland: An diesem Tag betrat gegen 9:30 Uhr, also nur wenige Minuten bevor jene Nachricht bereits im weltweiten Datennetz erschien, der 17-jährige Tim K. die Albertville-Realschule im kleinen Ort Winnenden in der Nähe von Stuttgart und eröffnete das Feuer. Die traurige Bilanz dieses Tages: 15 Menschen starben, zwei Polizisten erlitten schwere Verletzungen.
Nun verwundert nicht, dass dieses Ereignis wegen der besonderen Schwere der Tat eine große Welle der medialen Berichterstattung nach sich zog. Am 11. März 2009 wurden jedoch auch die Twitter-Server fast sekündlich mit neuen Kurznachrichten zum parallel stattfindenden Amoklauf überschwemmt, wobei auffällig ist, dass sich dabei nicht etwa nur Privatleute an dem Diskurs im Netz beteiligten, sondern auch zahlreiche Journalisten und Vertreter "klassischer" Medien, wie zum Beispiel bekannte Marken deutscher Verlagshäuser oder deren Online-Redaktionen mit von der Partie waren. Dabei unterliefen den selbsternannten wie auch den beruflichen Informationsverbreitern jedoch etliche Fehler, die so nicht hätten passieren dürfen.
Auf jeweils einen absichtlich kurz gehaltenen Überblick über die "Hauptakteure" in dieser Arbeit, den betrachteten Amoklauf selbst, die Rolle der Medien sowie die grundlegende Funktionsweise von Twitter, folgt eine nähere Auseinandersetzung mit den verschiedenen, an jenem Tag geschehenen "Fehltritten", die – nachdem die erste Welle der Berichterstattung über die eigentliche Tat erst einmal abgeklungen war – ein fast ebenso lautes Echo über die erfolgte Berichterstattung selbst nach sich zog. Vor allem die "twitternden" Journalisten sahen sich in diesem Zusammenhang heftiger Kritik ausgesetzt.
Die vorliegende Arbeit soll eine Übersicht über die wichtigsten Beobachtungen zu den Geschehnissen in Winnenden in Zusammenhang mit Twitter liefern, die sich anschließende, öffentliche Empörung nachvollziehbar machen und kann überdies hoffentlich einen ersten Beitrag zu einem Verständnis dieser neuen diskursiven Strukturen im Netz leisten, wie sie uns in Zukunft sicher noch vielfach beschäftigen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung – Eine neue Form von Journalismus?
- 2. Über die beteiligten „Akteure“
- 2.1 Der Amoklauf von Winnenden und die Medien
- 2.2 Der Internetdienst Twitter
- 3. „Amok twittern\" - Wie sich der Diskurs parallel zum Geschehen im Internet schrieb
- 3.1 Die vermeintlichen Augenzeugen zwitschern in Echtzeit
- 3.2 ,,@amok\" - Wenn Journalisten Grenzen des guten Geschmacks überschreiten
- 3.3 Wenn Vögel Enten vermelden - Falschmeldungen in 140 Zeichen
- 4. Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Amoklauf von Winnenden im Jahr 2009 und der Rolle des Internetdienstes Twitter in der Berichterstattung über das Ereignis. Sie analysiert, wie sich die Kommunikation im Internet während des Amoklaufs entwickelte und welche Herausforderungen sich für Journalisten im Umgang mit diesem neuen Medium ergeben.
- Die Bedeutung von Twitter als Plattform für Nachrichtenverbreitung in Echtzeit
- Die Herausforderungen der Sorgfaltspflicht von Journalisten im Kontext des schnellen Nachrichtenflusses auf Twitter
- Die Verbreitung von Fehlinformationen und die Folgen für die öffentliche Meinung
- Die ethischen Aspekte der Berichterstattung über ein sensibles Thema wie einen Amoklauf
- Die Rolle von Social Media in der modernen Nachrichtenlandschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird der Kontext der Arbeit eingeführt und die Frage nach einer neuen Form des Journalismus im digitalen Zeitalter aufgeworfen. Das zweite Kapitel beleuchtet die wichtigsten Akteure, nämlich den Amoklauf von Winnenden und den Internetdienst Twitter. Im dritten Kapitel werden die verschiedenen Phasen der Berichterstattung auf Twitter analysiert, darunter die Verbreitung von Informationen durch vermeintliche Augenzeugen, die ethischen Grenzen, die Journalisten im Umgang mit dem Thema überschreiten, sowie die Verbreitung von Falschmeldungen.
Schlüsselwörter
Amoklauf, Winnenden, Twitter, Journalismus, Social Media, Nachrichtenverbreitung, Sorgfaltspflicht, Fehlinformationen, ethische Aspekte, Online-Kommunikation
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielte Twitter beim Amoklauf von Winnenden?
Twitter diente 2009 als einer der ersten Kanäle für Echtzeit-Informationen. Sowohl Augenzeugen als auch Journalisten nutzten den Dienst, was zu einer extrem schnellen, aber auch fehleranfälligen Berichterstattung führte.
Welche Fehler unterliefen Journalisten bei der Twitter-Nutzung?
Journalisten verbreiteten teilweise ungeprüfte Falschmeldungen und überschritten ethische Grenzen des guten Geschmacks, indem sie die Jagd nach Schnelligkeit über die Sorgfaltspflicht stellten.
Was bedeutet die Sorgfaltspflicht im digitalen Journalismus?
Sie verpflichtet Journalisten dazu, Informationen vor der Veröffentlichung auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen – eine besondere Herausforderung im „Echtzeit-Web“ von Social Media.
Wie verbreiteten sich Falschmeldungen während des Amoklaufs?
Durch das massenhafte Retweeten von Gerüchten vermeintlicher Augenzeugen entstanden „Enten“, die von klassischen Medien übernommen wurden, bevor sie offiziell bestätigt oder dementiert werden konnten.
Ist Twitter eine seriöse Nachrichtenquelle?
Twitter kann als wertvolles Frühwarnsystem dienen, erfordert aber von Journalisten und Nutzern eine hohe Medienkompetenz und eine kritische Distanz zu den Inhalten.
- Citation du texte
- Christian Undorf (Auteur), 2010, "Wildes Gezwitscher" - Über den Amoklauf von Winnenden, den Internetdienst Twitter und die Sorgfaltspflicht von Journalisten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167773