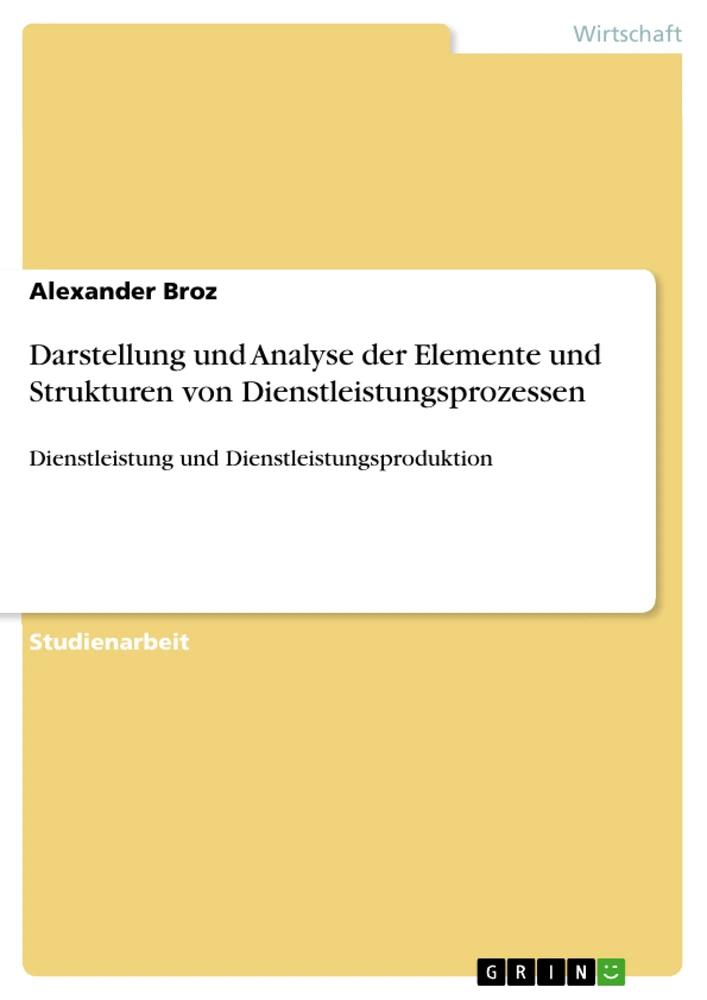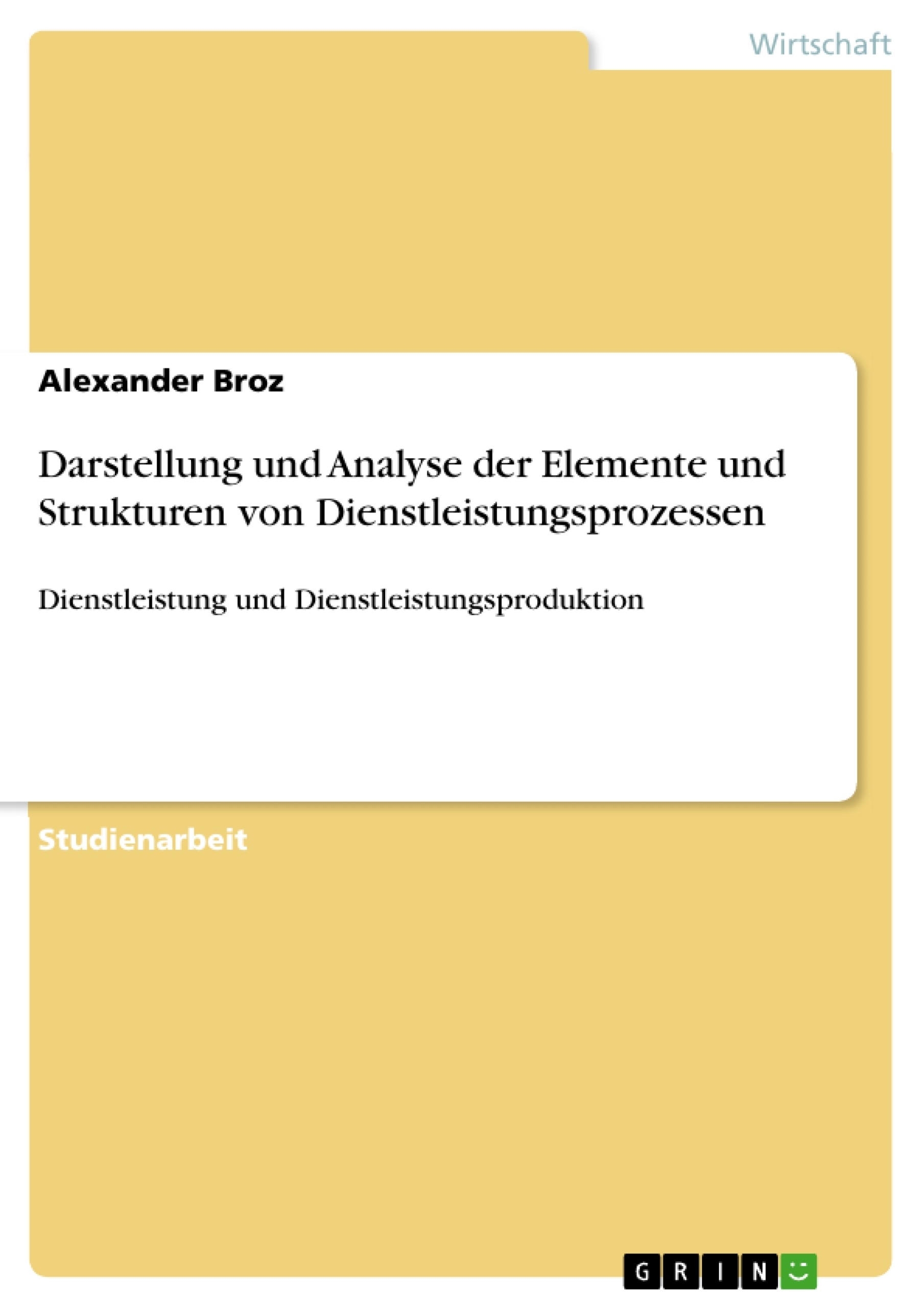Die zunehmenden Erträge im Dienstleistungsbereich in Verbindung
mit den immer höheren Kundenanforderungen zwingen Unternehmen sich noch intensiver mit ihren Produkten und Dienstleistungen auseinanderzusetzen. Zusätzliche Herausforderungen durch immer kürzere Produktlebenszyklen und steigende Ansprüche an Qualität bei gleichzeitig kostenoptimaler Produktion können nur noch durch stärkeres Einbeziehen des Kunden bewältigt werden. Insbesondere die Dienstleistung am und mit dem Kunden wird immer individueller. Weiterhin fallende Marktbarrieren erfordern in Zukunft eine noch stärkere Einbeziehung des Kunden für eine langfristige erfolgreiche Kundenbindung.
Diese Seminararbeit betrachtet den Komplex der Dienstleistungsproduktion, ihrer Elemente und Strukturen sowie der übergreifenden Darstellung der Dienstleistung als Prozess.
Ziel ist die Herausarbeitung der wesentlichen Merkmale von Dienstleistungen im Vergleich zur klassischen Sachgüterproduktion im Rahmen einzelner Begrifflichkeiten, bekannter Modelle und in der Prozessdarstellung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zieldefinition und Abgrenzung
- Vorgehensweise
- Grundlagen zur Darstellung und Analyse betriebswirtschaftlicher Prozesse und insbesondere Dienstleistungsprozesse
- Einleitung
- Prozessorientierung
- Allgemeine Definition von Prozessen
- Begriff und Abgrenzung von Dienstleistung
- Einordnung in die klassische Produktionstheorie
- Abgrenzung zwischen Sach- und Dienstleistungsgütern
- Klassifizierung von Dienstleistung
- Dienstleistungsproduktion
- Dienstleistung als Prozess
- Analyse und Darstellung von Prozessen mit dem Schwerpunkt auf Dienstleistungsprozesse
- Analyse eines Dienstleistungsprozesses
- Prozessidentifikation und -abgrenzung
- Strukturierung
- Gestaltung und Dokumentation
- Modelle zur Prozessdarstellung
- Prozessflussdiagramme
- Blueprinting
- Instrumente zur Bewertung von Prozessen
- Prozesskostenrechnung
- Service Level Agreements
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Darstellung und Analyse von Dienstleistungsprozessen im Kontext der zunehmenden Bedeutung des Dienstleistungssektors in Deutschland. Das Ziel ist es, die Elemente und Strukturen von Dienstleistungsprozessen zu identifizieren und zu analysieren, um ein tieferes Verständnis für die Besonderheiten und Herausforderungen der Dienstleistungsbranche zu gewinnen.
- Prozessorientierung im Dienstleistungssektor
- Abgrenzung und Klassifizierung von Dienstleistungen
- Analyse und Darstellung von Dienstleistungsprozessen
- Modelle und Instrumente zur Prozessbewertung
- Der Einfluss von Informations- und Kommunikationstechnologien auf Dienstleistungsprozesse
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung erläutert die Problemstellung, die sich aus der rasanten Entwicklung des Dienstleistungssektors in Deutschland ergibt. Sie skizziert die zunehmende Bedeutung von Dienstleistungen in der Wirtschaft und die damit verbundenen Herausforderungen für Unternehmen.
- Kapitel 2: Grundlagen zur Darstellung und Analyse betriebswirtschaftlicher Prozesse und insbesondere Dienstleistungsprozesse
Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse von Dienstleistungsprozessen. Es definiert den Begriff "Prozess" im betriebswirtschaftlichen Kontext und beleuchtet die Besonderheiten von Dienstleistungsprozessen im Vergleich zu Produktionsprozessen.
- Kapitel 3: Analyse und Darstellung von Prozessen mit dem Schwerpunkt auf Dienstleistungsprozesse
Dieses Kapitel widmet sich der Analyse und Darstellung von Dienstleistungsprozessen. Es beschreibt verschiedene Methoden und Modelle zur Prozessidentifikation, -abgrenzung, -strukturierung und -bewertung.
Schlüsselwörter
Dienstleistungsprozess, Prozessanalyse, Prozessmodellierung, Prozessmanagement, Dienstleistungsproduktion, Service Level Agreements, Prozesskostenrechnung, Informations- und Kommunikationstechnologien, Business Process Reengineering, Outsourcing.
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet Dienstleistungen von Sachgütern?
Dienstleistungen sind immateriell, nicht lagerfähig und erfordern oft die direkte Beteiligung des Kunden (externer Faktor) am Erstellungsprozess.
Was ist „Blueprinting“ im Dienstleistungsmanagement?
Ein Modell zur visuellen Darstellung von Dienstleistungsprozessen, das Kundeninteraktionen und interne Abläufe (Sichtbarkeitslinie) detailliert abbildet.
Welche Rolle spielen Service Level Agreements (SLAs)?
SLAs definieren messbare Qualitätsstandards und Leistungsmerkmale einer Dienstleistung, um Erwartungen zwischen Anbieter und Kunde zu klären.
Warum ist Prozessorientierung für Dienstleister wichtig?
Sie hilft dabei, komplexe Abläufe effizient zu gestalten, Kosten durch Prozesskostenrechnung zu kontrollieren und die Servicequalität zu sichern.
Was bedeutet „Klassifizierung von Dienstleistungen“?
Dienstleistungen werden nach Kriterien wie dem Grad der Kundenbeteiligung, der Standardisierung oder dem Objekt der Leistung (Mensch vs. Sache) eingeteilt.
Wie beeinflusst die IT moderne Dienstleistungsprozesse?
Informations- und Kommunikationstechnologien ermöglichen die Automatisierung, das Outsourcing und eine stärkere Individualisierung von Services.
- Arbeit zitieren
- Alexander Broz (Autor:in), 2009, Darstellung und Analyse der Elemente und Strukturen von Dienstleistungsprozessen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167827