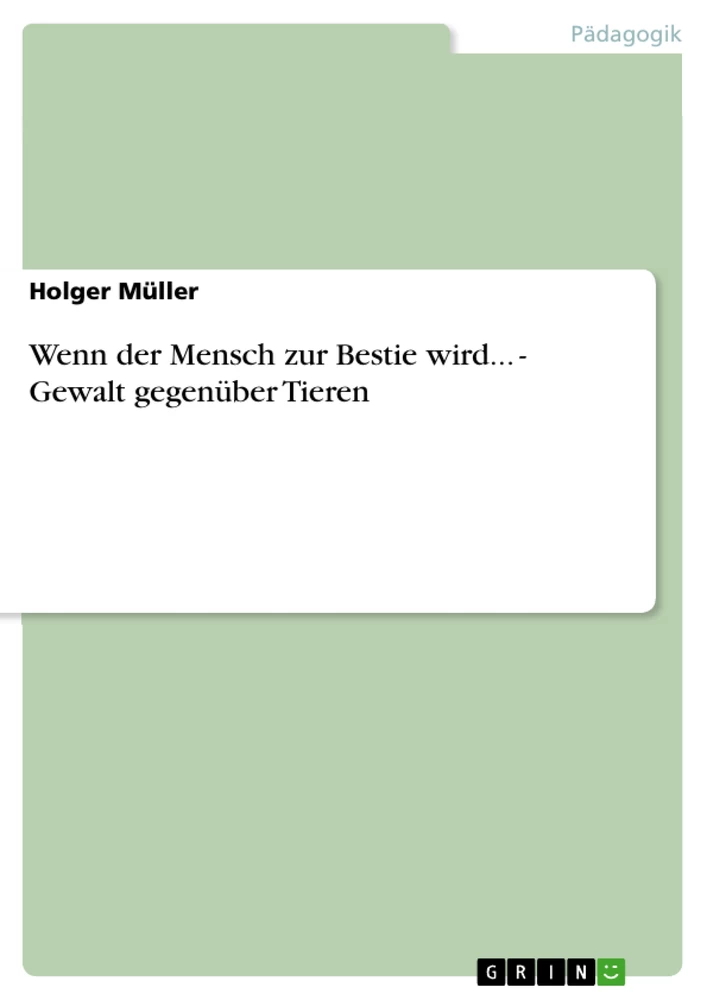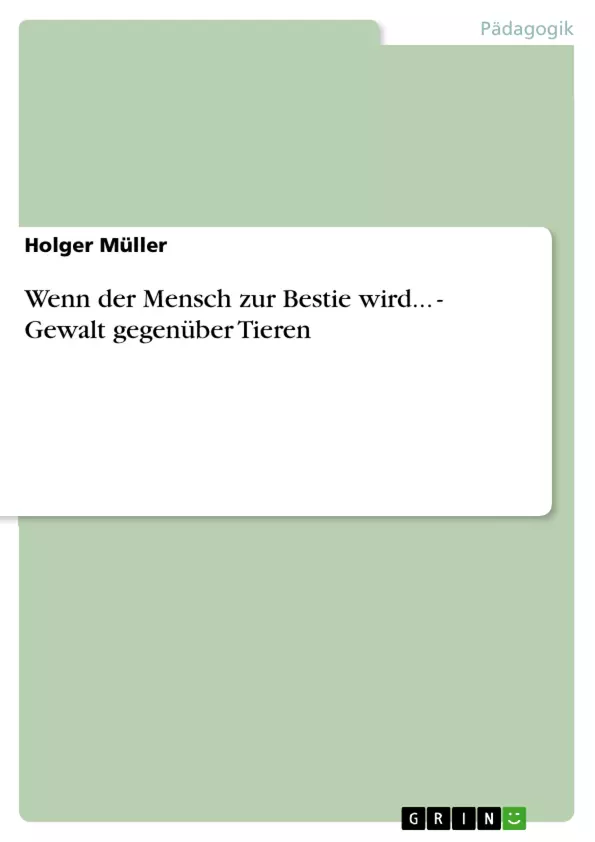Die vorliegende Ausarbeitung wurde im Rahmen der Veranstaltung „Wenn der Mensch zur Bestie wird... Theoanthropologische Deutung zwischenmenschlichen Gewaltverhaltens“verfasst. Diese Veranstaltung hat sich zum Ziel gesetzt, die gewalttätige Facette
des Menschen (welche im Laufe der Jahrhundert immer wieder zum Vorschein kam) deutlich aufzuzeigen. Ausgewählte Gewaltaten wie z. B. die Folter, das Massaker und die Gewalt an Kindern wurden explizite thematisiert und verschiedene Facetten der Gewalttaten durchleuchtet. Diese Ausarbeitung beschäftigt sich mit der „Gewalt gegenüber
Tieren“.
Das erste Kapitel beschäftigt sich mit verschiedenen Facetten des Themas „Tierexperimente“. Dabei geht es im wesentlichen um,
- rechtliche Aspekte
- erschreckende Beispiele
- Alternativen zu Tierexperimenten.
Das zweite Kapitel handelt von den so genannten „Nutztieren“. Angefangen bei der Massentierhaltung, die
exemplarisch an der Schweinehaltung dargestellt wird, werden anschließend die Tiertransporte thematisiert. Im Anschluss werden Nutztiere beschrieben, die die Menschen in Zirkussen unterhalten sollen. Das Kapitel „das Leiden der Zirkustiere“ wird beschreibt,
dass das „Leben“ im Zirkus für die Tiere eine Qual ist.
Im nachfolgenden dritten Kapitel wird am Beispiel der Tierart Wal herausgearbeitet, inwieweit der Mensch fähig
ist, ganze Tierarten am Rande des Aussterbens zu bringen. Die Meeressäuger stehen dabei exemplarisch für (wildlebende) Tiere, die als gefährdet eingestuft werden.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Tierexperimente
- Allgemeines
- Rechtliche Grundlagen
- Beispiele
- Sterben für Botox
- Ist Rauchen gefährlich ...?
- Vom BMBF mitfinanziert...
- Alternativen
- Nutztiere
- Massentierhaltung am Beispiel der Schweinehaltung
- Tiertransporte
- Das Leiden der Zirkustiere
- Wale Eine bedrohte Tierart
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Ausarbeitung untersucht die Gewalt des Menschen gegenüber Tieren im Kontext der Veranstaltung „Wenn der Mensch zur Bestie wird... Theoanthropologische Deutung zwischenmenschlichen Gewaltverhaltens“. Sie beleuchtet die historische Mensch-Tier-Beziehung und thematisiert den Wandel dieser Beziehung in der heutigen Zeit. Die Ausarbeitung analysiert verschiedene Formen der Tierausbeutung und verdeutlicht die ethischen und rechtlichen Aspekte dieser Praktiken.
- Tierexperimente und ihre ethischen und rechtlichen Grundlagen
- Die Folgen der Massentierhaltung und Tiertransporte
- Das Leid von Tieren in Zirkussen
- Die Bedrohung von Tierarten durch den Menschen, am Beispiel der Wale
- Diskussion der Mensch-Tier-Beziehung und deren ethische Dimensionen
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel analysiert das Thema Tierexperimente, wobei rechtliche Aspekte, Beispiele für sinnlose Experimente und mögliche Alternativen beleuchtet werden. Das zweite Kapitel befasst sich mit den so genannten „Nutztieren“, insbesondere mit der Massentierhaltung, Tiertransporten und der Nutzung von Tieren in Zirkussen. Das dritte Kapitel thematisiert den Walfang und dessen Auswirkungen auf die bedrohte Tierart der Wale.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Ausarbeitung befasst sich mit den Themen Tierversuche, Massentierhaltung, Tiertransporte, Zirkustiere, Walfang, ethische Aspekte der Mensch-Tier-Beziehung, Tierschutz, rechtliche Grundlagen, Alternativen zu Tierversuchen.
Häufig gestellte Fragen
Welche rechtlichen Grundlagen gelten für Tierversuche in Deutschland?
Tierversuche sind durch das Tierschutzgesetz geregelt, wobei ethische Abwägungen und die Suche nach Alternativen gesetzlich vorgeschrieben sind.
Gibt es Alternativen zu Tierexperimenten?
Ja, dazu gehören Computersimulationen, In-vitro-Verfahren mit Zellkulturen und mikrofluidische Organ-on-a-Chip-Systeme.
Was sind die Hauptprobleme der Massentierhaltung?
Zu den Problemen zählen Platzmangel, unnatürliche Haltungsbedingungen, Qualzuchten und die Belastung durch Tiertransporte über lange Strecken.
Warum leiden Tiere in Zirkussen besonders?
Zirkustiere leiden unter ständigen Transporten, engen Käfigen und Dressurmethoden, die oft nicht ihren natürlichen Bedürfnissen entsprechen.
Warum sind Wale trotz Schutzmaßnahmen weiterhin bedroht?
Wale sind durch kommerziellen Walfang, Meeresverschmutzung, Lärmbelastung und Beifang in Fischernetzen gefährdet.
- Quote paper
- Holger Müller (Author), 2010, Wenn der Mensch zur Bestie wird... - Gewalt gegenüber Tieren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167886