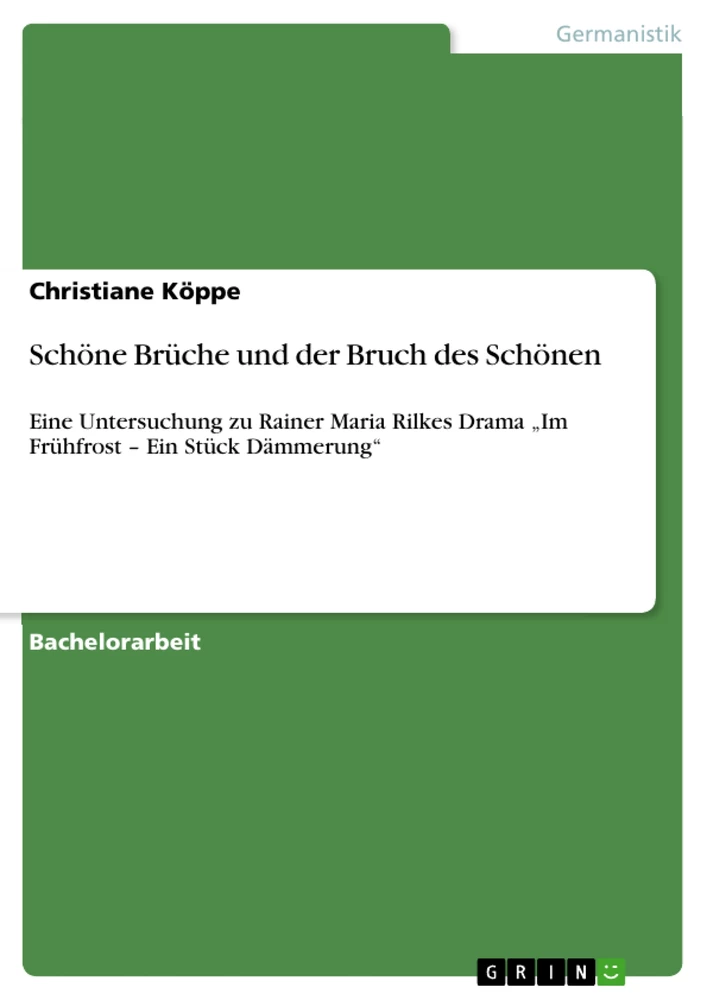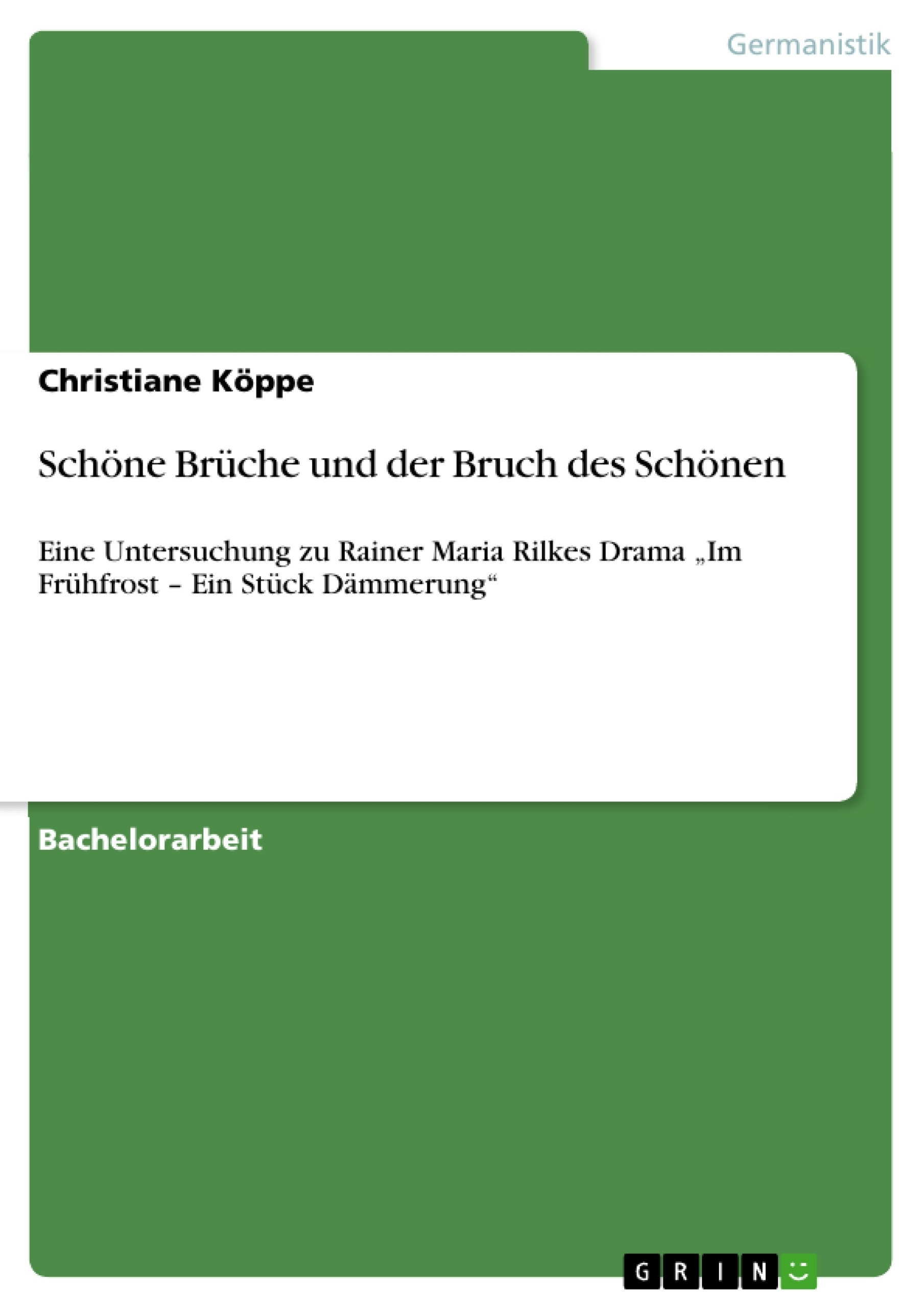Im September 1895 schreibt Rilke den Frühfrost, überarbeitet ihn ein Jahr darauf vollständig, bevor er 1897 in Prag uraufgeführt wird, zu einer Zeit, in der Rilke selbst schon nicht mehr in Prag ist. Der Frühfrost in der Erstfassung von 1895 ist Thema dieser Arbeit. Er soll auf darin enthaltene Brüche untersucht werden. Als Bruch ist dabei all das zu verstehen, was die Textkohärenz infrage stellt, sozusagen die Brüche, die die Inkompatibilität des Textes ausmachen. Das können Brüche zwischen Gesagtem und Gemeintem sein, Brüche zwischen der Darstellung eines Sachverhaltes und der tatsächlichen Begebenheit sowie Brüche, die sich in ganzen Repliken einer Figur durch ihre Semantik und/oder Syntax äußern. Ferner wird auch die Metapher des Bildes „Bruch“ untersucht. Eine Illustration also, die ein bisher konventionell festgelegtes Bild (in dieser Arbeit das von Gott) zerbrechen lässt. Aber auch stilistische Brüche werden thematisiert. Dazu zählt unter anderem die Frage, ob der Frühfrost wirklich naturalistisch ist, oder ob er mit eben dieser Epoche bereits bricht. Da sich Rilke an anderen Dramatikern seiner Zeit orientiert hat, wird Gerhart Hauptmanns Drama Vor Sonnenaufgang exemplarisch mit dem Frühfrost in Verbindung gesetzt, um eventuelle Brüche auf der intertextuellen Ebene herauszuarbeiten. Unter allen Brüchen konnte auf Grund des Umfangs der Arbeit nur eine spezielle Auswahl getroffen werden. Der Schwerpunkt liegt daher auf den Brüchen, die die Textkohärenz beeinflussen und auf dem metaphorischen Bruch des Bildes von Gott.
Diese Brüche herauszuarbeiten und ihre Verwendung sowie ihr Wirken auf der Ebene der Textkohärenz zu analysieren, ist Ziel dieser Arbeit. Die Analyse dieser Brüche erfolgt größtenteils textimmanent, andere Werke (Briefe und Gedichte) werden nur herangezogen, wenn dies zur Unterstützung meiner Argumentationen von Nöten ist.
Ein weiteres Ziel besteht darin, eine detailliertere Arbeit zum Frühfrost, als es bisher der Fall war, zu liefern. Beim Forschungstand weise ich auf die wenigen bisher erschienenen Untersuchungen hin. Es war mir daher ein besonderes Anliegen, den Frühfrost unter einem speziellen Aspekt, den enthaltenen Brüchen, zu betrachten und die Vielseitigkeit der Analysemöglichkeiten, auch unter Berücksichtigung der frühen Symbolik Rilkes und seiner Beeinflussung durch andere Autoren, zu verdeutlichen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- EINLEITUNG
- 1.1. Thema und Aufbau der Arbeit
- 1.2. Forschungsstand zur Dramatik Rilkes und Bruch mit dem Naturalismus
- 1.3. Methode
- SCHÖNE BRÜCHE IN TITEL, MONOLOG UND DIALOG
- 2. Frühfrost vs. Dämmerung: Die Brüche im Titel
- 2.1. Der Bruch zwischen Titel und Untertitel
- 2.2. Zum Verhältnis von Titel und Text
- 2.3. Wortbedeutung und Metaphorik
- 3. Die Konzeption Clementines als Figur
- 3.1. Das Figurenkonzept Clementines
- 3.2. Der gebrochene Monolog Clementines_
- 3.2.1.,,Gut ists so nicht.\" - Zwischen Gut und Böse.
- 3.2.2. Logische Brüche
- 4.,,Ganz zu Ihren Diensten\" - Zur Problematik des Dienens.
- EXKURS: GERHART HAUPTMANNS „VOR SONNENAUFGANG“..
- DER BRUCH DES „GÖTTLICH-SCHÖNEN”
- 5. Vorbetrachtung: Der Schönheits- und Gottesbegriff bei Rilke
- 6. Symbolik und Verkörperung Gottes...
- 6.1. Das Wirken Gottes als „Baum“ in der Figur Dr. Friedrich Bauer
- 6.2. Der „,göttliche“ Merzen, der „heilige“ Girding und der Turm
- 7. „Der liebe Herrgott!“ – Der unmoralische Gott
- 7.1. Gott und sein Orgelspiel
- 7.2. Gott, die Prostitution und die Ungerechtigkeit
- 8. SCHLUSS
- 9. Literatur- und Quellenverzeichnis
- Die Brüche im Titel „Im Frühfrost - Ein Stück Dämmerung“
- Die Konzeption der Figur Clementine und ihr gebrochener Monolog
- Die Problematik des Dienens in der Beziehung zwischen den Figuren
- Die Dekonstruktion des „göttlich-schönen“ Begriffs in Rilkes Werk
- Die stilistischen Brüche und ihre Bedeutung im Kontext der naturalistischen Dramatik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit analysiert Rainer Maria Rilkes Drama „Im Frühfrost - Ein Stück Dämmerung“ und untersucht die darin enthaltenen Brüche, die die Textkohärenz in Frage stellen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Brüche in Titel, Monolog und Dialog sowie auf die Frage, ob das Drama wirklich naturalistisch ist oder bereits mit dieser Epoche bricht.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt das Thema und den Aufbau der Arbeit vor und skizziert den Forschungsstand zur Dramatik Rilkes und zum Bruch mit dem Naturalismus. Des Weiteren wird die Methode erläutert, die in der Arbeit angewandt wird.
Kapitel 2 analysiert die Brüche im Titel „Im Frühfrost - Ein Stück Dämmerung“ und betrachtet das Verhältnis von Titel und Text, die Wortbedeutung und die Metaphorik des Titels.
Kapitel 3 widmet sich der Konzeption Clementines als Figur und untersucht ihren gebrochenen Monolog, der sich durch logische Brüche und einen Widerspruch zwischen Gut und Böse auszeichnet.
Kapitel 4 beleuchtet die Problematik des Dienens in der Beziehung zwischen den Figuren und analysiert die Bedeutung dieser Thematik im Kontext der Handlung.
Kapitel 5 untersucht den Schönheits- und Gottesbegriff bei Rilke, um den Hintergrund für die Analyse der Brüche im „göttlich-schönen“ zu schaffen.
Kapitel 6 analysiert die Symbolik und Verkörperung Gottes in der Figur Dr. Friedrich Bauer sowie in anderen Figuren und Symbolen des Dramas.
Kapitel 7 beschäftigt sich mit der Frage, ob Gott in Rilkes Drama als unmoralisch dargestellt wird, und untersucht die Ambivalenz der Gottesfigur in Bezug auf das Orgelspiel, die Prostitution und die Ungerechtigkeit.
Schlüsselwörter (Keywords)
Rainer Maria Rilke, „Im Frühfrost - Ein Stück Dämmerung“, Dramatik, Naturalismus, Brüche, Textkohärenz, Clementine, Monolog, Dialog, Gottesbegriff, Schönheitsbegriff, Symbolik, Unmoral.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Rilkes Drama „Im Frühfrost“?
Die Arbeit untersucht Rilkes Frühwerk auf textuelle Brüche, die die Kohärenz infrage stellen und den Übergang vom Naturalismus zum Symbolismus markieren.
Was versteht die Autorin unter einem „Bruch“ im Text?
Brüche sind Inkompatibilitäten zwischen Gesagtem und Gemeintem, logische Fehler in Monologen oder stilistische Abweichungen von der Epoche.
Wie wird das Gottesbild in Rilkes Werk dekonstruiert?
Die Arbeit analysiert den metaphorischen Bruch des traditionellen Gottesbildes, wobei Gott teils als unmoralisch oder in ambivalenten Symbolen dargestellt wird.
Ist „Im Frühfrost“ ein naturalistisches Drama?
Die Arbeit hinterfragt dies und zeigt auf, dass Rilke bereits mit den Konventionen des Naturalismus bricht und eigene symbolistische Wege geht.
Welche Rolle spielt die Figur Clementine?
Clementine wird als Figur mit einem „gebrochenen Monolog“ analysiert, der Widersprüche zwischen Gut und Böse offenbart.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Christiane Köppe (Author), 2008, Schöne Brüche und der Bruch des Schönen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167902