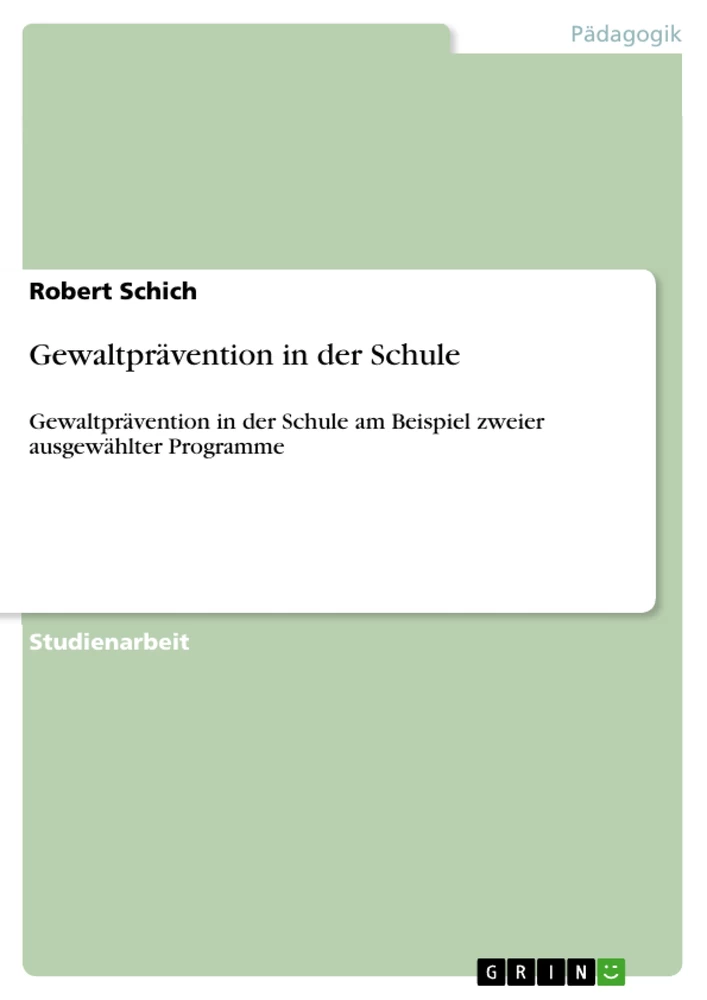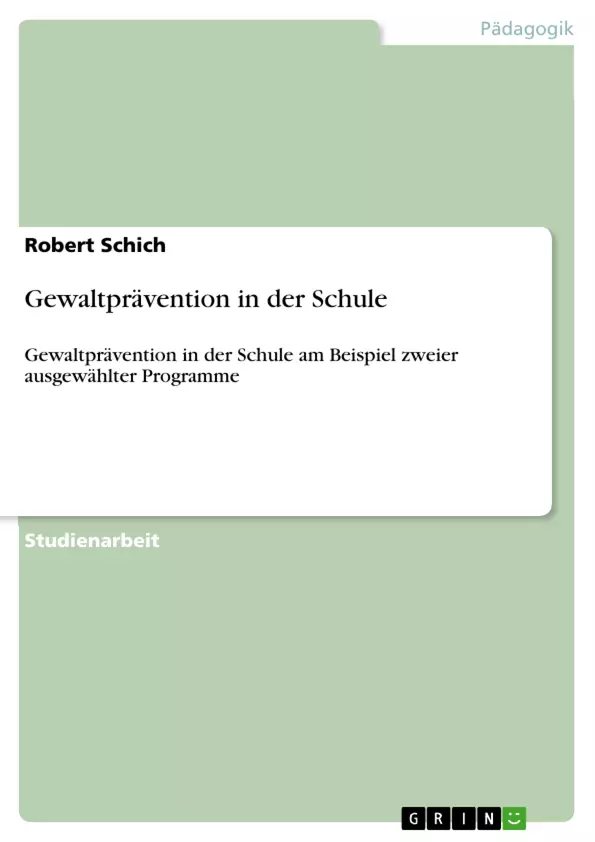Präventionsmöglich- und -schwierigkeiten. zusammengefasst und anhand zweier ausgewählter Beispiele illustriert.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- I. Einführung in die Thematik – Klärung des Gewaltbegriffs.
- II. Gewalt an Schulen - Mobbing
- III. Prävention und Intervention - Terminologie
- III.I. Primäre, sekundäre und tertiäre Prävention
- III.II Universelle, selektive und indizierte Prävention
- IV. Ansätze unterschiedlicher Gewaltprävention.
- IV.I ,,Streitschlichter“: Mediation an Schulen
- IV.II Projekte zum Anti-Aggressivitätstraining und Coolnesstraining
- V. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Ziel dieser Hausarbeit ist es, Präventions- und Interventionsmaßnahmen im Bereich der Gewalt an Schulen zu untersuchen und zu erläutern. Der Fokus liegt dabei auf Mediation, Anti-Aggressivitätstraining und Coolnesstraining sowie dem Programm „Fit for Life“. Die Arbeit soll verschiedene Terminologien klären, Beispiele geben und Hintergründe beleuchten.
- Der Gewaltbegriff und seine Vielschichtigkeit
- Die Besonderheiten von Gewalt in der Schule, insbesondere Mobbing
- Verschiedene Ansätze zur Prävention und Intervention
- Spezielle Methoden wie Mediation, Anti-Aggressivitätstraining und Coolnesstraining
- Das Programm „Fit for Life“
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
I. Einführung in die Thematik – Klärung des Gewaltbegriffs. Dieses Kapitel befasst sich mit der Problematik von Gewalt im schulischen Kontext und versucht, den komplexen Gewaltbegriff zu definieren. Es werden verschiedene Ansätze zur Definition von Gewalt vorgestellt und deren Grenzen aufgezeigt.
II. Gewalt an Schulen - Mobbing Dieses Kapitel thematisiert Mobbing als eine besondere Form der Gewalt an Schulen. Es beleuchtet verschiedene Definitionen von Mobbing und analysiert die Merkmale, die diese Form der Gewalt kennzeichnen.
III. Prävention und Intervention - Terminologie Dieses Kapitel befasst sich mit unterschiedlichen Präventions- und Interventionsformen im Kontext von Gewalt an Schulen. Es werden verschiedene Kategorien und Ansätze im Bereich der Prävention und Intervention erläutert und definiert.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der Gewaltprävention an Schulen, insbesondere mit den Formen des Mobbings und den vielseitigen Ansätzen zur Intervention und Prävention. Besondere Schwerpunkte sind die Methoden der Mediation, des Anti-Aggressivitätstrainings und des Coolnesstrainings sowie die Rolle des Programms „Fit for Life“.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen primärer und sekundärer Prävention?
Primäre Prävention richtet sich an alle Schüler, um Gewalt vorzubeugen, während sekundäre Prävention gezielt Risikogruppen anspricht.
Wie funktioniert Mediation an Schulen?
Bei der Mediation (z. B. durch Streitschlichter) helfen neutrale Dritte den Konfliktparteien, eine eigenständige und friedliche Lösung zu finden.
Was sind Anti-Aggressivitätstrainings (AAT)?
Dies sind gezielte Interventionen für bereits gewaltauffällige Jugendliche, um deren Aggressionspotenzial abzubauen und alternative Verhaltensweisen zu erlernen.
Welche Rolle spielt Mobbing in der Schule?
Die Arbeit definiert Mobbing als spezifische Form von Gewalt und analysiert dessen Merkmale sowie die notwendigen Interventionsstrategien.
Was beinhaltet das Programm „Fit for Life“?
Es ist ein strukturiertes Training zur Förderung sozialer Kompetenzen bei Jugendlichen, um deren Resilienz und Konfliktfähigkeit zu stärken.
- Citation du texte
- Robert Schich (Auteur), 2010, Gewaltprävention in der Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167924