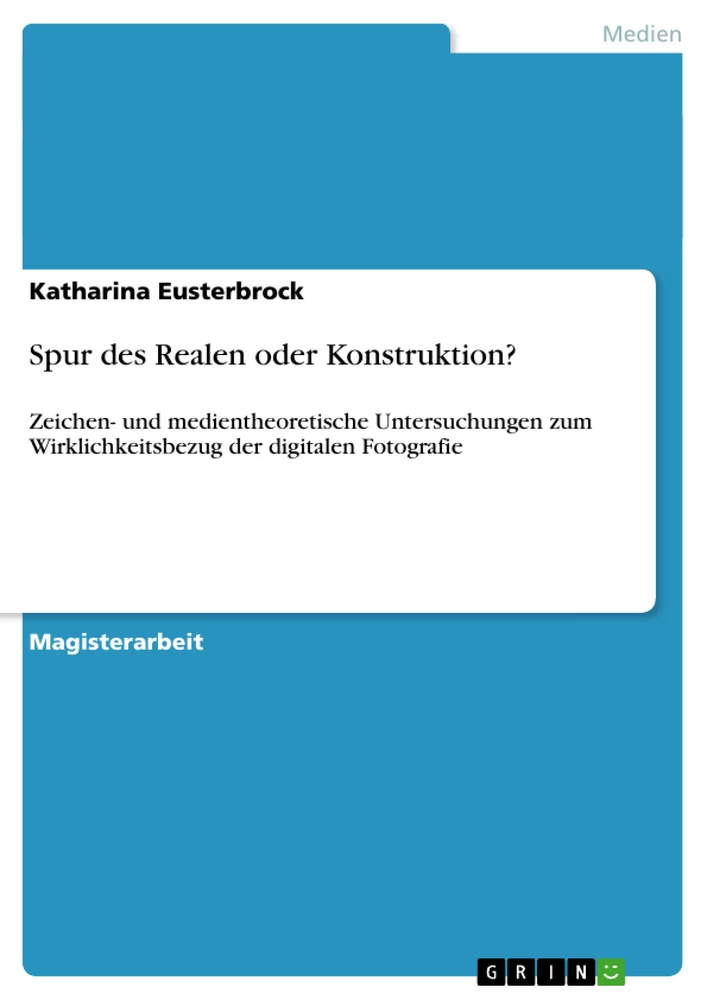Der Einzug des Digitalen gilt als eine Zäsur in der Mediengeschichte. Einer verbreiteten Auffassung zufolge verwischen die Neuen Medien zunehmend die Differenz zwischen Wirklichkeit und Simulation, zwischen Realität und Fiktion. Von einer Krise der Repräsentation ist die Rede. Eine Vorreiterrolle scheint dabei die grenzenlos manipulierbare digitale Fotografie zu spielen, vermutlich weil ihrer Vorgängerin – der analogen Fotografie – bisher ein besonderer Wirklichkeitsbezug eigen zu sein schien, der nun – so die Argumentation – durch die neuen Möglichkeiten der digitalen Bildbearbeitung und Bildproduktion unwiederbringlich zerstört wird. Aber ist das so? In der vorliegenden Arbeit wird exemplarisch am ‚neuen‘ Medium der digitalen Fotografie untersucht, ob und wie sich ihr Bezug zum Realen im Vergleich zu ihrem analogen Gegenstück verändert hat. Darüber hinaus soll deutlich gemacht werden, dass das, was sich theoretisch über das Phänomen der Fotografie sagen lässt, auch für allgemeine medientheoretische Fragen nutzbar gemacht werden kann. Eine solche Frage wäre etwa, ob der Wirklichkeitsbezug von Medien einfach anhand der Unterscheidung analog/digital bestimmt werden kann.
Betrachtet man die digitale Fotografie im Vergleich zu ihrer analogen Vorgängerin, so besteht eine der wesentlichen Veränderungen in der nahtlosen Eingliederung der Fotografie in den digitalen Medienverbund, was zu einem Verlust ihrer strukturellen Eigenständigkeit geführt hat. Der Auffassung, dieser Identitätsverlust führe zu einem Ende der fotografischen Evidenz und damit zum Ende der Fotografie überhaupt, wird im Rahmen dieser Arbeit widersprochen, indem verschiedene Theorien herangezogen werden, die die Bedeutung von Zeichen von ihren Funktionen und Verwendungsweisen und nicht von ihrem ontologischen Status abhängig machen. Anhand von anti-repräsentationalistisch ausgerichteten medientheoretischen Ansätzen wie der Remediatisierungsthese von Bolter und Grusin und insbesondere der Transkriptivitätstheorie von Ludwig Jäger soll gezeigt werden, dass kulturelle Semantiken letztlich durch die komplexen Verfahren entstehen, mit denen Zeichen und Medien wechselseitig aufeinander Bezug nehmen. Darüber hinaus beleuchtet die Arbeit das Wechselverhältnis zwischen dem fotografischen Spurenparadigma und der Wissenschaftsgeschichte des 19. Jahrhunderts und berücksichtigt auch die diskursanalytische Theorietradition.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- 1 Ausgangspunkt und theoretischer Rahmen
- 2 Analog und digital – ein Gegensatz?
- 2.1 Analog und digital aus systemtheoretischer Perspektive
- 2.2 Analog und digital aus symboltheoretischer Perspektive
- 3 Einblicke in die Theoriegeschichte der analogen Fotografie
- 3.1 Die Fotografie als Spur des Realen
- 3.2 Die Fotografie als soziales Konstrukt
- 3.3 Die Fotografie in den Reflexionen von Roland Barthes
- 4 Die analoge Fotografie als indexikalisch-ikonisches Zeichen
- 4.1 Das triadische Zeichenmodell von Peirce
- 4.2 Ikon, Index und Symbol
- 4.3 Der fotografische Index
- 4.3.1 Kategorisierungen von Indices
- 4.3.2 Das Zusammenwirken mit den anderen Modi der Objektrelation
- 4.3.3 Die Bedeutung der Sprache für die Indexrelation
- 4.3.4 Die diskursanalytische Dekonstruktion der Objektrelation
- 4.4 Die Faktoren der fotografischen Bedeutungskonstitution
- 4.5 Das Problem der fotografischen Evidenz
- 5 Der Wirklichkeitsbezug der digitalen Fotografie
- 5.1 Das Verhältnis der digitalen zur analogen Fotografie
- 5.1.1 Unterschiede in der Struktur
- 5.1.2 Unterschiede im Gebrauch
- 5.2 Das Verhältnis von digitalen zu analogen Medien
- 5.2.1 Remediation: Die Logik von Unmittelbarkeit und Hypermedialität
- 5.2.2 Störung und Transparenz
- 5.2.3 Die Theorie der Transkriptivität
- 5.3 Das Verhältnis von Medien zur Welt
- 6 Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit zielt darauf ab, den Wirklichkeitsbezug der digitalen Fotografie im Vergleich zur analogen Fotografie zu untersuchen. Sie will herausfinden, ob und wie sich der Bezug zum Realen im Kontext der digitalen Bildproduktion verändert hat. Weiterhin soll die Arbeit die medientheoretische Relevanz der Erkenntnisse über die Fotografie für allgemeinere medientheoretische Fragestellungen verdeutlichen.
- Die Bedeutung des Begriffspaares "Analog/Digital" und seine implizierten Gegensatzpaare
- Die Analyse des Wirklichkeitsanspruchs der analogen Fotografie anhand verschiedener fototheoretischer Positionen
- Die Rolle des "Index" in der Zeichentheorie von Charles Sanders Peirce und seine Bedeutung für die Analyse der fotografischen Bedeutungskonstitution
- Die Remediatisierungsthese und die Theorie der Transkriptivität als medientheoretische Ansätze zur Analyse der digitalen Fotografie
- Die Frage nach dem Ende der fotografischen Evidenz im Kontext der digitalen Bildbearbeitung
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt den Ausgangspunkt der Untersuchung dar. Sie beleuchtet die gängige Vorstellung von einer Krise der Repräsentation, die durch den Einzug des Digitalen in die Medienlandschaft entstanden sei, und setzt sich mit dem besonderen Wirklichkeitsbezug der analogen Fotografie auseinander. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage der Arbeit: Wie verändert sich der Bezug zum Realen im Vergleich zur analogen Fotografie im Kontext der digitalen Bildproduktion?
Kapitel 1 legt den theoretischen Rahmen der Arbeit fest. Es werden grundlegende Annahmen über die Fotografie als Zeichen und Medium formuliert. Außerdem wird der Begriff "Analog/Digital" aus systemtheoretischer und symboltheoretischer Perspektive beleuchtet.
Kapitel 2 untersucht die Theoriegeschichte der analogen Fotografie. Es werden verschiedene fototheoretische Positionen vorgestellt, die sich mit dem Wirklichkeitsanspruch der Fotografie auseinandersetzen, unter anderem die Theorien von Roland Barthes, sowie die Rolle der Fotografie als Spur des Realen und als soziales Konstrukt.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Zeichentheorie von Charles Sanders Peirce, insbesondere mit der Rolle des Index. Es werden verschiedene Kategorisierungen von Indices und die Bedeutung der Indexrelation für die fotografische Bedeutungskonstitution diskutiert.
Kapitel 4 widmet sich dem Wirklichkeitsbezug der digitalen Fotografie und stellt die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zur analogen Fotografie heraus. Die Arbeit untersucht die Auswirkungen der nahtlosen Integration der Fotografie in den digitalen Medienverbund und die Frage, ob diese Integration zu einem Verlust der fotografischen Evidenz führt.
Kapitel 5 untersucht verschiedene medientheoretische Ansätze wie die Remediatisierungsthese und die Transkriptivitätstheorie, um die Frage nach dem Ende der fotografischen Evidenz im Kontext der digitalen Bildbearbeitung zu beleuchten.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Wirklichkeitsbezug der digitalen Fotografie im Vergleich zur analogen Fotografie. Die zentralen Themen sind die Medien/Form-Unterscheidung, die Analog/Digital-Unterscheidung, der fotografische Index, die Zeichentheorie von Charles Sanders Peirce, die Remediatisierungstheorie, die Transkriptivitätstheorie und die Frage nach der fotografischen Evidenz.
- Citar trabajo
- Katharina Eusterbrock (Autor), 2010, Spur des Realen oder Konstruktion?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167928