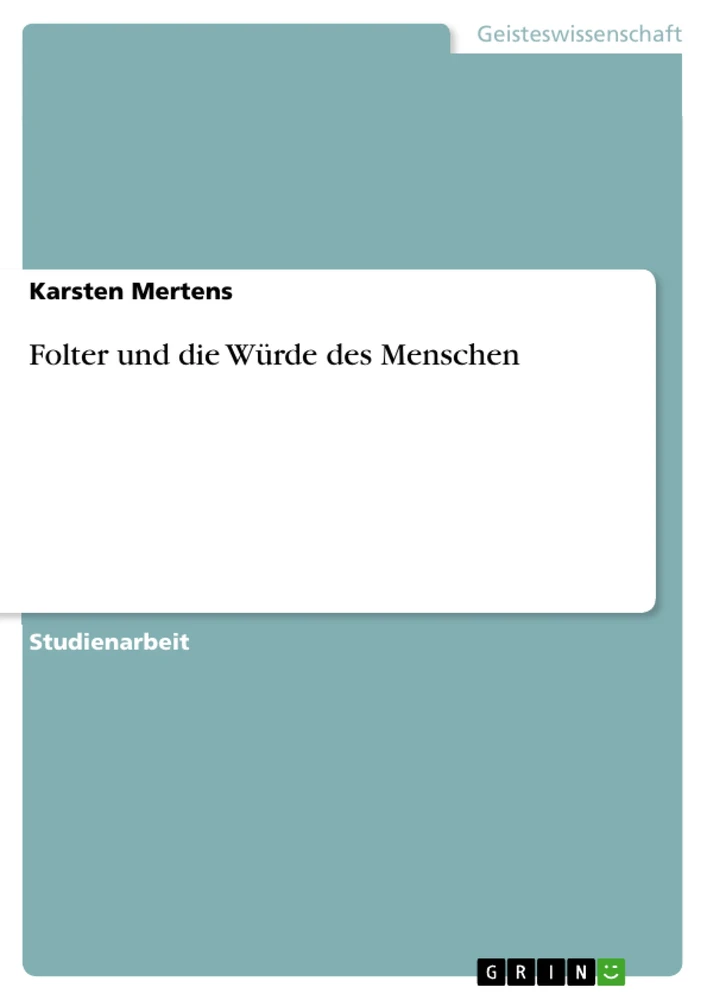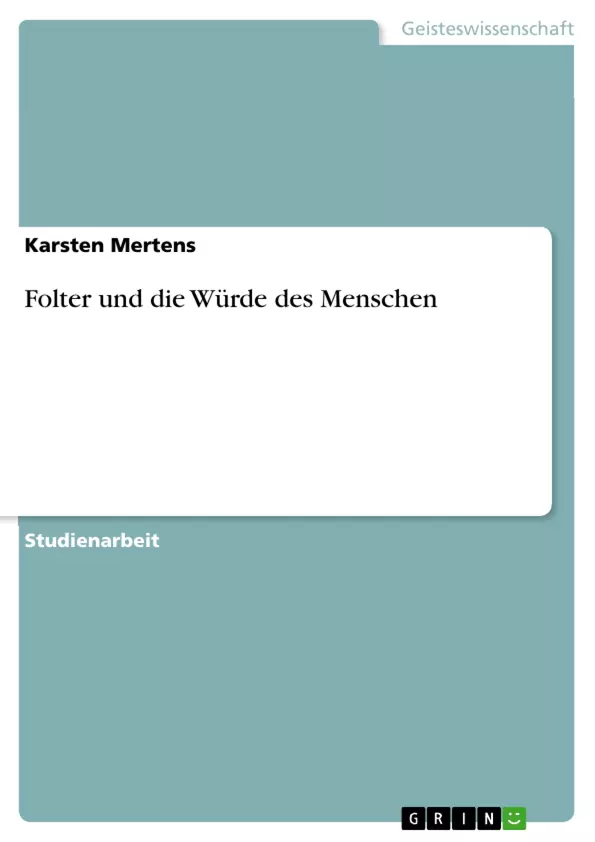Folter war eine lange Zeit kein Thema in der deutschen Öffentlichkeit, obwohl auf der Welt vor allem in Afrika, Lateinamerika und Asien es immer wieder zu Folterungen kommt. Doch sind diese Fälle für die deutsche Presse und die Gesellschaft anscheinend zu unbedeutend. Erst durch Ereignisse wie Abu Ghraib, die Protestaktionen 2008 in Tibet oder den Fall Daschner rückte das Thema der Folter wieder in den Mittelpunkt des öffentlich-politischen Interesses. Im Rahmen dieser Hausarbeit soll sich mit dem Thema der Folter auseinandergesetzt werden. Dabei wird zu Beginn der Fall Daschner, der in Deutschland für eine breite Diskussion in Politik, Wissenschaft und der Öffentlichkeit gesorgt hat, als Aufhänger für diese Arbeit genutzt werden. Um das Leben eines entführten Kindes zu retten, hatte sich der Frankfurter Polizei-Vizepräsident dazu entschieden, dem Entführer mit Anwendung von Gewalt drohen zu lassen. Diese Folterandrohung, die Würde eines Menschen zu verletzten, um das Leben eines anderen Menschen zu retten, führte zu der Diskussion, ob es in bestimmten Notfällen nicht erlaubt sein sollte, von dem rechtsstaatlichen Handeln abzuweichen und durch die „Rettungsfolter“ Menschenleben zu retten.
Folter und Rettungsfolter bilden einen sehr weiten Themenbereich. In dieser Arbeit soll es vor allem darum gehen, die Diskussion der „Rettungsfolter“ in Deutschland zu untersuchen, ob sie mit den heutigen nationalen, wie internationalen Rechten in Einklang zu bringen wäre und ob sie auch moralisch vertretbar ist. Der zweite Teil der Arbeit wird sich mit der Folter an sich beschäftigen. Was gibt es für Methoden um zu foltern? Welche Folgen haben Folterungen und wie kann den Geschädigten geholfen werden. Und was ist mit der Wahrheit über Folter und der Versöhnung von Gefolterten und Folterern?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Thema, Fragestellung und Eingrenzung
- Quellenlage und Forschungsstand
- Der Fall Daschner
- Folter damals wie heute
- Historischer Abriss zum Phänomen der Folter
- Folter
- Diskussionen zur Folter in Deutschland
- Das grundgesetzliche Folterverbot und der Menschenwürdegehalt der Grundrechte
- „Krieg gegen den Terror“
- Zur Not ein bisschen Folter - „Rettungsfolter“?
- Die Qualen der Opfer
- Die Methoden
- Folgen von Folter
- Hilfe für Opfer
- Folter, Wahrheit und Versöhnung
- Schluss: Zusammenfassende Betrachtung der Arbeit „Folter und die Würde des Menschen“
- Literatur- und Internetverzeichnis
- Literaturverzeichnis
- Internetquellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die komplexe Thematik der Folter und ihre Beziehung zur Menschenwürde im Kontext des deutschen Rechts und internationalen Menschenrechtsstandards. Besondere Aufmerksamkeit wird auf die Debatte um „Rettungsfolter“ gelegt, die im Falle Daschner in Deutschland eine weitreichende Diskussion ausgelöst hat. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, ob „Rettungsfolter“ mit den geltenden nationalen und internationalen rechtlichen Normen vereinbar wäre und moralisch vertretbar ist.
- Das absolute Folterverbot im deutschen Grundgesetz und im Völkerrecht
- Die ethische und rechtliche Problematik der „Rettungsfolter“
- Die Geschichte der Folter und ihre Auswirkungen auf die Opfer
- Internationale Bemühungen um die Verhinderung und Bekämpfung von Folter
- Die Bedeutung von Wahrheit und Versöhnung im Kontext der Folter
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema Folter und die Fragestellung der Arbeit vor und skizziert die aktuelle Relevanz des Themas im Kontext von Ereignissen wie Abu Ghraib, dem Fall Daschner und den Protesten in Tibet. Der Fall Daschner wird als Ausgangspunkt genutzt, um die Debatte um „Rettungsfolter“ zu beleuchten.
Kapitel 2 beleuchtet die Methoden der Folter und ihre schwerwiegenden Folgen für die Opfer, sowohl physisch als auch psychisch. Die unterschiedlichen Hilfsangebote für Folteropfer in verschiedenen Ländern werden vorgestellt, wobei die Abhängigkeit von internationalen Hilfsorganisationen und privater Spenden hervorgehoben wird.
Kapitel 3 untersucht die Geschichte der Folter und zeigt, dass sie trotz internationaler Verträge und nationaler Gesetze, die sie eindeutig verbieten, ein weit verbreitetes Phänomen ist. Die Debatte um „Rettungsfolter“ im Kontext des „Kriegs gegen den Terror“ wird erörtert und kritisch hinterfragt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Arbeit umfassen Folter, Menschenwürde, Rettungsfolter, Grundgesetz, Völkerrecht, Menschenrechte, Wahrheit, Versöhnung, Opfer, Methoden, Folgen, Hilfe, Internationale Zusammenarbeit, Geschichte, Kontroversen.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Begriff „Rettungsfolter“?
Damit ist die Androhung oder Anwendung von Gewalt gemeint, um Informationen zu erzwingen, die unmittelbar dazu dienen, das Leben eines anderen Menschen zu retten.
Welche Bedeutung hat der Fall Daschner für die Folterdebatte in Deutschland?
Der Fall löste eine breite Diskussion aus, da ein Polizeivizepräsident einem Entführer Gewalt androhen ließ, um ein entführtes Kind zu finden, was die Frage nach der Unantastbarkeit der Menschenwürde neu aufwarf.
Ist Rettungsfolter mit dem deutschen Grundgesetz vereinbar?
Die Arbeit untersucht, ob das absolute Folterverbot und der Menschenwürdegehalt der Grundrechte Ausnahmen in extremen Notfällen zulassen oder kategorisch ausschließen.
Welche Folgen hat Folter für die Opfer?
Folteropfer leiden unter schwerwiegenden physischen und psychischen Langzeitfolgen. Die Arbeit beleuchtet zudem die Schwierigkeiten bei der Versöhnung von Opfern und Tätern.
Wie ist Folter völkerrechtlich geregelt?
International gibt es ein absolutes Folterverbot, das in verschiedenen Menschenrechtskonventionen verankert ist und keine Rechtfertigung für Folter zulässt.
Welche Hilfsangebote gibt es für Folteropfer?
Es existieren spezialisierte Hilfsorganisationen, die medizinische und psychologische Unterstützung anbieten, oft jedoch stark von privaten Spenden und internationaler Hilfe abhängig sind.
- Quote paper
- MAGISTER ARTIUM Karsten Mertens (Author), 2008, Folter und die Würde des Menschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167933