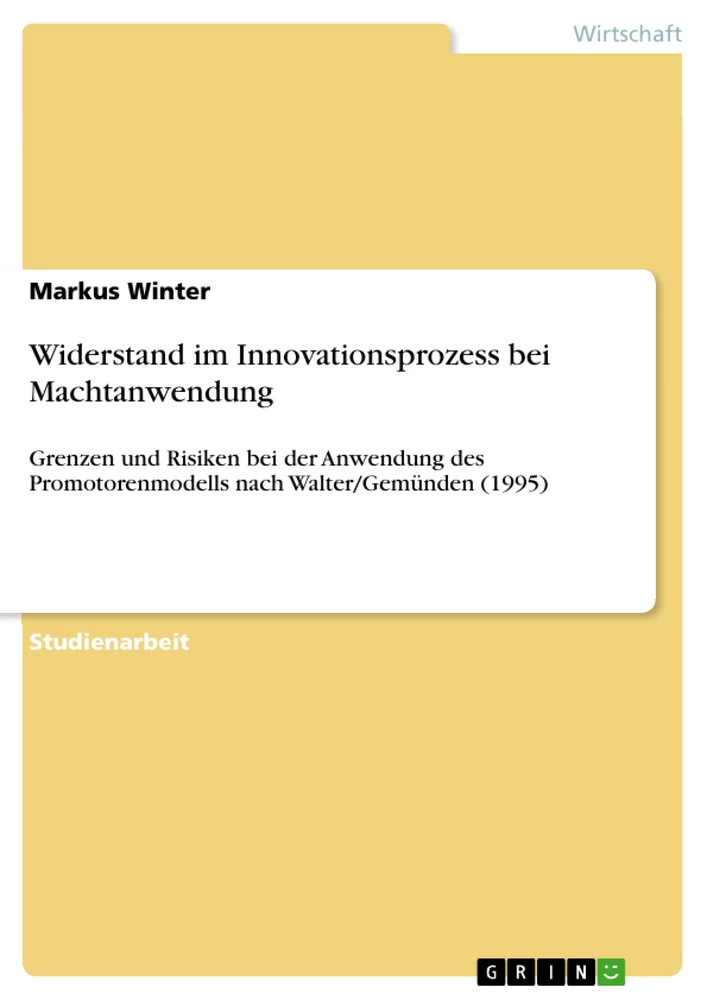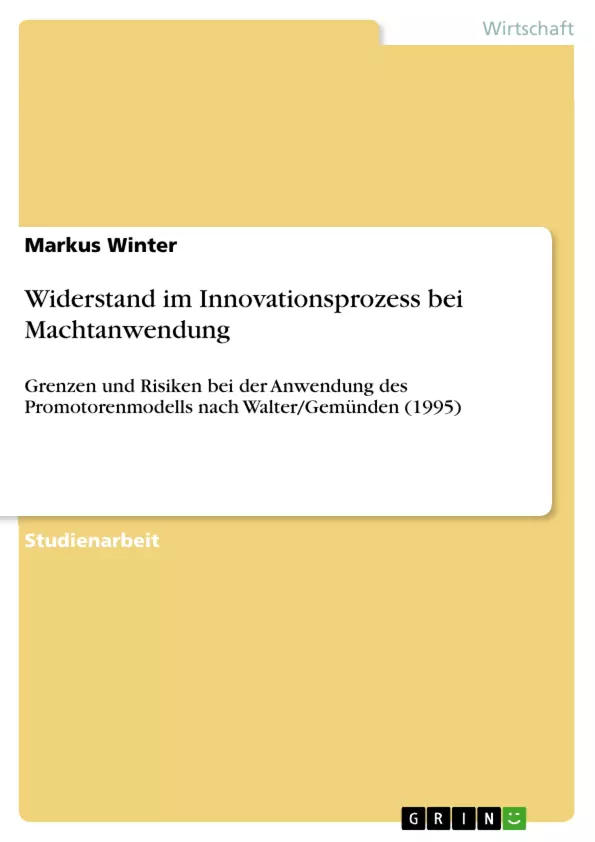Der Begriff „Innovation“ kommt sehr oft in aktuellen Debatten zur Anwendung. Unternehmen wollen innovative Produkte vor der Konkurrenz auf den Markt bringen. Dies erzeugt auf die Organisation einen enormen Wettbewerbsdruck.
Innovationen sind etwas „Neuartiges“ nicht nur dem Grade nach (Hamel 1996: 323ff.). Um etwas wirklich Neuartiges herzustellen, bedarf es Anstrengung und es müssen bisher nicht dagewesene Wege beschritten werden.
Der Innovationsprozess ist von destruktiver Art und Weise. Er stellt das bisherige Herrschaftswissen in Frage, zerstört etablierte Beziehungen und regt zum Überdenken bisheriger Verhaltensweisen an. Andererseits wird an die Stelle des Alten schöpferisch und konstruktiv etwas Neues gesetzt (Hauschildt/Salomo 2007: 11). Diese Veränderungen haben intra- und interorganisationale Auswirkungen, die Widerstand gegen die Veränderung hervorrufen können. Frost und Egri bezeichnen Individuen als personifizierten Widerstand im Innovationsprozess, der als Konflikt zwischen Wandel und Status Quo angesehen werden kann (Frost/Egri 1991: 271).
Für die Interaktion aller am Innovationsprozess Beteiligten ist es wichtig, dass diese zielführend im Bezug auf den Innovationserfolg gerichtet ist und in gegenseitiger Achtung verläuft. Dies ist aus organisationaler wie gesellschaftlicher Sicht wünschenswert und unterstreicht in diesem Zusammenhang die Relevanz des Themas.
1.1 Problemstellung
Im Folgenden soll als Forschungsfrage untersucht werden:
Ist es zweckmäßig Widerstand von am Innovationsprozess direkt Beteiligten mit der Inanspruchnahme von Macht bzw. Promotoren zu überwinden oder können durch den Machteinsatz Innovationen in ihrer Entstehung behindert werden bzw. den Innovationsprozess gefährdende Folgen auftreten? An dieser Stelle wird vordergründig Widerstand der Akteure im Innovationsprozess gegen eine Machteinwirkung untersucht. Welche Folgen hat der Machteinsatz für die Betroffenen und welche Konsequenzen ergeben sich für die Anwendung des Promotorenmodells? Bezugsrahmen sind Organisationen, die Prozessinnovationen
hervorbringen. Ausführlicher werde ich zum Begriff der Innovation bzw. der Prozessinnovation im Punkt 2.1 kommen.
1.2 Methodisches Vorgehen
Gegenstand der Arbeit ist eine Betrachtung des Widerstandes im Rahmen des Innovationsmanagements, insbesondere die Auswirkungen von Machteinsatz bei der Anwendung des Promotorenmodells.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Methodisches Vorgehen
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Der Innovationsbegriff
- 2.2 Begriffsbestimmung des Innovationsmanagements
- 2.3 Der Machtbegriff
- 2.3.1 Macht und Gegenmacht
- 2.3.2 Ungewissheitsquellen nach Crozier/Friedberg
- 2.4 Einflussnahme als Abgrenzung zur Machtanwendung
- 2.5 Widerstände gegen Innovationen
- 2.6 Das Promotorenmodell nach Walter/Gemünden
- 2.7 Der Machtpromotor
- 2.8 Der Prozesspromotor
- 2.9 Der Beziehungspromotor
- 2.10 Der Fachpromotor
- 3. Grenzen und Risiken des Promotorenmodells
- 3.1 Folgen von Machteinsatz für den Innovationsprozess
- 3.2 Auswirkung von Einflussnahme auf den Innovationsprozess
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit untersucht die Problematik von Widerstand im Innovationsprozess und analysiert die Auswirkungen von Machtanwendung im Kontext des Promotorenmodells nach Walter/Gemünden (1995).
- Analyse des Widerstandes gegen Innovationen und dessen Ursachen
- Bedeutung des Machtbegriffs und Abgrenzung zur Einflussnahme
- Bewertung des Promotorenmodells als Instrument zur Bewältigung von Widerständen
- Auswirkungen von Machtanwendung auf den Innovationsprozess und die beteiligten Akteure
- Grenzen und Risiken des Promotorenmodells im Hinblick auf die Effektivität und Nachhaltigkeit von Innovationen
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt die Problemstellung dar, die im Zentrum der Arbeit steht: Die Untersuchung der Zweckmäßigkeit von Machtanwendung zur Überwindung von Widerstand im Innovationsprozess. Das methodische Vorgehen wird skizziert, wobei die Arbeit auf einer theoretischen Grundlage basiert und die Folgen von Machtausübung und Einflussnahme auf den Innovationsprozess beleuchtet.
Im Kapitel 2 werden die theoretischen Grundlagen erörtert, die für das Verständnis des Widerstandes im Innovationsprozess von Bedeutung sind. Es werden der Innovationsbegriff, das Innovationsmanagement, der Machtbegriff und die verschiedenen Arten von Promotoren im Promotorenmodell nach Walter/Gemünden (1995) definiert und erläutert.
Das Kapitel 3 widmet sich der Analyse der Grenzen und Risiken des Promotorenmodells. Die Folgen von Machteinsatz und die Auswirkungen von Einflussnahme auf den Innovationsprozess werden untersucht, um die potenziellen negativen Folgen der Anwendung des Modells zu beleuchten.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit konzentriert sich auf das Thema Widerstand im Innovationsprozess, insbesondere im Kontext der Anwendung des Promotorenmodells. Die zentralen Begriffe sind: Innovation, Prozessinnovation, Widerstand, Machtanwendung, Einflussnahme, Promotorenmodell, Machtpromotor, Prozesspromotor, Beziehungspromotor, Fachpromotor, Grenzen, Risiken, Folgen.
Häufig gestellte Fragen
Warum entsteht Widerstand in Innovationsprozessen?
Innovationen stellen oft etablierte Beziehungen und Herrschaftswissen in Frage. Dieser Konflikt zwischen Wandel und Status Quo wird oft als personifizierter Widerstand sichtbar.
Was untersucht die Forschungsfrage dieser Arbeit?
Sie prüft, ob der Einsatz von Macht zur Überwindung von Widerstand zweckmäßig ist oder ob Machtanwendung die Entstehung von Innovationen eher behindert.
Welches Modell zur Überwindung von Widerstand wird analysiert?
Im Zentrum steht das Promotorenmodell nach Walter/Gemünden, das verschiedene Rollen wie Macht-, Prozess-, Beziehungs- und Fachpromotoren definiert.
Was ist der Unterschied zwischen Machtanwendung und Einflussnahme?
Die Arbeit grenzt die direkte Machtausübung von subtileren Formen der Einflussnahme ab und untersucht deren jeweilige Auswirkungen auf den Innovationserfolg.
Welche Risiken birgt der Machtpromotor?
Ein übermäßiger Machteinsatz kann negative Folgen für die Betroffenen haben und den Innovationsprozess durch Demotivation oder Blockaden gefährden.
- Quote paper
- Markus Winter (Author), 2010, Widerstand im Innovationsprozess bei Machtanwendung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167936