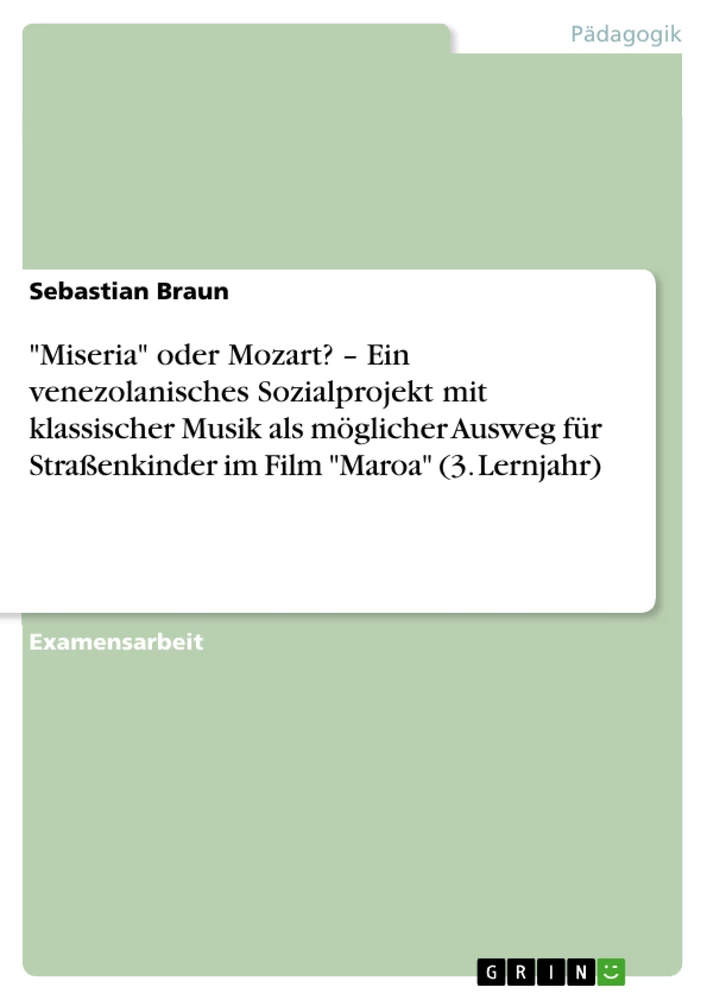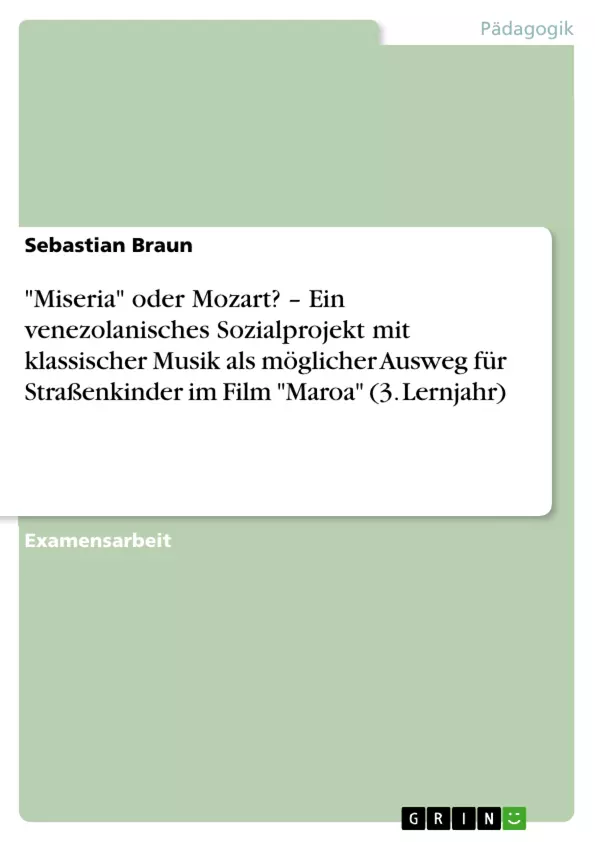1. Einleitung
Klassische Musik (Mozart) und arme Straßenkinder (miseria) scheinen auf den ersten Blick nicht miteinander vereinbar. Weniger noch in einem Land wie Venezuela, in dem es riesige Elendsviertel gibt und Gewalt und Korruption an der Tagesordnung sind. Im venezolanischen Alltagsleben spielt zudem das Hören und Erlernen klassischer Musik seit jeher eine untergeordnete Rolle und ist eher einer privilegierten und akademischen Oberschicht vorbehalten. Im täglichen Leben wird man vielmehr mit anderen Musikstilen konfrontiert. Im Bus hört beispielsweise man je nach Geschmack und Alter des Busfahrers salsa, merengue oder den für europäische Ohren etwas kitschig klingenden Musikstil vallenato aus Kolumbien. Viele Jugendliche und Erwachsene in Venezuela und anderen südamerikanischen Ländern bevorzugen heutzutage den schnellen reggaetón, eine Mischung aus Reggae, Dancehall, Hip-Hop und merengue. Der reggaetón ist heute so zum Ausdruck einer schnelllebigen Gesellschaft und verarmten Barriokultur geworden.1
Im Zuge der bolivarianischen Revolution und „Kubanisierung“ Venezuelas durch den sozialistischen Präsidenten Hugo Chávez verarmen heutzutage immer mehr Familien in diesem rohstoffreichen Land. Der wirtschaftliche und soziale Abwärtstrend des Landes Venezuela begann aber schon in den Jahrzehnten zuvor unter verschiedenen korrupten Regierungen. Um gegen die wachsende Armut anzukämpfen und vor allem Kindern aus sozial schwachen Milieus eine Chance und Lebensperspektive zu bieten, gründete Dr. José Antonio Abreu (ein bekannter venezolanischer Komponist, Musiker und Wirtschaftswissenschaftler) im Jahre 1975 ein Jugendorchester, in dem vor allem ärmere Kinder ein Instrument erlernen und Musikunterricht erteilt bekommen. Aubreu setzte sein Projekt auf politischer Ebene durch und sein sistema weitete sich seit den siebziger Jahren immer weiter auch auf entlegenere Orte Venezuelas aus.2 Das sistema mit seinen núcleos, wie die vom Staat und privaten Geldgebern subventionierten Musikschulen genannt werden, erfasst heute mehr als 350000 Kinder und Jugendliche, die zum größten Teil aus ärmsten Verhältnissen stammen. Die núcleos sind inzwischen zu einem sozialen Auffangbecken geworden und bieten den Kindern und Jugendlichen der von Gewalt und Korruption geprägten barrios einen möglichen Ausweg aus ihrer schwierigen Lebenssituation.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Theoretische Überlegungen zur Unterrichtseinheit
- Bedeutung der Landeskunde und von Filmen im Fremdsprachenunterricht
- Bezug zum Bildungsplan
- Emotionale Beteiligung am Filmgeschehen und Motivation
- Planung und Konzeption der Unterrichtseinheit
- Rahmenbedingungen und Klassensituation
- Aufbau und Inhalt
- Materialauswahl
- Auswahl der Methoden
- Arbeits- und Sozialformen
- Lernziele und Kompetenzen
- Durchführung der Unterrichtseinheit
- Übersicht über die gehaltenen Stunden
- Schematische Verlaufsübersicht und Vorstellung ausgewählter Einzelstunden
- Reflexion der Unterrichtseinheit
- Literatur- und Quellenverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit dokumentiert eine Unterrichtseinheit für die zweite Staatsprüfung für den höheren Schuldienst an Gymnasien. Im Fokus steht die Auseinandersetzung mit dem venezolanischen Sozialprojekt „El Sistema“, das Kindern aus sozial schwachen Milieus durch den Zugang zu klassischer Musik eine Perspektive eröffnet. Der Film „Maroa“ dient dabei als Grundlage für die Unterrichtsgestaltung.
- Die Bedeutung von Landeskunde und Filmen im Fremdsprachenunterricht
- Die Integration des Themas in den Bildungsplan
- Die Rolle von Emotionen und Motivation im Fremdsprachenlernen
- Die Darstellung von sozialer Ungleichheit und kulturellen Unterschieden in Venezuela
- Die Analyse von filmischen Elementen zur Förderung von Medienkompetenz
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung beleuchtet den scheinbaren Widerspruch zwischen klassischer Musik und dem Leben in venezolanischen Elendsvierteln und stellt „El Sistema“ als einen möglichen Ausweg für Straßenkinder vor. Kapitel 2 befasst sich mit theoretischen Überlegungen zur Bedeutung von Landeskunde und Filmen im Fremdsprachenunterricht. Der Bezug zum Bildungsplan und die Bedeutung von emotionaler Beteiligung am Filmgeschehen werden ebenfalls betrachtet. Kapitel 3 beinhaltet die Planung und Konzeption der Unterrichtseinheit, einschließlich der Rahmenbedingungen, des Aufbaus, der Materialien, Methoden, Arbeits- und Sozialformen sowie der Lernziele und Kompetenzen. In Kapitel 4 werden die einzelnen Unterrichtsstunden vorgestellt, wobei eine Doppelstunde und 4 Einzelstunden ausführlicher besprochen werden. Die Reflexion der gesamten Unterrichtseinheit rundet die Arbeit ab.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: El Sistema, Venezuela, Klassische Musik, Sozialprojekt, Straßenkinder, Film, Landeskunde, Fremdsprachenunterricht, Bildungsplan, Emotionen, Motivation, Medienkompetenz.
Häufig gestellte Fragen
Was ist "El Sistema" in Venezuela?
Es ist ein 1975 von José Antonio Abreu gegründetes Sozialprojekt, das Kindern aus armen Verhältnissen kostenlosen Musikunterricht und Zugang zu Jugendorchestern bietet.
Worum geht es im Film "Maroa"?
Der Film dient als Unterrichtsgrundlage und zeigt das Leben eines Straßenkindes in Venezuela, das durch die Musik einen Ausweg aus Gewalt und Armut sucht.
Warum wird klassische Musik als Sozialprojekt genutzt?
Die Musikschulen (núcleos) fungieren als soziales Auffangbecken, fördern Disziplin und Selbstwertgefühl und bieten eine Alternative zur Barriokultur und Kriminalität.
Welche Rolle spielt die Landeskunde im Fremdsprachenunterricht?
Sie hilft Schülern, kulturelle Unterschiede und soziale Realitäten in spanischsprachigen Ländern wie Venezuela besser zu verstehen und fördert die Medienkompetenz.
Welche Musikstile dominieren den Alltag in Venezuela?
Neben Salsa und Merengue sind vor allem Vallenato und der bei Jugendlichen sehr populäre Reggaetón weit verbreitet.
- Quote paper
- Sebastian Braun (Author), 2009, "Miseria" oder Mozart? – Ein venezolanisches Sozialprojekt mit klassischer Musik als möglicher Ausweg für Straßenkinder im Film "Maroa" (3. Lernjahr), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167940