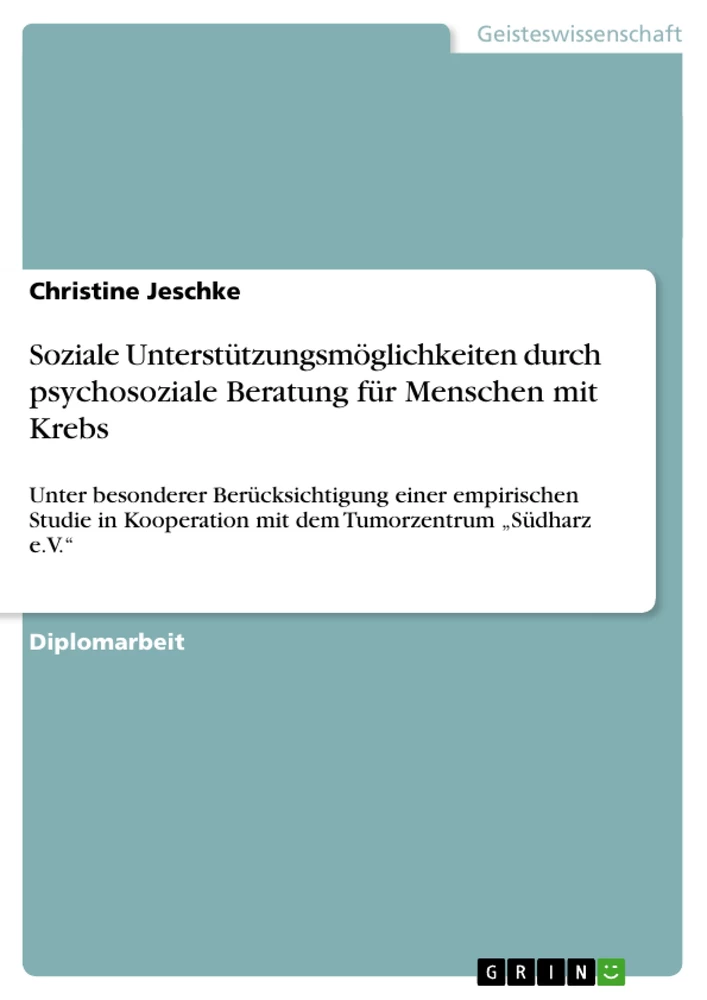Grundgedanken
[...] Was bedeutet es für einen Menschen mit der Diagnose Krebs konfrontiert zu werden? - Ein Angriff auf das Leben, den der Mensch zu selten gewinnt. Es ist eine Übernahme aller Lebensbereiche, für deren Befreiung nicht immer die Kraft reicht. Um nicht zu kapitulieren, forschen Wissenschaftler intensivst. Die Medizin ist immerwährend auf der Suche nach Antworten, um den Masterplan zu prä-sentieren. Und der Staat baut in seinem sozialen Verständnis und Engagement Brücken, setzt Wegweiser, um Betroffenen und Angehörigen zu helfen. [...]
Struktur der Arbeit
Im ersten Teil der Arbeit wird der Leser an das Thema Krebserkrankungen herangeführt. Dafür werden medizinische Grundlagen in der Entstehung von Krebs, den Ursachen und der Epidemiologie gegeben und die aktuellen Behandlungsformen zur Bekämpfung von Krebs dargelegt. Gliederungspunkt drei beschäftigt sich mit den für die Krebsentstehung relevanten Krankheitsmodellen und der Krankheitsbewältigung. In diesem Zusammenhang werden die Begriffe Gesundheit und Krankheit definiert.
Der zweite Teil der Arbeit befasst sich einleitend mit den Belastungen für Men-schen mit einer Krebserkrankung, wobei die zuvor erarbeiteten theoretischen Grundlagen der Krankheitsverarbeitung und Krankheitsbewältigung in Bezug ge-setzt werden. Im Gliederungspunkt fünf wird die Beratung als Methode in der Sozialen Arbeit vorgestellt. Im Mittelpunkt steht dabei die psychosoziale Beratung und die Anwendung dieser in der Onkologie. Anschließend werden unter-stützende Angebote innerhalb der Krebsberatung aufgezeigt und erläutert, um eine Grundlage zum besseren Verständnis der sich anschließenden empirischen Untersuchung zu schaffen.
Die Klientenbefragung zur Beratungsstelle des Tumorzentrums Südharz e.V. bildet den dritten Teil der Arbeit. Dafür wird zunächst in Punkt sieben die Einrichtung vorgestellt. Das Anliegen der Klientenbefragung und die damit verbundene Hypothesenbildung werden im Gliederungspunkt acht definiert. Der neunte Punkt beschreibt die Wahl und Entwicklung des Datenerhebungsinstrumentes, einschließlich der Ausgangssituation und Vorgehensweise für die empirische Studie. Die Auswertung der Klientenbefragung erfolgt im Gliederungspunkt zehn. Abschließend werden die aufgestellten Hypothesen gemäß ihrer Gültigkeit bewertet und diskutiert.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Medizinische Grundlagen
- 2.1 Begriffsbestimmung Krebs
- 2.1.1 Pathologie der Zelle
- 2.1.2 Ursachen von Krebserkrankungen
- 2.1.3 Epidemiologie
- 2.2 Medizinische Versorgung
- 2.2.1 Operation
- 2.2.2 Bestrahlung
- 2.2.3 Medikamentöse Behandlung
- 2.2.4 Tumornachsorge
- 2.1 Begriffsbestimmung Krebs
- 3. Krankheitskonzepte und Krankheitsverarbeitung
- 3.1 Gesundheit und Krankheit
- 3.2 Krankheitsmodelle
- 3.2.1 Das biomedizinische Krankheitsmodell
- 3.2.2 Das psychosomatische Krankheitsmodell
- 3.2.3 Das Streß-Modell
- 3.2.4 Das Verhaltensmodell von Krankheit
- 3.2.5 Das sozioökonomische Krankheitsmodell
- 3.2.6 Das Risikofaktoren-Modell
- 3.3 Krankheitsverarbeitung
- 3.3.1 Krankheitsbewältigung
- 3.3.1.1 Das Coping-Modell
- 3.3.1.2 Das Konzept der Abwehr
- 3.3.2 Zusammenhang von Coping- und Abwehrkonzept
- 3.3.1 Krankheitsbewältigung
- 4. Belastungen für Menschen mit einer Krebserkrankung
- 4.1 Diagnosemitteilung
- 4.2 Krankheitsbewältigung bei Krebskranken
- 4.3 Krankheitsverarbeitung im Verlauf
- 5. Beratung
- 5.1 Beratungsansätze in Deutschland – Ein geschichtlicher Rückblick
- 5.2 Psychosoziale Beratung
- 5.2.1 Klientenorientierte Gesprächsführung
- 5.2.2 Die Beratungsbeziehung
- 5.3 Psychosoziale Beratung in der Onkologie
- 5.3.1 Konzept zur psychosozialen Beratung in der Onkologie
- 5.3.1.1 Leistungen
- 5.3.1.2 Tätigkeitsfelder
- 5.3.1.3 Strukturqualität
- 5.3.1.4 Personalausstattung
- 5.3.1.5 Rechtliche Rahmenbedingungen
- 5.3.1.6 Qualitätssicherung
- 5.3.1.7 Anforderungen an Mitarbeiter
- 5.3.2 Unterstützende Angebote innerhalb der Krebsberatung im psychoonkologischen Bereich
- 5.3.1 Konzept zur psychosozialen Beratung in der Onkologie
- 6. Sozialrechtliche Beratung
- 6.1 Sozialrechtliche Beratung
- 6.1.1 Zuzahlungen
- 6.1.2 Schwerbehindertenrecht
- 6.2 Wirtschaftliche und finanzielle Beratung
- 6.2.1 Lohnersatzzahlungen
- 6.2.2 Krankengeld
- 6.2.3 Übergangsgeld
- 6.2.4 Härtefonds der Deutschen Krebshilfe
- 6.2.5 Erwerbsminderungsrente
- 6.2.6 Wiedereingliederung in den Beruf
- 6.3 Medizinische Rehabilitationsmaßnahme
- 6.3.1 Anschlussrehabilitation (AR)
- 6.3.2 Onkologische Rehabilitation
- 6.3.3 Nach-, Festigungs- und Rehabilitationskuren
- 6.4 Soziale Pflegeversicherung
- 6.4.1 Pflegestufen
- 6.4.2 Pflegebedürftigkeit
- 6.5 Selbstbestimmungsrecht
- 6.1 Sozialrechtliche Beratung
- 7. Tumorzentrum „Südharz e.V."
- 7.1 Psychosoziale Beratungsstelle
- 7.2 Statistische Daten der Psychosozialen Beratungsstelle
- 8. Zum Anliegen der Klientenbefragung
- 9. Klientenbefragung in Kooperation mit dem Tumorzentrum „Südharz e. V."
- 9.1 Vorüberlegungen
- 9.1.1 Entscheidung für die quantitative Methoden der Befragung
- 9.1.2 Mögliche Vor- und Nachteile einer schriftlichen Befragung
- 9.1.3 Qualitätsstandards der empirischen Sozialforschung
- 9.2 Ausgangssituation
- 9.3 Vorgehensweise
- 9.3.1 Fragebogenkonstruktion
- 9.3.2 Fragebogenstruktur
- 9.4 Verteilung und Rücklaufquoten
- 9.1 Vorüberlegungen
- 10. Auswertung
- 10.1 Erster Teil - Allgemeiner Teil
- 10.1.1 Auswertung Fragen 01-04
- 10.1.2 Zusammenfassung
- 10.2 Zweiter Teil - Fragen zur Erkrankung
- 10.2.1 Auswertung Fragen 05-09
- 10.2.2 Zusammenfassung
- 10.3 Dritter Teil – Beratungsstelle Tumorzentrum Nordhausen
- 10.3.1 Auswertung Fragen 10-15b
- 10.3.2 Zusammenfassung
- 10.4 Vierter Teil - Beurteilung der Beratung
- 10.4.1 Auswertung Fragen 16-22
- 10.4.2 Zusammenfassung
- 10.5 Anmerkung zu den offenen Fragen
- 10.1 Erster Teil - Allgemeiner Teil
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Diplomarbeit befasst sich mit den Möglichkeiten der psychosozialen Beratung für Menschen mit Krebs und analysiert die Bedeutung dieser Unterstützung im Kontext der Krankheitsbewältigung. Die Arbeit konzentriert sich auf die Rolle der psychosozialen Beratung bei der Bewältigung der Erkrankung, der emotionalen und sozialen Herausforderungen sowie der Unterstützung bei der Integration in das Alltagsleben nach der Diagnose.
- Psychosoziale Unterstützung für Menschen mit Krebs
- Krankheitsbewältigung und -verarbeitung
- Rolle der Beratung in der Onkologie
- Empirische Analyse der Klientenzufriedenheit
- Bedeutung sozialrechtlicher und finanzieller Unterstützung
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den aktuellen Forschungsstand zu psychosozialer Beratung für Menschen mit Krebs beleuchtet. Kapitel 2 präsentiert medizinische Grundlagen und behandelt die Pathologie der Zelle, Ursachen von Krebserkrankungen und die epidemiologische Situation. Anschließend werden verschiedene Krankheitsmodelle und Ansätze zur Krankheitsverarbeitung vorgestellt, wobei das Coping-Modell und das Konzept der Abwehr im Mittelpunkt stehen.
In Kapitel 4 werden die Belastungen für Menschen mit einer Krebserkrankung näher betrachtet, wobei insbesondere die Diagnosemitteilung und die Krankheitsbewältigung im Vordergrund stehen. Die folgenden Kapitel befassen sich mit dem Thema Beratung und beleuchten verschiedene Beratungsansätze, die Klientenorientierte Gesprächsführung und die Bedeutung der Beratungsbeziehung.
Kapitel 5 analysiert die psychosoziale Beratung in der Onkologie, wobei die Leistungen, Tätigkeitsfelder, Strukturqualität, Personalausstattung, rechtliche Rahmenbedingungen und die Qualitätssicherung im Fokus stehen.
Kapitel 6 befasst sich mit sozialrechtlichen und finanziellen Aspekten der Beratung, wie Zuzahlungen, Schwerbehindertenrecht, Lohnersatzzahlungen, Krankengeld, Übergangsgeld, Härtefonds, Erwerbsminderungsrente und Wiedereingliederung in den Beruf.
Kapitel 7 gibt einen Einblick in das Tumorzentrum „Südharz e.V." und seine psychosoziale Beratungsstelle.
Kapitel 8 beschreibt das Anliegen der Klientenbefragung, während Kapitel 9 die Vorgehensweise bei der Durchführung der Befragung in Kooperation mit dem Tumorzentrum „Südharz e.V." beschreibt.
Kapitel 10 präsentiert die Auswertung der Ergebnisse der Klientenbefragung, wobei die Befragungsdaten in verschiedenen Teilbereichen analysiert werden.
Schlüsselwörter (Keywords)
Psychosoziale Beratung, Krebs, Krankheitsbewältigung, Onkologie, Klientenbefragung, Tumorzentrum, Südharz e.V., Sozialrecht, finanzielle Unterstützung, Empirische Forschung.
Häufig gestellte Fragen zur psychosozialen Beratung bei Krebs
Was ist das Ziel psychosozialer Beratung in der Onkologie?
Sie unterstützt Betroffene bei der emotionalen Krankheitsbewältigung, hilft bei sozialen Belastungen und fördert die Lebensqualität nach der Diagnose.
Welche Krankheitsmodelle werden unterschieden?
Unterschieden werden unter anderem das biomedizinische, das psychosomatische, das Stress-Modell und das sozioökonomische Krankheitsmodell.
Was versteht man unter "Coping"?
Coping bezeichnet die Gesamtheit der Bemühungen einer Person, belastende Situationen und die damit verbundenen Emotionen zu bewältigen.
Welche sozialrechtlichen Hilfen gibt es für Krebspatienten?
Dazu zählen Beratung zum Schwerbehindertenrecht, Krankengeld, Übergangsgeld, Härtefonds der Krebshilfe sowie Hilfen zur beruflichen Wiedereingliederung.
Was leistet das Tumorzentrum Südharz e.V.?
Es bietet eine spezialisierte psychosoziale Beratungsstelle an, die Klienten bei der Verarbeitung ihrer Krebserkrankung und den damit verbundenen Lebensveränderungen unterstützt.
- Citation du texte
- Christine Jeschke (Auteur), 2008, Soziale Unterstützungsmöglichkeiten durch psychosoziale Beratung für Menschen mit Krebs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167956