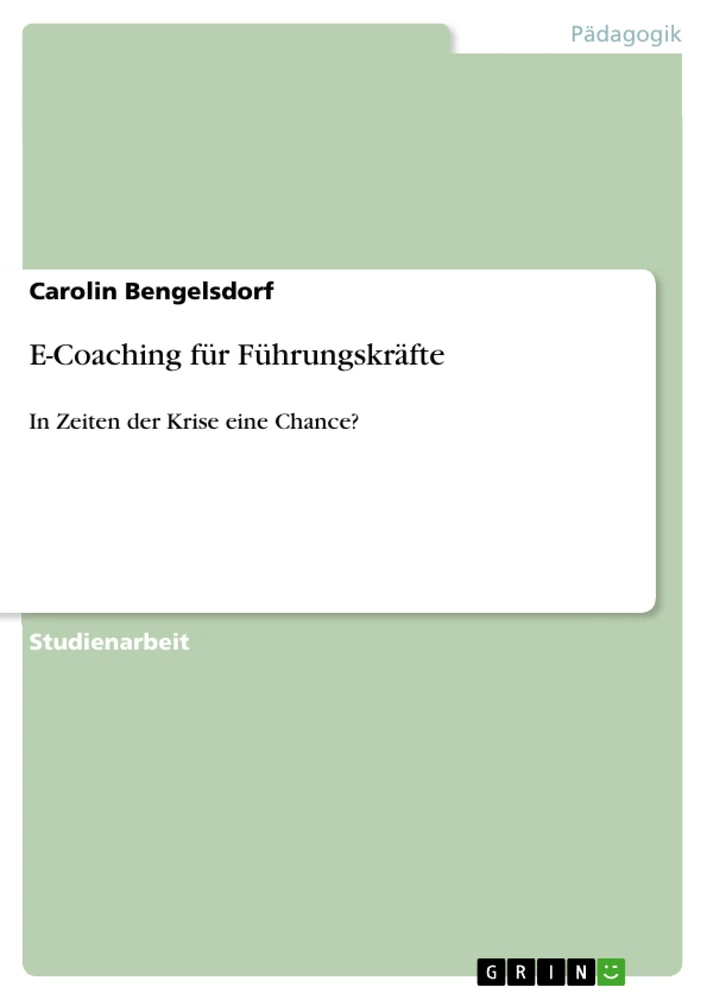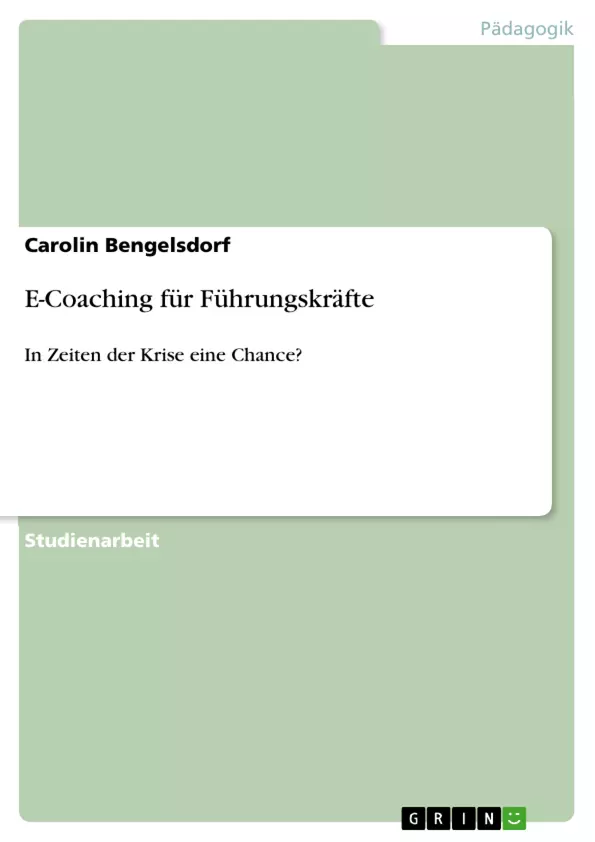Coaching boomt! Die Entwicklung von Coaching und der sich daraus resultierende
Coachingmarkt in der Bundesrepublik Deutschland sind beeindruckend. Längst wurde der
langjährige Anwendungsbereich, der Hochleistungsport, verlassen und Coaching ist zu einem
wichtigen Feld im Bereich der Wirtschaft, der Führung und der Personalentwicklung
geworden. Coaching ist nicht mehr nur ein kurzfristiger Modetrend, sondern „hat sich
gegenwärtig zu einer breit akzeptierten und nachgefragten Personalentwicklungsmaßnahme
für Mitarbeiter mit Führungsaufgaben entwickelt“ (Stephan/Gross/Hildebrandt 2005, S. 5).
Demnach scheint nichts naheliegender zu sein, als die Erfolgsgeschichte von Coaching durch
den Gebrauch der Möglichkeiten fortzuschreiben, die die modernen Medien anbieten (vgl.
Geißler 2008, S. 3). Auch heute gewinnt das Medium Internet immer noch an Bedeutung und
ist weltweit das größte Informations- und Kommunikationsnetz (vgl. Verein Wiener
Sozialprojekte 2006, S. 6). Auch in einer Zeit, in der die Menschen einem verstärkten
Zeitdruck gegenüberstehen, gewinnen zeitlich und örtlich flexible Anwendungen an
Attraktivität. Somit wäre doch in Zeiten der Wirtschaftskrise und knapper Kassen der
virtuelle Markt eine Chance, um beispielsweise Kosten und Zeit für Coaching als
Personalentwicklungsmaßnahme zu sparen. Doch die Bereitstellung und Nutzung von
Angeboten im Bereich des E-Coaching sind bisher noch unklar und zum Teil beliebig (vgl.
Theis 2008, S. 24). Aus diesem Grund beschäftigt sich diese Arbeit mit der Frage, welche
Möglichkeiten der Beratung mit Hilfe des Internets und weiteren Formen der elektronischen
Kommunikation entstanden sind und welche Stimmen für und gegen das E-Coaching erhoben
werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ein Zugang zur Thematik Coaching
- Definition von Coaching
- Eigenschaften von Coaching
- E-Coaching
- Grundlagen von E-Coaching
- Didaktisch offenes E-Coaching
- Didaktisch vorstrukturiertes Coaching
- E-Coaching - eine Chance?
- E-Coaching - gewogen und für zu leicht befunden
- E-Coaching - Beratung der besonderen Art
- Ein Zwischenfazit
- Grundlagen von E-Coaching
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht die Möglichkeiten und Herausforderungen von E-Coaching für Führungskräfte im Kontext der Wirtschaftskrise. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Bedeutung des E-Coachings im Vergleich zu traditionellen Coaching-Formaten zu beleuchten und die Frage zu beantworten, ob E-Coaching in Zeiten der Krise eine Chance für die Personalentwicklung darstellt.
- Definition und Geschichte des Coachings
- Grundlagen und Methoden des E-Coachings
- Vor- und Nachteile des E-Coachings
- E-Coaching als Instrument der Personalentwicklung
- E-Coaching in Zeiten der Krise
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik des E-Coachings für Führungskräfte in den Kontext der aktuellen Wirtschaftskrise und erläutert die Relevanz der Fragestellung. Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem Begriff des Coachings und stellt verschiedene Definitionen und Charakteristika vor. Der Fokus liegt dabei auf dem Coaching für Führungskräfte.
Kapitel 3 widmet sich dem E-Coaching und untersucht die wichtigsten Grundlagen, Methoden und Anwendungsmöglichkeiten. Die Diskussion der Vor- und Nachteile von E-Coaching mündet in einem Zwischenfazit, das die Chancen und Herausforderungen dieses Formats beleuchtet.
Schlüsselwörter
E-Coaching, Führungskräfte, Personalentwicklung, Wirtschaftskrise, Beratung, Online-Kommunikation, digitale Medien, Coaching-Methoden, Didaktik, Wirtschaftlichkeit, Effizienz.
Häufig gestellte Fragen
Was ist E-Coaching?
E-Coaching bezeichnet professionelle Beratungsprozesse, die primär über das Internet und andere elektronische Kommunikationsmittel (wie Video-Calls oder E-Mail) durchgeführt werden.
Welche Vorteile bietet E-Coaching für Führungskräfte?
Es ermöglicht eine hohe zeitliche und örtliche Flexibilität, spart Reisekosten und bietet in Krisenzeiten eine ökonomische Alternative zu Präsenz-Coaching.
Gibt es Unterschiede in der Didaktik beim E-Coaching?
Die Arbeit unterscheidet zwischen didaktisch offenem E-Coaching und didaktisch vorstrukturierten Programmen.
Welche Kritikpunkte werden gegen E-Coaching angeführt?
Kritiker bemängeln oft das Fehlen nonverbaler Signale, mögliche technische Hürden und die Sorge, dass die Beratungsqualität im virtuellen Raum leiden könnte.
Warum boomt Coaching derzeit in der Wirtschaft?
Es hat sich als breit akzeptierte Personalentwicklungsmaßnahme etabliert, um Mitarbeiter mit Führungsaufgaben bei komplexen Herausforderungen zu unterstützen.
Ist E-Coaching eine Chance in Zeiten der Wirtschaftskrise?
Die Hausarbeit untersucht, ob virtuelle Beratungsangebote trotz knapper Kassen helfen können, notwendige Entwicklungsprozesse effizient fortzuführen.
- Quote paper
- Carolin Bengelsdorf (Author), 2010, E-Coaching für Führungskräfte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168009