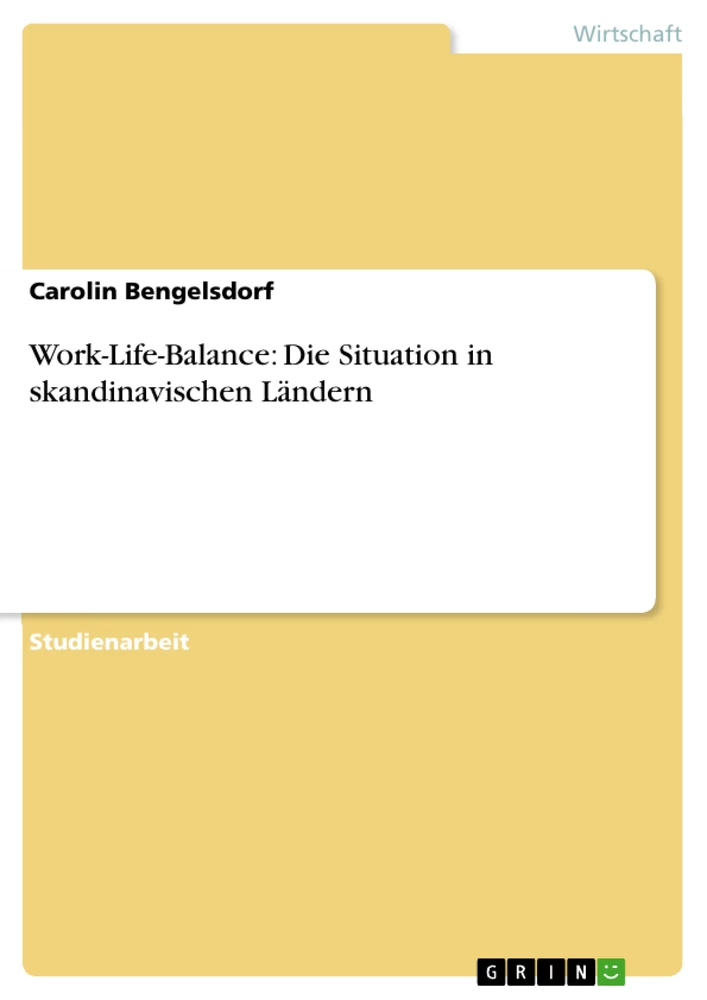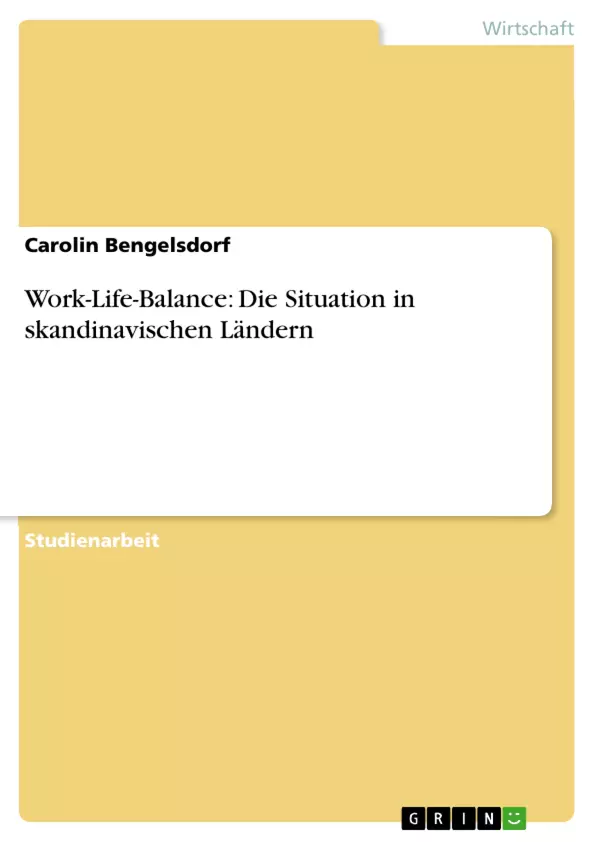In der Tat, auch Deutschland hat das Thema der ‚Work-Life-Balance‘ erreicht. Über
Jahre wurde das Thema der Vereinbarkeit von Familie und Beruf als ein eher an den
Rand geschobenes Frauenthema abgestempelt. Doch es ist nicht mehr nur ein
Modewort mit temporärem Charakter. Mehr und mehr rückt es in den Mittelpunkt
wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Interessen. Work-Life-Balance ist ein
nachhaltig ernst zu nehmendes Thema mit hoher Bedeutung. Die aktuellen
öffentlichen Diskussionen belegen, dass die Bedingungen für ein ausgewogenes
Verhältnis zwischen Familie und Arbeit und der Familiengründung in Deutschland
schlechter als in anderen Ländern angesehen werden.1 Ein Blick über den Tellerrand
wäre hier vielleicht sinnvoll. Die skandinavischen Länder leisten im Vergleich zu
anderen Ländern wie der Bundesrepublik Deutschland erheblich mehr für die
Förderung der Familie. Auch das Thema der Gleichheit der Geschlechter besitzt in
Skandinavien einen hohen Stellenwert.2 Auch wenn der „skandinavische Weg“
vielleicht nicht eins zu eins auf ein Land wie Deutschland übertragen werden kann,
lohnt sich eine Auseinandersetzung allemal.
Die sich anschließende Arbeit soll in diesem Zusammenhang folgender These
zugrunde liegen:
Skandinavische Länder sind im Bezug von Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf
sehr weit entwickelt und die sozialen Sicherungssysteme, sowie der Ausbau
öffentlicher Kinderbetreuungseinrichtungen sind in den jeweiligen Ländern
außerordentlich gut fortgeschritten. Skandinavische Familie und insbesondere
Frauen haben mehr die Chance, ihre persönliche Balance zwischen der Arbeitswelt
und dem Privatleben zu erreichen.
Demzufolge stellt sich die Frage, inwieweit in diesem Zusammenhang auch der Staat
mögliche Einflüsse und Maßnahmen zu einem ausgewogenen Verhältnis zwischen
Arbeit und Familie beitragen kann.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einführung
- 2. Ein Zugang zur Thematik Work-Life-Balance
- 2.1. Die Begriffe Work, Life und Balance
- 2.2. Definition von Work-Life-Balance
- 2.3. Was nützt Work-Life-Balance?
- 2.4. Maßnahmen von Work-Life-Balance
- 3. Work-Life-Balance in Skandinavien
- 3.1. Dänemark
- 3.2. Norwegen
- 3.3. Schweden
- 3.4. die skandinavischen Länder im Überblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Work-Life-Balance in skandinavischen Ländern. Sie untersucht, wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in diesen Ländern gefördert wird und welche Rolle der Staat dabei spielt. Die Arbeit beleuchtet insbesondere die hohen sozialen Sicherungssysteme und den Ausbau öffentlicher Kinderbetreuungseinrichtungen in Skandinavien und analysiert, wie diese die Chancengleichheit von Frauen am Arbeitsmarkt fördern und ihnen die Möglichkeit bieten, eine gesunde Balance zwischen Arbeit und Privatleben zu finden.
- Definition von Work-Life-Balance
- Die Rolle des Staates in der Förderung von Work-Life-Balance
- Familienfreundliche Maßnahmen in Skandinavien
- Die Situation von Frauen am Arbeitsmarkt in Skandinavien
- Der Vergleich mit Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Work-Life-Balance ein und stellt die aktuelle Situation in Deutschland dar. Es wird auf die Notwendigkeit eines gesunden Verhältnisses zwischen Arbeit und Familie hingewiesen und die Bedeutung der Thematik für die Wirtschaft und Gesellschaft hervorgehoben.
Kapitel 2 bietet eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem Begriff der Work-Life-Balance. Es werden die Begriffe "Work", "Life" und "Balance" analysiert und verschiedene Definitionen von Work-Life-Balance beleuchtet. Des Weiteren werden die Vorteile von Work-Life-Balance für Individuen und Unternehmen diskutiert, sowie verschiedene Maßnahmen vorgestellt, die Unternehmen ergreifen können, um ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben zu fördern.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Situation der Work-Life-Balance in Skandinavien. Es werden die drei Länder Dänemark, Norwegen und Schweden im Detail betrachtet. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Rolle des Staates in der Förderung von Work-Life-Balance und der Unterstützung von Familien. Es werden familienfreundliche Maßnahmen, wie z.B. die ausgebaute Kinderbetreuung, flexible Arbeitszeiten und Elternzeitregelungen, analysiert. Abschließend werden die skandinavischen Länder im Hinblick auf ihre Work-Life-Balance-Strategien miteinander verglichen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Work-Life-Balance, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Familienfreundliche Maßnahmen, Staatliche Förderung, soziale Sicherungssysteme, Kinderbetreuung, Chancengleichheit, Frauen am Arbeitsmarkt, Skandinavien, Dänemark, Norwegen, Schweden.
Häufig gestellte Fragen
Was zeichnet die Work-Life-Balance in Skandinavien aus?
Skandinavische Länder verfügen über hochentwickelte soziale Sicherungssysteme, exzellente öffentliche Kinderbetreuung und eine starke staatliche Förderung der Gleichberechtigung.
Wie unterscheidet sich die Situation in Dänemark, Norwegen und Schweden?
Obwohl alle drei Länder den "skandinavischen Weg" verfolgen, gibt es Unterschiede in den spezifischen Elternzeitregelungen und flexiblen Arbeitszeitmodellen.
Welche Rolle spielt der Staat bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf?
In Skandinavien greift der Staat aktiv ein, um durch Infrastruktur und Gesetze sicherzustellen, dass insbesondere Frauen eine Balance zwischen Erwerbsarbeit und Privatleben finden können.
Ist das skandinavische Modell auf Deutschland übertragbar?
Die Arbeit diskutiert, dass eine Eins-zu-eins-Übertragung schwierig ist, aber eine Auseinandersetzung mit den dortigen Erfolgsfaktoren für Deutschland sehr sinnvoll wäre.
Welche Vorteile bietet Work-Life-Balance für Unternehmen?
Gute Work-Life-Balance-Maßnahmen erhöhen die Mitarbeiterzufriedenheit, senken die Fluktuation und steigern die Produktivität durch motiviertere Arbeitskräfte.
- Quote paper
- Carolin Bengelsdorf (Author), 2009, Work-Life-Balance: Die Situation in skandinavischen Ländern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168018