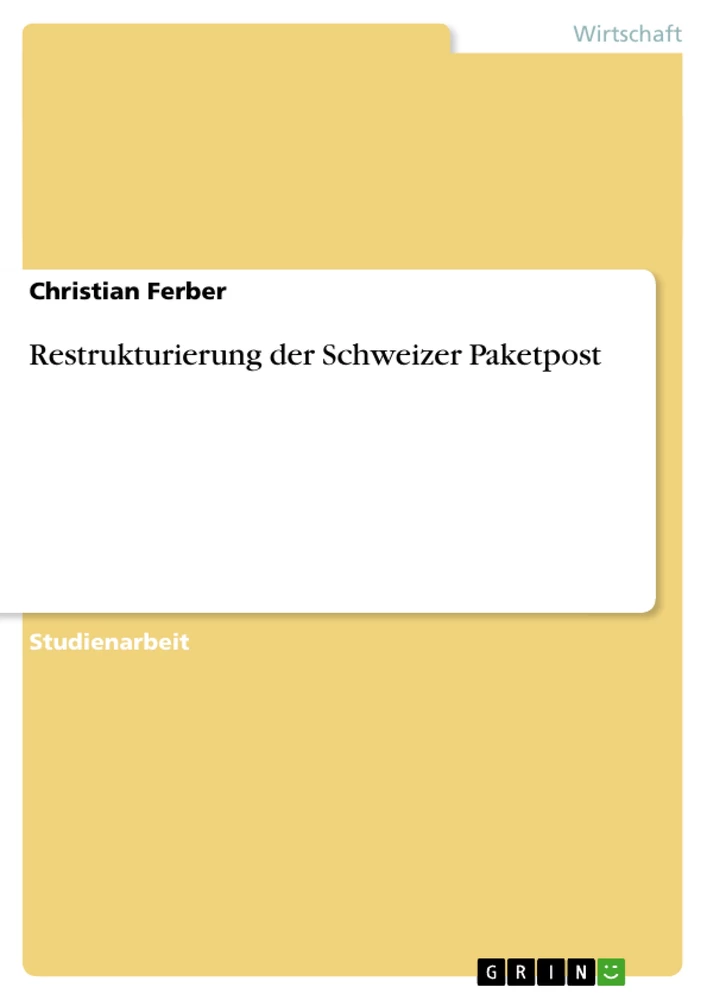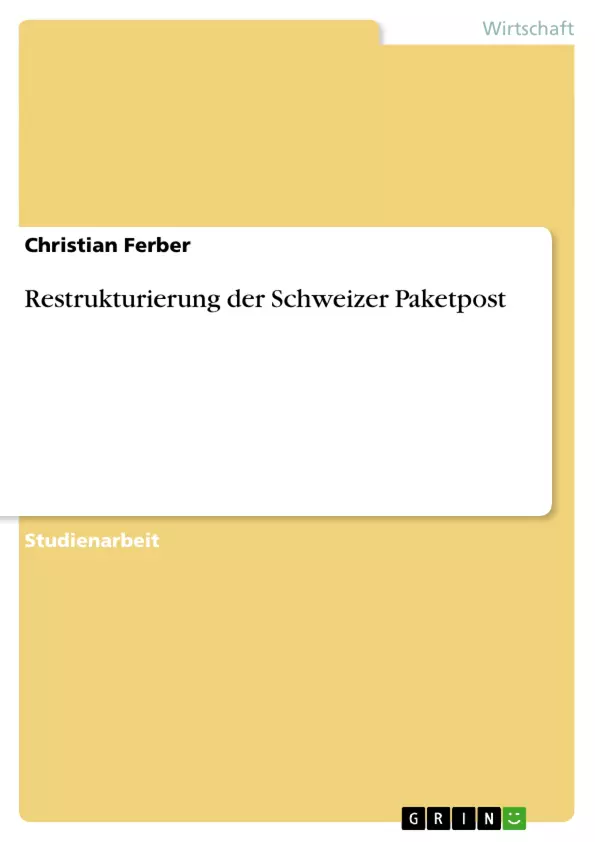Seit Januar 1998 ist die Schweizer Post in die beiden voneinander unabhängigen Teilbereiche Telekommunikation und Postdienst getrennt, die seitdem als selbständige Unternehmen operieren.
Überdies wurde das Postmonopol gelockert: Päckchen mit einem Gewicht größer als 2 kg dürfen ab 1.1.1998 auch von Privatdiensten befördert werden, die Grenze wurde dabei von 5 kg herabgesetzt.
Die Post sah sich somit dem Dilemma gegenüber, einerseits einer kostenintensiven flächendeckenden Grundversorgung verpflichtet zu sein, andererseits aber aufgrund des Wegfalls der Telekomsparte keine Subventionen aus diesem Bereich mehr zu erhalten und trotzdem in intensivem Wettbewerb mit Privatanbietern zu stehen.
Um all diese Herausforderungen bewältigen zu können, musste die Schweizer Post ihr Unternehmen restrukturieren. Unter dem Schlagwort „Paketpost 2000“ wollte die Post bis zum Jahr 2000 wettbewerbsfähig werden und in die Gewinnzone kommen, was sie mit einem Unternehmensgewinn von 194 Mio. Franken in 2001 und 204 Mio. Franken in 2002 auch geschafft hat.
Um dieses Ziel zu erreichen, wurden etliche Maßnahmen durchgeführt. Weiterhin wurde die Paketauslieferung zentralisiert, indem Pakete über insgesamt 66 Zustellbasen (ZB) an die Kunden ausgeliefert werden.
Die im Vorfeld zu lösende Problemstellung umfasste folgende Bereiche:
- Anzahl, Standorte und Kapazitäten der Paketzentren PZ
- Anzahl, Standorte und Kapazitäten der ZB
- Zuordnung der ZB und Poststellen (PS) zu den PZ
- Zuordnung Kundenregionen zu ZB
Um mögliche Lösungen für dieses Problem zu ermitteln, wurde ein einstufiges, unkapazitiertes Standortmodell benutzt, welches im Folgenden detailliert beschrieben wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Struktur des Systems der Paketauslieferung
- 2.1 Fluss von den Poststellen zu und zwischen den PZ
- 3. Das unkapazitierte, einstufige Standortmodell (Warehouse-Location-Problem WLP)
- 4. Schätzung der auftretenden Kosten
- 5. Ergebnisse
- 6. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Restrukturierung der Schweizer Paketpost im Kontext der Liberalisierung des Telekommarktes und des Wegfalls von Subventionen. Ziel ist es, die angewandten Methoden der Operations Research zur Optimierung des Distributionsnetzwerks zu beschreiben und zu bewerten.
- Optimierung des Distributionsnetzwerks der Schweizer Paketpost
- Anwendung des Warehouse-Location-Problems (WLP)
- Kostenanalyse und Effizienzsteigerung
- Einfluss der Liberalisierung des Marktes auf die Restrukturierung
- Analyse der organisatorischen Veränderungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Dieses Kapitel beschreibt den Hintergrund der Restrukturierung der Schweizer Paketpost nach der Trennung von der Telekommunikationssparte im Jahr 1998. Es hebt die Herausforderungen hervor, denen sich die Post gegenüber sah: zunehmende Konkurrenz durch private Anbieter, die Notwendigkeit einer kosteneffizienten flächendeckenden Grundversorgung trotz wegfallender Subventionen und hohe Defizite im Paketpostbereich. Das Kapitel führt in die Notwendigkeit der Restrukturierung ein und benennt die wichtigsten Maßnahmen, die unter dem Motto "Paketpost 2000" umgesetzt wurden, um die Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität wiederherzustellen. Die zentralen Problemfelder, wie die optimale Anzahl, die Standorte und Kapazitäten von Paketzentren und Zustellbasen sowie die Zuordnung von Regionen, werden vorgestellt und bilden die Grundlage für die im Folgenden beschriebenen Optimierungsansätze.
2. Struktur des Systems der Paketauslieferung: Dieses Kapitel beschreibt die Struktur des Paketlieferungsnetzwerks der Schweizer Post. Es identifiziert die drei Hauptströme der Pakete: von den Poststellen zu und zwischen den Paketzentren (PZ), von den PZ zu den Zustellbasen (ZB) und von den ZB oder PZ zu den Kunden. Der Fokus liegt auf dem Fluss von den Poststellen zu und zwischen den PZ. Hierbei wird erklärt, wie Pakete sortiert und zwischen den PZ umgeleitet werden, um ihre jeweiligen Zielorte zu erreichen. Die Kapitel erläutert die Annahme, dass die Standorte der neuen PZ aus einer früheren Studie bekannt sind und daher als gegeben betrachtet werden. Dieses Kapitel bildet somit die Grundlage für das Verständnis der komplexen Logistikprozesse und deren Einfluss auf die Modellierung im nächsten Kapitel.
Schlüsselwörter
Restrukturierung, Schweizer Paketpost, Operations Research, Standortplanung, Warehouse-Location-Problem (WLP), Kostenoptimierung, Wettbewerbsfähigkeit, Logistik, Distributionsnetzwerk, Paketzentrum, Zustellbasis.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Restrukturierung der Schweizer Paketpost
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Restrukturierung der Schweizer Paketpost nach der Liberalisierung des Telekommarktes und dem Wegfall von Subventionen. Im Fokus steht die Beschreibung und Bewertung der angewandten Methoden des Operations Research zur Optimierung des Distributionsnetzwerks.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Optimierung des Distributionsnetzwerks, die Anwendung des Warehouse-Location-Problems (WLP), die Kostenanalyse und Effizienzsteigerung, den Einfluss der Marktliberalisierung auf die Restrukturierung und die Analyse der organisatorischen Veränderungen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einführung, Struktur des Systems der Paketauslieferung, das unkapazitierte, einstufige Standortmodell (WLP), Schätzung der auftretenden Kosten, Ergebnisse und Zusammenfassung. Kapitel 1 beschreibt den Hintergrund der Restrukturierung und die Herausforderungen der Schweizer Post. Kapitel 2 erläutert die Struktur des Paketlieferungsnetzwerks. Kapitel 3 behandelt das mathematische Modell zur Optimierung der Standortwahl. Kapitel 4 konzentriert sich auf die Kostenanalyse. Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse und Kapitel 6 fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist die Beschreibung und Bewertung der Methoden des Operations Research, die zur Optimierung des Distributionsnetzwerks der Schweizer Paketpost eingesetzt wurden. Es geht darum, die Effizienzsteigerung und Kostenoptimierung im Kontext der Marktliberalisierung zu analysieren.
Welche Rolle spielt das Warehouse-Location-Problem (WLP)?
Das WLP dient als zentrales Modell zur Optimierung der Standorte der Paketzentren. Die Arbeit beschreibt die Anwendung dieses Modells im Kontext der Restrukturierung der Schweizer Paketpost.
Wie wird die Kostenoptimierung behandelt?
Die Arbeit analysiert die Kosten, die mit dem Betrieb des Distributionsnetzwerks verbunden sind, und bewertet die Auswirkungen der Optimierungsmaßnahmen auf die Kostenstruktur. Eine detaillierte Schätzung der Kosten wird in einem separaten Kapitel dargestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Restrukturierung, Schweizer Paketpost, Operations Research, Standortplanung, Warehouse-Location-Problem (WLP), Kostenoptimierung, Wettbewerbsfähigkeit, Logistik, Distributionsnetzwerk, Paketzentrum, Zustellbasis.
Welche Herausforderungen wurden bei der Restrukturierung der Schweizer Paketpost identifiziert?
Die wichtigsten Herausforderungen waren zunehmende Konkurrenz durch private Anbieter, der Wegfall von Subventionen und die Notwendigkeit einer kosteneffizienten flächendeckenden Grundversorgung.
Wie wird der Fluss der Pakete im System beschrieben?
Der Fluss der Pakete wird in drei Hauptströme unterteilt: von den Poststellen zu und zwischen den Paketzentren (PZ), von den PZ zu den Zustellbasen (ZB) und von den ZB oder PZ zu den Kunden. Die Arbeit konzentriert sich insbesondere auf den Fluss von den Poststellen zu und zwischen den PZ.
- Quote paper
- Christian Ferber (Author), 2003, Restrukturierung der Schweizer Paketpost, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16809