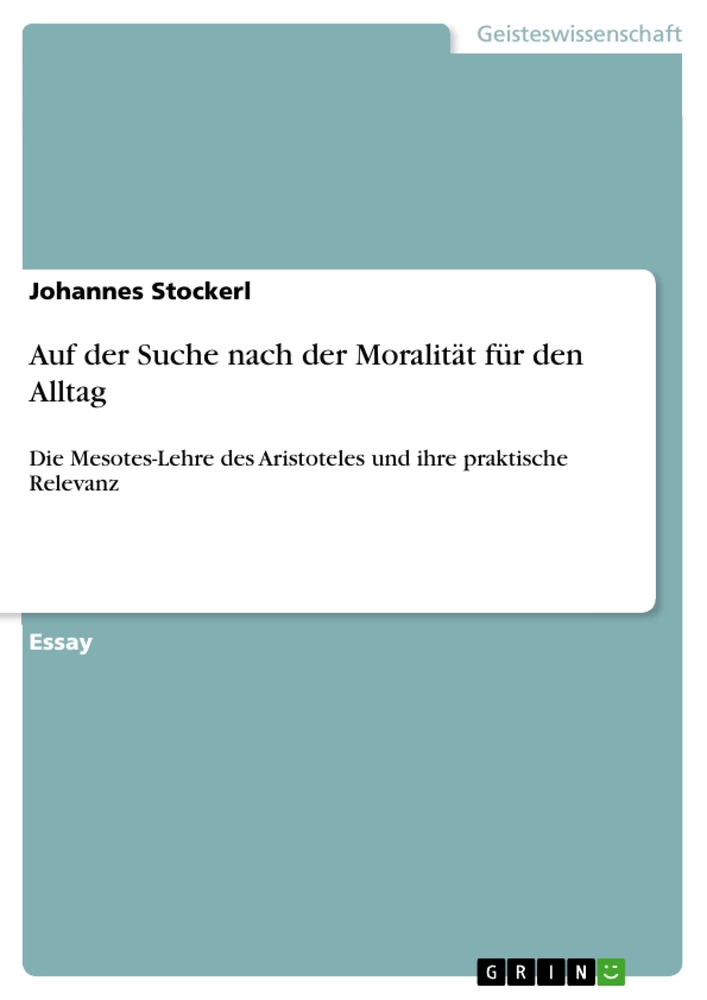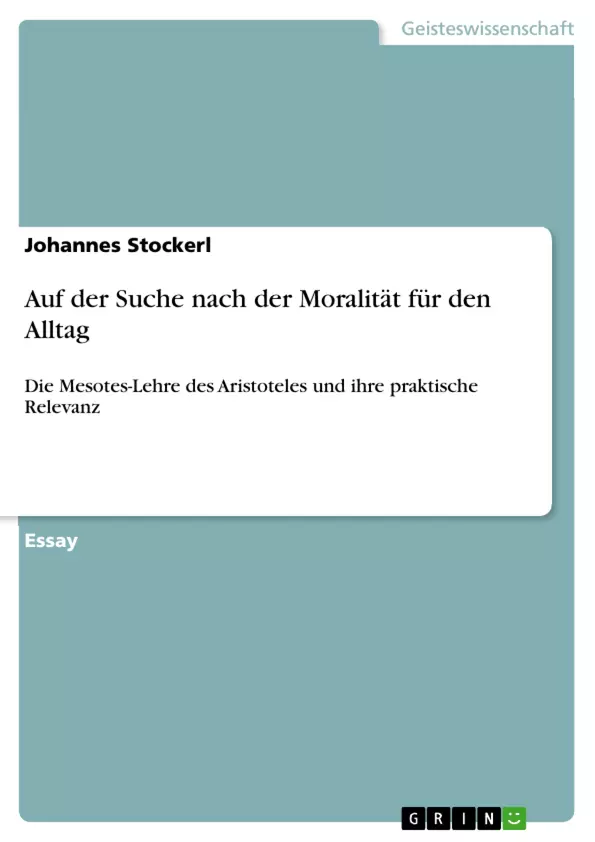Verfolgt man aktuelle politische Debatten, so dürfte dem interessierten Beobachter auffallen, dass viel von der Bedeutung der „Mitte“ die Rede ist. Die Mitteschicht, die es anzusprechen und zu fördern gilt, die Mitte der Gesellschaft, aus der viele Politiker betonen zu kommen und für die sie –mit deren Zustimmung- tätig sind oder gerne auch weiterhin sein würden. Von den politischen Rändern, egal ob rechts oder links, grenzt man sich –insbesondere in den beiden großen Volksparteien im Land- bewusst ab. Will man die Ursachen für dieses Muster ergründen, so landet man unweigerlich bei der so genannten Mesotes-Lehre. Die Idee, auf der dieses uns allen so vertraute Bild vom hohen Stellenwert einer mittleren Position letztlich basiert, lässt sich bis auf den Philosophen der griechischen Antike mit Namen Aristoteles zurückführen. Dieser erhob in seinem Werk mit dem Titel „Nikomachische Ethik“ (NE) das Konzept der Mitte bzw. des rechten Maßes zum idealen Hilfsmittel, um zur Eudaimonie, d.h. zur Glückseeligkeit zu gelangen. Inwiefern uns allen das Erreichen derselben am Herzen liegen muss, verdeutlicht er, indem er feststellt: „Was ist es für ein Ziel, das wir als das im Staatsleben angestrebte bezeichnen, und welches ist das oberste unter allen durch ein praktisches Verhalten zu erlangenden Gütern?“ und weiter: „In dem Namen, den sie ihm geben, stimmen die meisten Menschen so ziemlich überein. Sowohl die Masse wie die vornehmeren Geister bezeichnen es als die Glückseligkeit, die Eudaimonie […].“ Der Anspruch, den der Philosoph dabei im weiteren Verlauf an seine eigene Arbeit stellt ist kein geringer. Es geht ihm um nichts weniger, als einen Paradigmenwechsel im Hinblick auf das Gute und dessen Rolle für das Leben eines jeden Einzelnen. Das Gute-an-sich, in welchem viele bis dato den Schlüssel zur Eudaimonia gesehen haben, habe im täglichen Leben längst jegliche Relevanz verloren, so Aristoteles. Es gelte also zum einen, den Gegenstand des Guten-an-sich „fallen zu lassen“ und sich über einen neuen Weg Gedanken zu machen, der uns zur Glückseligkeit führen kann. Und an dieser Stelle schließt sich nun der Kreis. Die Lehre vom rechten Maß, mit ihren bereits erwähnten, bis heute wahrnehmbaren Einflüssen, hält Einzug in unseren ethisch moralischen und später auch politischen Alltag.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Die Mesotes-Lehre
- Die Rolle der Vernunft
- Auffindung konkreter Normen
- Beispiele für die Anwendung der Mesotes-Lehre
- Grenzen der Mesotes-Lehre
- Die Grenzen der Unterscheidung in „Mitten“ und „Extreme“
- Individuelle Unterschiede und die Grenzen der Anwendbarkeit der Mesotes-Lehre
- Die Bedeutung moralischer Vorbilder
- Kritik der Mesotes-Lehre
- Die mangelnde Praxistauglichkeit der Mesotes-Lehre
- Die Unvollständigkeit des Systems
- Die mangelnde Objektivität moralischer Vorbilder
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Mesotes-Lehre des Aristoteles und ihrer Relevanz für die heutige Zeit. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, inwieweit die Lehre des Aristoteles eine praktikable Grundlage für moralische Entscheidungen im Alltag bietet.
- Die Mesotes-Lehre als Konzept des rechten Maßes
- Die Rolle der Vernunft bei der Entscheidungfindung
- Die Bedeutung von Tugenden und deren praktische Anwendung
- Die Grenzen der Mesotes-Lehre im Hinblick auf individuelle Unterschiede und moralische Konflikte
- Die Relevanz des Aristoteles für die moderne Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Mesotes-Lehre des Aristoteles. Dabei wird zunächst die Rolle der Vernunft im Rahmen des ethischen Modells beleuchtet. Anschließend werden die Hauptmechanismen zur Auffindung konkreter Normen vorgestellt und anhand von Beispielen aus der „Nikomachischen Ethik“ illustriert.
Im zweiten Abschnitt werden die Grenzen der Mesotes-Lehre näher beleuchtet. Dabei wird die Frage diskutiert, inwieweit die Lehre tatsächlich eine praktikable Grundlage für moralische Entscheidungen im Alltag bietet. Insbesondere werden die Probleme der Unterscheidung zwischen „Mitten“ und „Extremen“ sowie die Berücksichtigung individueller Unterschiede analysiert.
Im dritten Abschnitt werden die Kritikpunkte der Mesotes-Lehre diskutiert. Dabei wird die mangelnde Praxistauglichkeit, die Unvollständigkeit des Systems und die mangelnde Objektivität moralischer Vorbilder als zentrale Kritikpunkte behandelt.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit behandelt die Themen Mesotes-Lehre, Aristoteles, Nikomachische Ethik, ethische Entscheidung, moralische Handlung, Vernunft, Tugend, Glückseligkeit, Eudaimonie, Praxisrelevanz, moralische Vorbilder, Kritik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale Aussage der Mesotes-Lehre des Aristoteles?
Die Mesotes-Lehre besagt, dass Tugend in der Mitte zwischen zwei Extremen liegt (z.B. Tapferkeit als Mitte zwischen Tollkühnheit und Feigheit). Dieses „rechte Maß“ ist der Weg zur Glückseligkeit (Eudaimonie).
Welche Rolle spielt die Vernunft in der Ethik des Aristoteles?
Die Vernunft ist das Werkzeug, um in konkreten Situationen die „Mitte“ zu finden. Moralische Entscheidungen basieren nicht auf starren Regeln, sondern auf vernunftgeleiteter Abwägung.
Bietet die Mesotes-Lehre eine praktikable Grundlage für den Alltag?
Die Arbeit diskutiert dies kritisch. Während das Konzept theoretisch einleuchtend ist, wird die mangelnde Praxistauglichkeit und Objektivität bei der Bestimmung dessen, was genau die „Mitte“ ist, oft kritisiert.
Was versteht Aristoteles unter „Eudaimonie“?
Eudaimonie bedeutet Glückseligkeit oder ein gelungenes Leben. Sie ist das höchste Ziel menschlichen Handelns und wird durch tugendhaftes Verhalten erreicht.
Warum sind moralische Vorbilder laut dieser Lehre wichtig?
Da es schwer ist, die Mitte rein theoretisch zu bestimmen, dienen moralische Vorbilder als Orientierung, wie tugendhaftes Handeln in der Praxis aussieht.
Welche Kritikpunkte gibt es an der Mesotes-Lehre?
Kritisiert werden die Unvollständigkeit des Systems, die Schwierigkeit, individuelle Unterschiede zu berücksichtigen, und die mangelnde Objektivität bei der Unterscheidung zwischen Mitte und Extremen.
- Arbeit zitieren
- Johannes Stockerl (Autor:in), 2011, Auf der Suche nach der Moralität für den Alltag , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168176