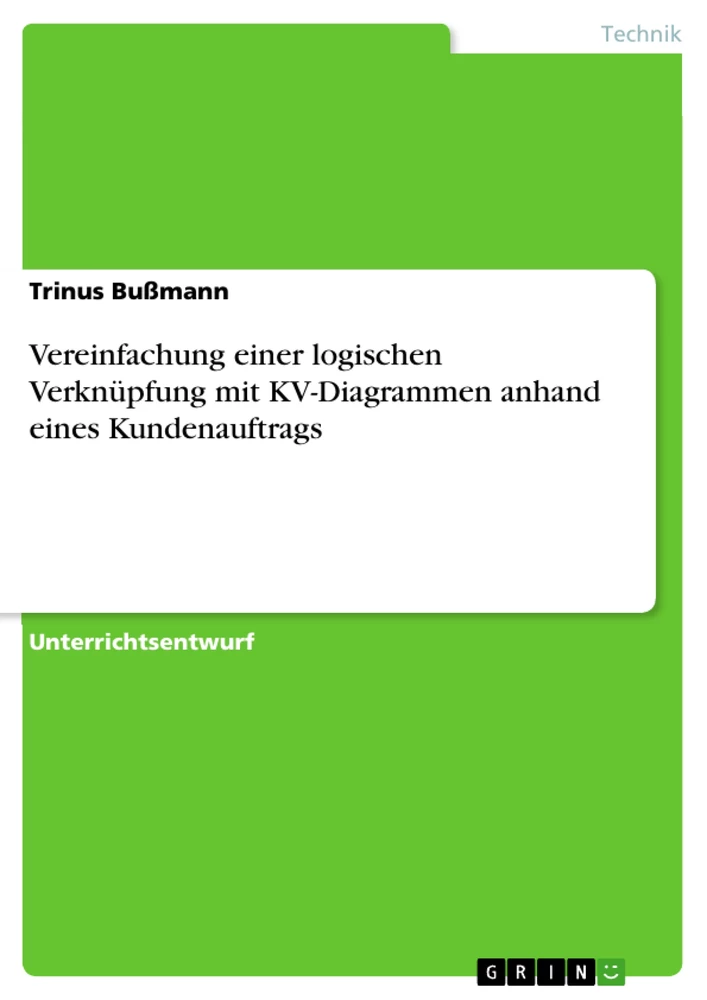1 Analyse des Bedingungsfeldes
1.1 Angaben zur Lerngruppe
Die x ist eine geteilte Klasse. Elf Schülerinnen und Schüler absolvieren eine einjährige Vollzeitschulform Berufsfachschule Mechatronik. Die Berufsfachstufe vermittelt eine theoretisch-fachliche und allgemeine Ausbildung. Zudem wird eine praktische Ausbildung von 160 Zeitstunden durchgeführt. Mit dem erworbenen Abschluss ist der Eintritt in die Fachstufe einer Berufsausbildung möglich. Der erweiterte Sekundarabschluss I kann mit einem bestimmten Gesamtnotendurchschnitt erworben werden.
Neun Schüler absolvieren die Berufsschule Mechatronik in Teilzeitform. Sie sind zwei Tage die Woche in der Berufsschule und drei Tage im Betrieb.
An der heutigen Stunde nehmen die elf Schülerinnen und Schüler der Vollzeitschulform teil, da die anderen Schüler im Ausbildungsbetrieb sind. Aus diesem Grund nehme ich auch nur auf diese Schülerinnen und Schüler Bezug. Der heutige Teil der Klasse besteht aus sechs Schülerinnen und fünf Schülern. Die Altersstruktur ist als heterogen zu bezeichnen. Dies spiegelt sich auch im Leistungsvermögen der S. (Schüler) wieder (vgl. Anlage VI).
S. wie z.B. x verfolgen den Unterricht aufmerksam und hinterfragen Themenabschnitte. Sie weisen eine Vielzahl von guten Wortbeiträgen auf und treiben die Gruppenarbeiten voran. Andere S. wie z.B. x beteiligen sich kaum eigeninitiativ am Unterricht.
Die geringe Klassenstärke ermöglicht eine gute Beobachtung und Betreuung der einzelnen S..
[...]
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Analyse des Bedingungsfeldes
- Angaben zur Lerngruppe
- Kompetenzen der Lerngruppe
- Der Referendar
- Organisatorische Rahmenbedingungen
- Didaktisch-methodische Konzeption
- Didaktische Überlegungen
- Analyse der curricularen Vorgaben
- Analyse der Thematik
- Auswahl- und Reduktionsentscheidungen
- Methodische Konzeption
- Makrostruktur
- Mikrostruktur
- Lern- und Handlungsziele/Kompetenzen
- Lernerfolgskontrolle
- Anlagen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Der Unterrichtsentwurf fokussiert auf die Vereinfachung einer logischen Verknüpfung mithilfe von KV-Diagrammen, basierend auf einem Kundenauftrag. Ziel ist es, die Schülerinnen und Schüler mit der Anwendung von KV-Diagrammen zur Optimierung logischer Schaltungen vertraut zu machen, um den Einsatz von Bauteilen zu minimieren und die Effizienz zu maximieren.
- Einführung in die KV-Diagramme als Werkzeug zur Vereinfachung logischer Verknüpfungen
- Analyse und Anwendung der Schaltalgebra und der de morganschen Gesetze zur Optimierung logischer Schaltungen
- Entwicklung eines praktischen Verständnisses für die Anwendung von KV-Diagrammen anhand eines Kundenauftrags
- Bedeutung von KV-Diagrammen für die praktische Anwendung in der Automatisierungstechnik
- Verknüpfung von theoretischen Konzepten mit praktischen Beispielen aus der industriellen Anwendung
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Der erste Abschnitt, "Analyse des Bedingungsfeldes", beschreibt die Lerngruppe und deren Kompetenzen, den Referendar und seine Kompetenzen, sowie die organisatorischen Rahmenbedingungen. Die "Didaktisch-methodische Konzeption" analysiert die curricularen Vorgaben und die Thematik der Vereinfachung logischer Verknüpfungen mit KV-Diagrammen. Darüber hinaus stellt sie die methodischen Konzepte für die Unterrichtsgestaltung vor, wie z.B. die Makrostruktur und die Mikrostruktur des Unterrichts.
Schlüsselwörter (Keywords)
Schlüsselwörter sind: KV-Diagramme, logische Verknüpfungen, Schaltalgebra, de morgansche Gesetze, Automatisierungstechnik, Steuerungstechnik, Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), Kundenauftrag, Lernfeld 4, Berufsfachschule Mechatronik.
Häufig gestellte Fragen
Wofür werden KV-Diagramme in der Mechatronik verwendet?
KV-Diagramme (Karnaugh-Veitch-Diagramme) dienen zur Vereinfachung und Optimierung logischer Verknüpfungen, um die Anzahl der benötigten Bauteile in Schaltungen zu minimieren.
Welche Rolle spielen die de morganschen Gesetze?
Diese Gesetze sind grundlegend für die Umformung und Vereinfachung logischer Ausdrücke in der Schaltalgebra, was die Basis für die Arbeit mit KV-Diagrammen bildet.
In welchem Lernfeld wird dieses Thema unterrichtet?
Das Thema ist im Lernfeld 4 der Berufsfachschule Mechatronik angesiedelt, das sich mit Steuerungstechnik und Automatisierung befasst.
Was ist das Ziel der Lernerfolgskontrolle in diesem Entwurf?
Die Schüler sollen nachweisen, dass sie einen realen Kundenauftrag analysieren und eine effiziente logische Steuerung mittels KV-Diagrammen entwerfen können.
Welche Bedeutung hat die Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) hierbei?
Die theoretische Vereinfachung der Logik ist die Voraussetzung für die effiziente Programmierung von SPS-Systemen in der industriellen Anwendung.
- Arbeit zitieren
- Dipl. Ing, Master of Education Trinus Bußmann (Autor:in), 2011, Vereinfachung einer logischen Verknüpfung mit KV-Diagrammen anhand eines Kundenauftrags, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168252