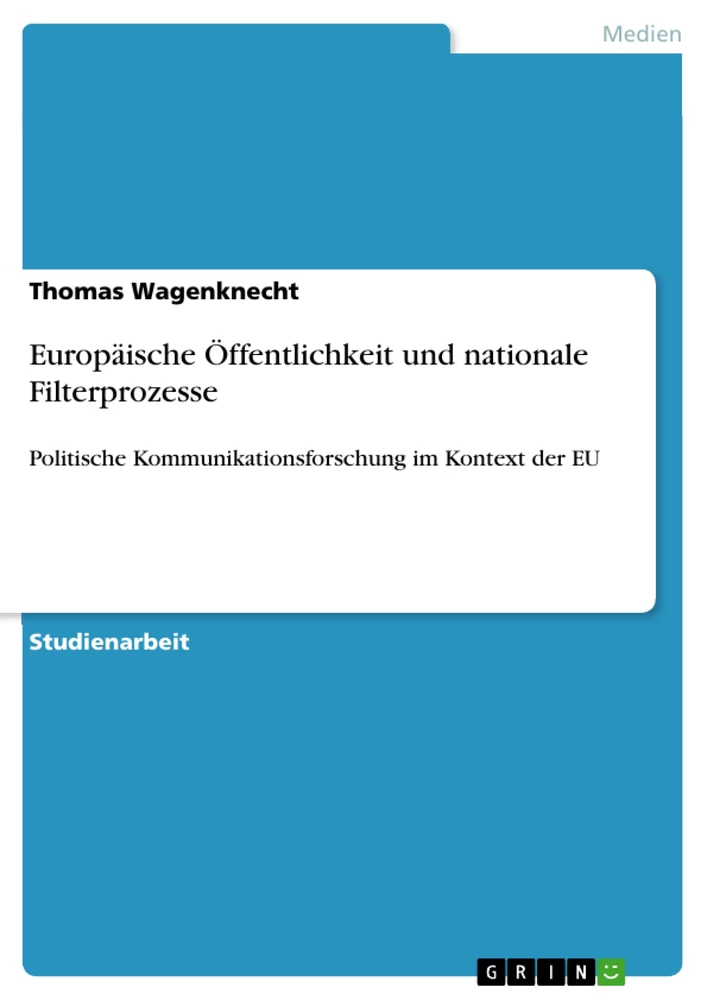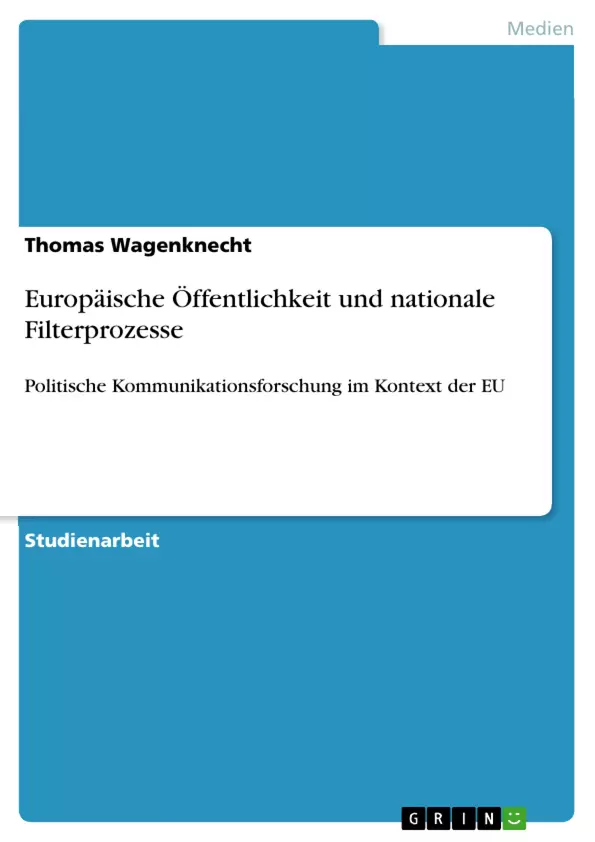Die Europäisierung macht keinen Halt vor den Medien. Doch wie genau vollzieht sich die zunehmende Vereinnahmung von Politik und Wirtschaft durch die Europäische Union? Was geschieht mit der Tageszeitung, welche Themen werden gesetzt und welche Akteure finden darin Platz? Und vor allem, wie wird die EU dargestellt? Bleibt überhaupt Raum für Diskussionen, wird alles nur zerredet oder gar alles schön gefärbt?
Auf diese und weitere Fragen gibt Silke Adam in ihrer Dissertationsschrift „Symbolische Netzwerke in Europa: der Einfluss der nationalen Ebene auf europäische Öffentlichkeit“ eine Antwort, indem sie die Debatten um eine europäische Verfassung und die mögliche Osterweiterung in Deutschland und Frankreich vergleicht.
Durch die Ergebnisse von anderen Studien ist bereits bekannt, dass Europäisierung enorm vom nationalen Kontext abhängt. Umso mehr untersucht die vorliegende Arbeit deshalb, wie die nationalstaatliche Ebene Einfluss auf die Konstitution einer europäischen Öffentlichkeit ausübt. Sie setzt sich daher dezidiert mit dem Aspekt „Europäisierung trotz nationaler Filterprozesse“ der Studie auseinandersetzen und gibt dazu einen Einblick in den derzeitigen Stand der Forschung. Anschließend wird der Aufbau der Studie von Adam beschrieben und deren Ergebnisse ausgewertet, um dann mit einer kritischen Auseinandersetzung mit diesen und dem gesamten Konzept abzuschließen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- 1. Theorie
- 2. Forschungsstand
- 3. Aufbau der Studie
- 4. Europäisierung trotz nationaler Filterprozesse
- 4.1 Sichtbarkeit
- 4.2 Interaktionsstrukturen
- 4.3 Disputkonstellationen
- 5. Fazit und Kritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Dissertationsschrift "Symbolische Netzwerke in Europa: der Einfluss der nationalen Ebene auf europäische Öffentlichkeit" von Silke Adam analysiert, wie nationale Filterprozesse die Konstitution einer europäischen Öffentlichkeit beeinflussen. Die Arbeit untersucht die Debatten um eine europäische Verfassung und die mögliche Osterweiterung in Deutschland und Frankreich, um die Wirkungsweise dieser Prozesse zu verstehen.
- Der Einfluss nationaler Filterprozesse auf die Europäisierung der öffentlichen Meinung
- Die Rolle von Medien in der Gestaltung und Vermittlung europäischer Themen
- Die Herausforderungen und Möglichkeiten der Entwicklung einer europäischen Öffentlichkeit
- Die Bedeutung von Interaktionsstrukturen und Disputkonstellationen in der europäischen Öffentlichkeit
- Die Frage nach der Synchronität und Vernetzung nationaler Debatten im europäischen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz der Arbeit im Kontext der Europäischen Union und der Herausforderungen der Europäisierung dar. Sie führt in die Thematik der nationalstaatlichen Filterprozesse ein und erläutert den Forschungsgegenstand der Dissertationsschrift.
1. Theorie: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse der europäischen Öffentlichkeit. Es diskutiert verschiedene Konzepte und Theorien, wie die supranationale und die europäisierte nationale Öffentlichkeit, und stellt das Modell der Netzwerk themen- und ereigniszentrierten Teilöffentlichkeiten vor.
2. Forschungsstand: Kapitel 2 gibt einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zum Thema der europäischen Öffentlichkeit. Es beleuchtet die Ergebnisse relevanter Studien und zeigt die Bedeutung der nationalen Ebene für die Europäisierung von Debatten.
3. Aufbau der Studie: Dieses Kapitel beschreibt den methodischen Ansatz der Studie und erläutert die verwendeten Daten und Analysemethoden.
4. Europäisierung trotz nationaler Filterprozesse: Das vierte Kapitel ist das Kernstück der Arbeit und präsentiert die Ergebnisse der Studie. Es analysiert die Debatten um eine europäische Verfassung und die mögliche Osterweiterung in Deutschland und Frankreich, um die Wirkungsweise der nationalen Filterprozesse zu untersuchen. Hierbei werden die Dimensionen Sichtbarkeit, Interaktionsstrukturen und Disputkonstellationen betrachtet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Europäische Öffentlichkeit, nationale Filterprozesse, Europäisierung, Medien, Interaktionsstrukturen, Disputkonstellationen, Sichtbarkeit, Synchronität, Vernetzung, Medienevents, nationale Debatten, europäische Verfassung, Osterweiterung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine "europäische Öffentlichkeit"?
Es beschreibt einen Kommunikationsraum, in dem europäische Themen länderübergreifend und gleichzeitig in den nationalen Medien diskutiert werden.
Was sind "nationale Filterprozesse"?
Dies bedeutet, dass europäische Themen in jedem Land durch die Brille nationaler Interessen, Akteure und Traditionen interpretiert und "gefiltert" werden.
Welche Fallbeispiele untersuchte Silke Adam in ihrer Studie?
Sie verglich die Debatten um die europäische Verfassung und die EU-Osterweiterung in Deutschland und Frankreich.
Welche Rolle spielen die Medien bei der Europäisierung?
Medien entscheiden darüber, welche europäischen Themen sichtbar werden und wie diese gerahmt (Framing) werden, was die öffentliche Meinung maßgeblich beeinflusst.
Gibt es trotz nationaler Filter eine gemeinsame europäische Debatte?
Ja, die Studie zeigt, dass eine Europäisierung trotz nationaler Unterschiede stattfindet, wenn Themen gleichzeitig und mit ähnlichen Interaktionsstrukturen behandelt werden.
- Arbeit zitieren
- Thomas Wagenknecht (Autor:in), 2010, Europäische Öffentlichkeit und nationale Filterprozesse, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168254