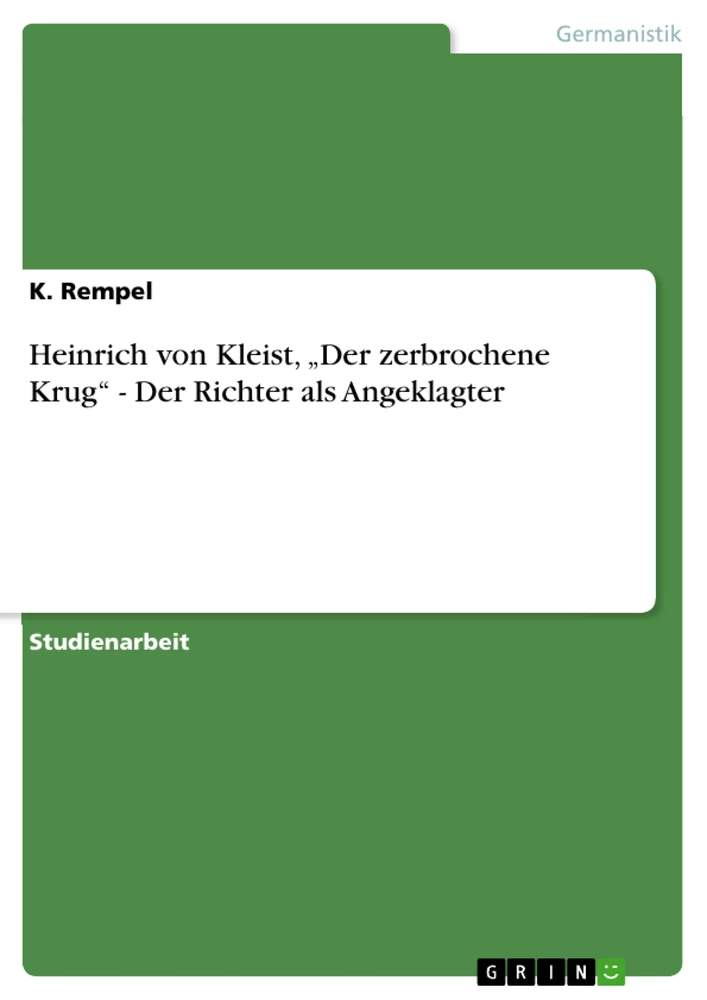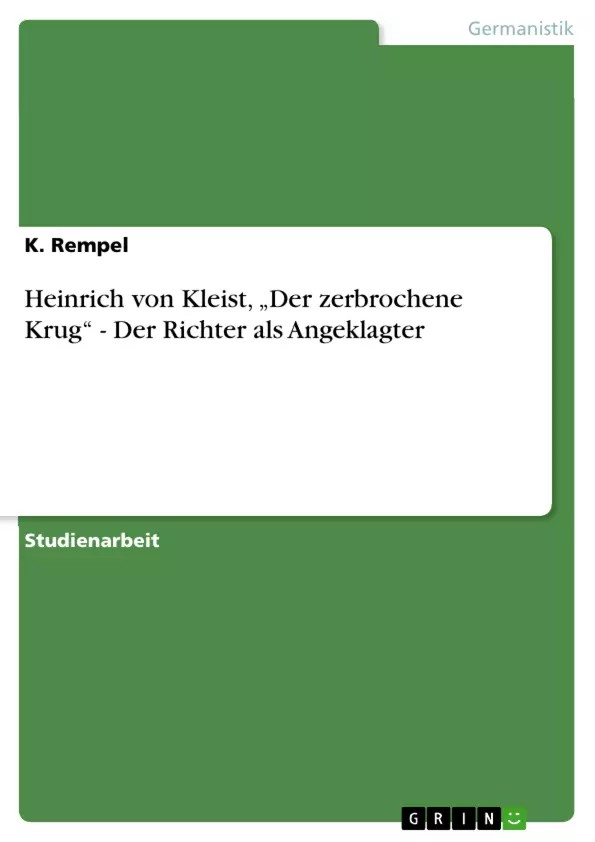In meiner Hausarbeit beschäftige ich mich mit dem Drama „Der zerbrochene Krug“ von Heinrich von Kleist. Dabei gehe ich im Besonderen auf die Figur des Dorfrichters Adam ein. Nach einer kurzen Darlegung der Adam-Handlung werde ich mich im ersten Teil meiner Arbeit mit den philosophischen Problemen, die Adams Persönlichkeit aufwirft, auseinandersetzen. Darunter fällt ein Vergleich von Kleists Wahrheitsbegriff mit dem Nietzsches. Der Anlass dieses Vergleichs mag zunächst unklar erscheinen, da beide weder Zeitgenossen sind noch Nietzsche als ein besonderer Rezipient Kleists gilt, wird in meinen Ausführungen aber genauer erläutert. Weiterhin philosophisch orientiert werde ich mich mit dem Begriff der Willkür in Hinblick auf Adams Handeln beschäftigen und diesen dem Vergleich mit Hobbes‘ Philosophie unterziehen.
Im zweiten Teil meiner Arbeit beschäftige ich mich mit der Sprachgestaltung des Dramas, mit einem besonderen Hinblick auf die Äußerungen Adams. Nahe liegend erscheint mir da zunächst der Vergleich mit Kleists 1805 entstandenen Essay „Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden“, da er in sehr vielen Punkten mit Adams Verhalten übereinstimmt. Des Weiteren setze ich mich im allgemeinen mit der Art der Sprache im Drama auseinander, um dann im Speziellen auf den Dorfrichter einzugehen, zu dessen Besonderheiten unter anderem seine schroffe Emotionalität und seine Selbstgespräche zählen. Abschließend vergleiche ich die Philosophie Nietzsches mit den Äußerungen Adams, dieses Mal aber hinsichtlich der Spachkritik und stelle Gemeinsamkeiten heraus.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Richter als Angeklagter
- Die Handlungsstruktur im Drama
- Der Wahrheitsbegriff Kleists im Vergleich zu dem Nietzsches
- Die Willkür Adams und Hobbes' - ein philosophischer Vergleich
- Die Sprachgestaltung
- Ein Vergleich mit „Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden“
- Die Art der Sprache im „Zerbrochenen Krug“, im Besonderen die Adams
- Eine Anknüpfung an Nietzsches Sprachkritik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert Heinrich von Kleists Drama „Der zerbrochene Krug“ mit Fokus auf die Figur des Dorfrichters Adam. Die Arbeit untersucht die philosophischen Implikationen von Adams Persönlichkeit, insbesondere im Kontext des Wahrheitsbegriffs bei Kleist und Nietzsche. Darüber hinaus werden die Willkür in Adams Handeln und die Sprachgestaltung des Dramas im Vergleich zu Kleists Essay „Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden“ und Nietzsches Sprachkritik betrachtet.
- Philosophische Aspekte der Figur des Dorfrichters Adam
- Vergleich des Wahrheitsbegriffs bei Kleist und Nietzsche
- Analyse der Willkür in Adams Handeln im Kontext der Philosophie Hobbes
- Sprachgestaltung im Drama „Der zerbrochene Krug“
- Vergleich der Sprachkritik Nietzsches mit den Äußerungen Adams
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Hausarbeit vor und erläutert den Fokus auf die Figur des Dorfrichters Adam. Sie gibt einen Überblick über die Struktur der Arbeit und die behandelten Themen.
Das erste Kapitel analysiert die Handlungsstruktur des Dramas. Es beleuchtet die zentrale Rolle des Richters als Angeklagter und die Vertauschung von Rollen im Prozess. Die Kapitel diskutieren Adams Versuche, die Wahrheit zu verschleiern, und die absurde Natur des Gerichtsverfahrens.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Sprachgestaltung des Dramas, insbesondere mit den Äußerungen Adams. Es vergleicht die Sprache des Dramas mit Kleists Essay „Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden“ und analysiert die sprachlichen Besonderheiten Adams, wie seine Emotionalität und Selbstgespräche.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Hausarbeit sind „Der zerbrochene Krug“, Heinrich von Kleist, Dorfrichter Adam, Wahrheitsbegriff, Nietzsche, Sprachgestaltung, Willkür, Hobbes, „Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden“, Sprachkritik.
- Arbeit zitieren
- K. Rempel (Autor:in), 2006, Heinrich von Kleist, „Der zerbrochene Krug“ - Der Richter als Angeklagter, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168428