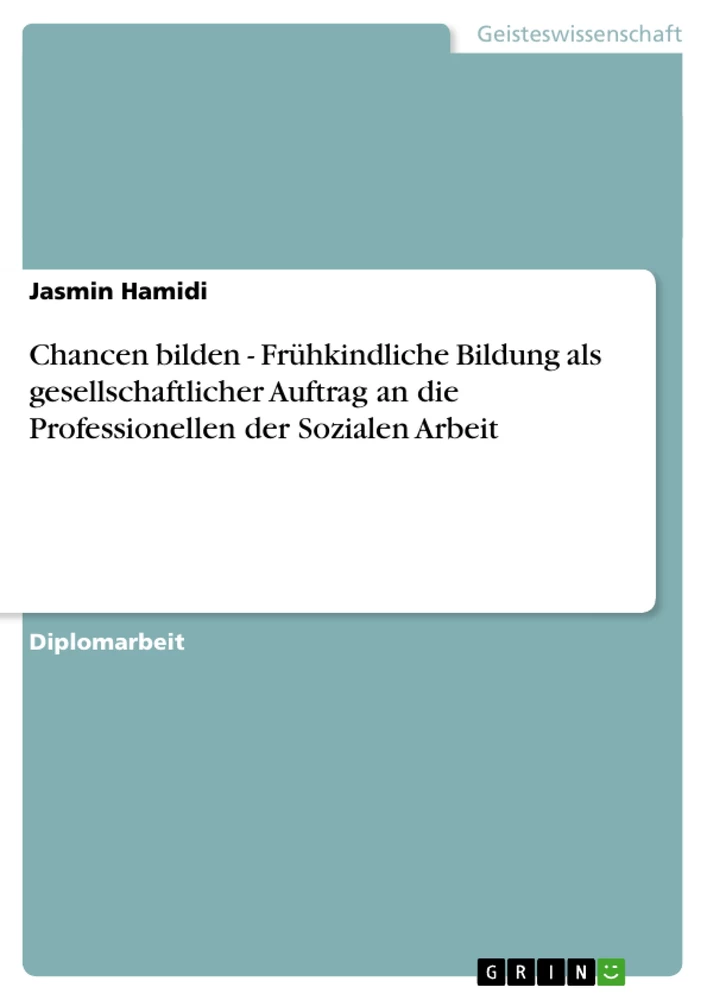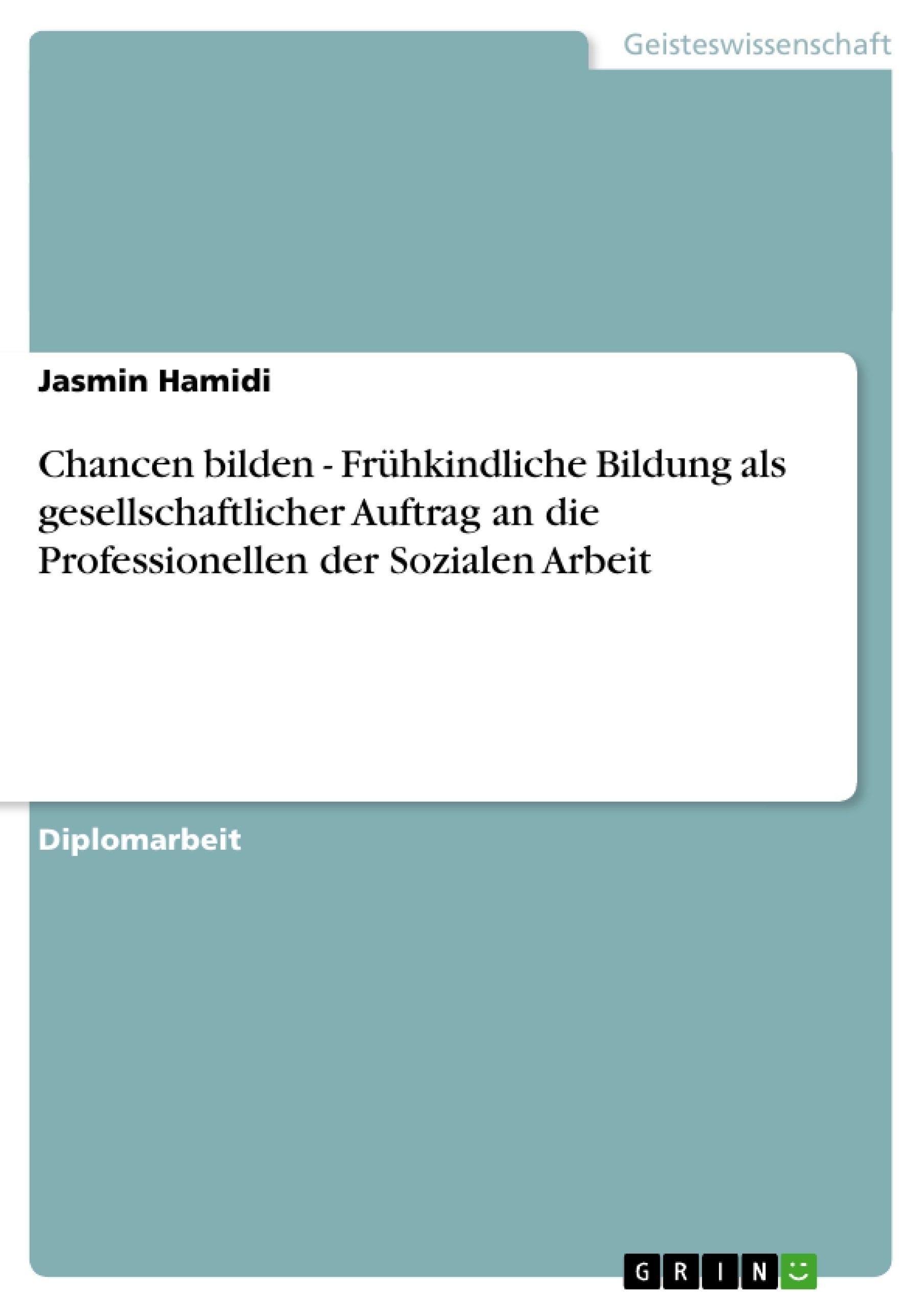In der vorliegenden Arbeit beschäftige ich mich mit der Frage, wie sich Soziale Arbeit an frühkindlichen Bildungsprozessen beteiligen kann und in wieweit sie sogar dazu verpflichtet ist, Benachteiligungen in diesem Bereich entgegenzuwirken.
Eigene Berufserfahrungen als Erzieherin habe ich u.a. in einer Einrichtung gesammelt, die Kinder frühzeitig integrativ fördert. Immer wieder fand ich mich - wenn ich von meiner Arbeit erzählte - in Diskussionen über den Sinn und Zweck von früher Förderung wieder. „Elitebildung“ war da oft zu hören und von übertriebenem Ehrgeiz der Eltern war die Rede. Frühkindliche Bildung schien eine zu früh einsetzende Maßnahme zu sein, die die unbeschwerte Welt des Kindes zerstörte. Selbst im Rahmen meines Studiums zur Sozialpädagogin/ Sozialarbeiterin erlebte ich, dass frühkindliche Förderung etwas Neues und Innovatives zu sein schien. Ein Dozent der Fachhochschule Hannover gab mir zu verstehen, dass diese Thematik wenig mit meinem Studium zu tun hätte.
Mir persönlich war die Wichtigkeit von frühkindlicher Bildung schon lange bewusst, ist das menschliche Gehirn doch nie mehr so plastisch wie in den ersten drei Lebensjahren.
Das Ziel meiner Diplomarbeit ist daher, aktuelle Forschungsergebnisse
zusammenzutragen und daraus neue pädagogische Ansätze und Methoden zu
entwickeln. Vor allem möchte ich die Handlungslegitimation von Sozialer Arbeit an frühkindlichen Bildungsprozessen belegen und Handlungsfelder benennen.
„Bildung ist (...) ein aktiver, komplexer und nie abgeschlossener Prozess, in dessen glücklichem Verlauf eine selbstständige und selbsttätige, problemlösungsfähige und lebenstüchtige Persönlichkeit entstehen kann.“1
Ich beginne damit, den Bildungsbegriff im historischen Kontext zu betrachten. Indem ich den Bezug zur Gegenwart herstelle, werde ich zu einer Definition kommen, die Ausgangspunkt für Bildungsanforderungen wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Erziehung und Bildung – formen oder befähigen?
- 3. Neue Herausforderungen in einer sich wandelnden Gesellschaft
- 3.1. Ein Blick auf unser defizitäres Bildungssystem
- 4. Frühkindliche Bildung
- 4.1. Die Entwicklung des menschlichen Gehirns
- 4.2. Lern- und Bildungsprozesse in der frühen Kindheit
- 4.2.1. Der kompetente, wählende und aktive Säugling
- 4.2.2. Wahrnehmung
- 4.3. Übergeordnete Bildungsziele am Beispiel der zwölf Empfehlungen des „Forum Bildung“
- 5. Die Kinder- und Jugendhilfe vor neuen Aufgaben
- 5.1. Die Soziale Arbeit als Handlungsinstrument der Kinder- und Jugendhilfe
- 6. Die Familie als Bildungsort
- 6.1. Familienergänzende Angebote der Kinder- und Jugendhilfe
- 7. Kindertageseinrichtungen als Bildungsinsitutionen
- 7.1. Bildungsziele für den frühkindlichen Bereich am Beispiel des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans
- 7.2. Das Neue Verständnis vom Kind
- 7.3. Handlungsansätze und Methoden zur Unterstützung frühkindlicher Lern- und Bildungsprozesse
- 7.3.1. Der metakognitive Ansatz
- 7.3.2. Der projektorientierte Ansatz
- 7.3.3. Die Projektarbeit
- 7.3.4. Die Reflexion von kindlichen Bildungsprozessen
- 7.3.5. Die lösungsorientierte Gesprächsführung
- 7.4. Neue Herausforderungen für pädagogische Fachkräfte
- 7.5. Die Qualitätssicherung von Kindertageseinrichtungen
- 7.5.1. Leitung einer Kindertageseinrichtung
- 8. Ausblick auf weitere sozialarbeiterische Handlungsfelder
- 8.1. Soziale Frühwarnsysteme
- 8.2. Kompetenznetzwerke
- 9. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Frage, wie Soziale Arbeit an frühkindlichen Bildungsprozessen beteiligt werden kann und inwieweit sie dazu verpflichtet ist, Benachteiligungen in diesem Bereich entgegenzuwirken. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung von frühkindlicher Bildung im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen und der Herausforderungen, die sich daraus für die Soziale Arbeit ergeben.
- Die Bedeutung frühkindlicher Bildung für die Entwicklung des Menschen
- Die Rolle der Sozialen Arbeit in der frühkindlichen Bildung
- Die Förderung von Chancengleichheit und die Bekämpfung von Benachteiligungen
- Die Herausforderungen und Chancen der frühkindlichen Bildung in einer sich wandelnden Gesellschaft
- Handlungsfelder der Sozialen Arbeit in der frühkindlichen Bildung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung und die Zielsetzung der Arbeit dar. Sie beleuchtet die Relevanz von frühkindlicher Bildung und die Notwendigkeit, Benachteiligungen in diesem Bereich entgegenzuwirken.
Kapitel 2 befasst sich mit dem Bildungsbegriff im historischen Kontext und entwickelt eine Definition von Bildung, die als Ausgangspunkt für Bildungsanforderungen dient.
Kapitel 3 analysiert die Herausforderungen, die sich aus der sich wandelnden Gesellschaft für Bildung und Soziale Arbeit ergeben. Es wird auf die Defizite des Bildungssystems und die Folgen für Kinder aus Risikofamilien eingegangen.
Kapitel 4 beleuchtet die Bedeutung von frühkindlicher Bildung für die Entwicklung des Menschen. Es wird auf die Entwicklung des menschlichen Gehirns, Lern- und Bildungsprozesse in der frühen Kindheit sowie übergeordnete Bildungsziele eingegangen.
Kapitel 5 thematisiert die Rolle der Kinder- und Jugendhilfe und der Sozialen Arbeit als Handlungsinstrument in diesem Bereich.
Kapitel 6 betrachtet die Familie als Bildungsort und stellt familienergänzende Angebote der Kinder- und Jugendhilfe vor.
Kapitel 7 fokussiert auf Kindertageseinrichtungen als Bildungsinstitutionen. Es werden Bildungsziele, das neue Verständnis vom Kind und Handlungsansätze zur Unterstützung frühkindlicher Lern- und Bildungsprozesse erläutert.
Kapitel 8 gibt einen Ausblick auf weitere sozialarbeiterische Handlungsfelder im Bereich der frühkindlichen Bildung, wie soziale Frühwarnsysteme und Kompetenznetzwerke.
Schlüsselwörter
Frühkindliche Bildung, Soziale Arbeit, Chancengleichheit, Benachteiligung, Bildungssystem, Kinder- und Jugendhilfe, Kindertageseinrichtung, Handlungsfelder, Familien, Bildungsziele, Lernprozesse, Entwicklung, Gesellschaft, Strukturwandel.
- Citation du texte
- Jasmin Hamidi (Auteur), 2006, Chancen bilden - Frühkindliche Bildung als gesellschaftlicher Auftrag an die Professionellen der Sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168460