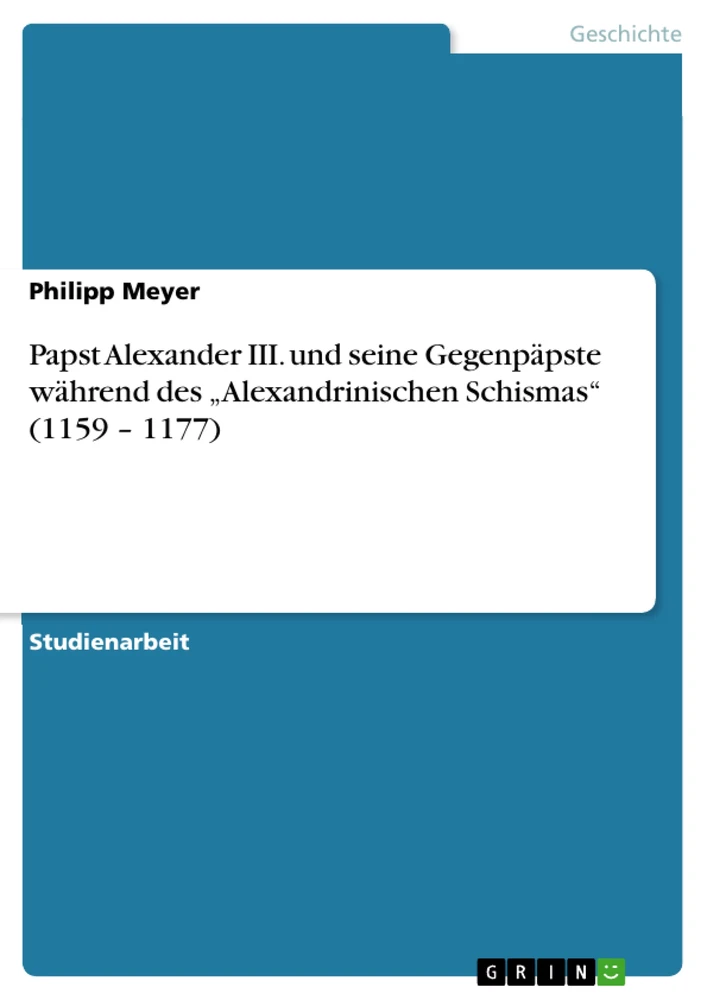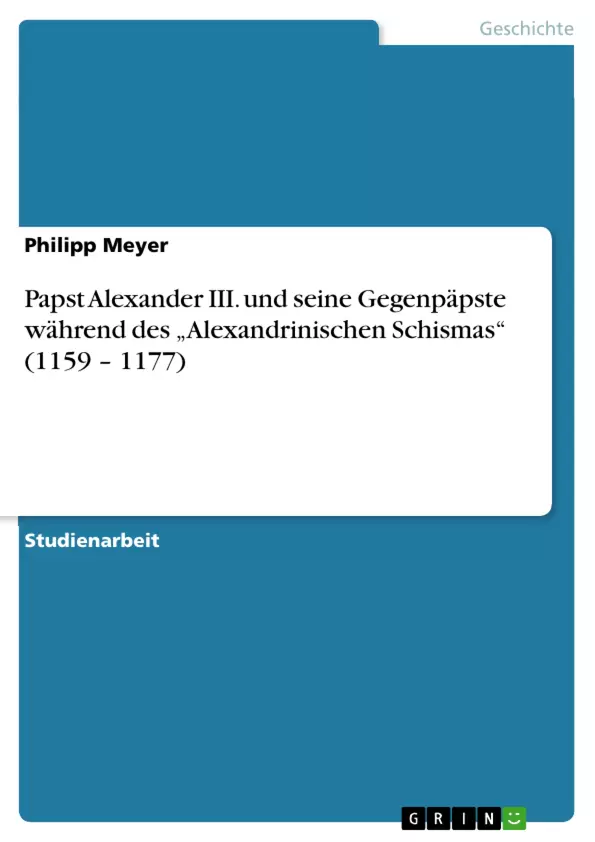Die Arbeit behandelt die Geschichte des Papsttums während Alexandrinischen Schismas 1159-1177 mit besonderem Schwerpunkt auf den Handlungen des Kaisers.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Vorgeschichte des Schismas
- 2.1. Der Vertrag von Benevent 1156 als Ausgangspunkt der Kirchenspaltung
- 2.2. Der Hoftag von Besançon 1157
- 2.3. Die endgültige Spaltung des Kardinalkollegiums und der Tod Hadrians IV.
- 3. Die Doppelwahl von 1159 und der Ausbruch des Schismas
- 3.1. Zur Person Alexanders III.
- 3.2. Zur Person Viktors IV.
- 4. Die Verfestigung des Schismas auf der Synode von Pavia 1160
- 5. Die Hochphase des Schismas
- 5.1. Die Konziliarphase bis zum Tode Viktors IV.
- 5.2. Die umstrittene Erhebung Paschalis III. und die Würzburger Eide
- 5.3. Verbesserung der Position Alexanders III.
- 6. Der Weg zum Frieden: Die Ereignisse während des Gegenpontifikats von Calixts III.
- 6.1. Vage Annäherungen nach dem Tod Paschalis III.
- 6.2. Von Anagni nach Venedig
- 6.3. Das Ende des Schismas mit dem Frieden von Venedig 1177
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das sogenannte „Alexandrinische Schisma“ (1159-1177), welches die römisch-katholische Kirche spaltete. Das Hauptziel besteht darin, die Vorgeschichte des Schismas zu beleuchten und die Konfliktparteien, insbesondere Papst Alexander III. und seine Gegenpäpste, zu analysieren. Die Arbeit stützt sich dabei auf historische Quellen und Sekundärliteratur.
- Der Vertrag von Benevent (1156) und seine Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen Papsttum und Kaisertum.
- Die Doppelwahl von 1159 und die damit verbundene Vertiefung des Konflikts.
- Die Rolle der Synoden und Konzilien während des Schismas.
- Die Persönlichkeiten der beteiligten Päpste und Gegenpäpste.
- Der Weg zur Beilegung des Schismas durch den Frieden von Venedig (1177).
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung definiert den Begriff „Schisma“ im kirchengeschichtlichen Kontext und beschreibt das „Alexandrinische Schisma“ als einen zentralen Konflikt zwischen Papst Alexander III. und mehreren Gegenpäpsten. Sie hebt die Bedeutung des Vertrags von Benevent (1156) und des Hoftages von Besançon (1157) als prägende Ereignisse der Vorgeschichte hervor und skizziert den Verlauf des Schismas bis zu dessen Beilegung im Jahr 1177. Der Fokus der Arbeit wird auf die Darstellung der Vorgeschichte und die Beleuchtung der Konfliktparteien gelegt.
2. Die Vorgeschichte des Schismas: Dieses Kapitel analysiert die Ereignisse, die zum Schisma führten. Der Vertrag von Benevent (1156) wird als ein Wendepunkt in der normannischen Politik des Papsttums beschrieben, der zu einer Spaltung innerhalb des Kardinalkollegiums führte. Der Hoftag von Besançon (1157) verschärfte den Konflikt mit dem Kaiserreich weiter. Das Kapitel beleuchtet die verschiedenen politischen und religiösen Faktoren, die zur Eskalation der Situation beitrugen und die Vorgeschichte des Schismas prägten. Es zeigt die sich formierenden Fraktionen innerhalb der Kurie auf und unterstreicht die wachsende Kluft zwischen Papsttum und Kaiserreich.
3. Die Doppelwahl von 1159 und der Ausbruch des Schismas: Dieses Kapitel befasst sich mit der Doppelwahl des Jahres 1159, die als unmittelbarer Auslöser des Schismas gilt. Es werden die Persönlichkeiten von Papst Alexander III. und seinem Gegenpapst Viktor IV. vorgestellt und deren jeweilige Positionen und Strategien analysiert. Die Kapitel beleuchtet die komplexen Machtverhältnisse innerhalb der Kirche und die Reaktionen der verschiedenen politischen Akteure auf die Spaltung. Die unterschiedlichen Legitimitätsansprüche der beiden Päpste und ihre Versuche, ihre Position zu festigen, werden eingehend untersucht.
4. Die Verfestigung des Schismas auf der Synode von Pavia 1160: Das Kapitel beschreibt die Synode von Pavia (1160) und ihre Bedeutung für die Verfestigung des Schismas. Die Synode stellt einen Wendepunkt im Konflikt dar, indem sie die Spaltung institutionalisierte und die Position des Gegenpapstes stärkte. Das Kapitel analysiert die Entscheidungen der Synode, die Maßnahmen zur Festigung der Gegenpapst-Fraktion und die politischen Implikationen dieser Entwicklung für die weitere Verlauf des Schismas.
5. Die Hochphase des Schismas: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung des Schismas während seiner Hochphase. Es beschreibt die Rolle der Konzilien, die Auseinandersetzung zwischen Alexander III. und seinen Gegenpäpsten, Viktor IV. und Paschalis III., und die Verschiebungen im Kräfteverhältnis. Das Kapitel beleuchtet die strategischen Entscheidungen der beteiligten Akteure, ihre Versuche, Unterstützung zu gewinnen, und den Einfluss der politischen Ereignisse auf den Verlauf des Schismas. Die Verbesserung der Position Alexanders III. im Laufe der Zeit wird detailliert analysiert.
6. Der Weg zum Frieden: Die Ereignisse während des Gegenpontifikats von Calixts III.: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Ereignisse, die letztendlich zur Beilegung des Schismas führten. Es beschreibt die Annäherungsversuche nach dem Tod Paschalis III. und die entscheidende Rolle des Friedens von Venedig (1177). Der Kapitel analysiert die politischen und religiösen Faktoren, die zum Abschluss des Friedens beitrugen, und dessen Bedeutung für die Wiederherstellung der Einheit in der Kirche. Die Entwicklung von vagen Annäherungen bis zum endgültigen Frieden wird Schritt für Schritt nachgezeichnet.
Schlüsselwörter
Papst Alexander III., Gegenpäpste, Alexandrinisches Schisma (1159-1177), Vertrag von Benevent, Hoftag von Besançon, Synode von Pavia, Frieden von Venedig, Kaisertum, Papsttum, Investiturstreit, Kirchenpolitik, mittelalterliche Geschichte.
Häufig gestellte Fragen zum Alexandrinischen Schisma (1159-1177)
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Alexandrinische Schisma (1159-1177), einen zentralen Konflikt innerhalb der römisch-katholischen Kirche, der durch eine Doppelwahl zum Papst und anschließende Gegenpäpste gekennzeichnet war. Die Arbeit analysiert die Vorgeschichte des Schismas, die beteiligten Parteien (insbesondere Papst Alexander III. und seine Gegenpäpste), und den Weg zur Beilegung des Konflikts.
Welche Ereignisse führten zum Schisma?
Das Schisma wurde durch eine Doppelwahl im Jahr 1159 ausgelöst. Die Vorgeschichte ist jedoch komplex und umfasst den Vertrag von Benevent (1156), der die Beziehungen zwischen Papsttum und Kaisertum stark beeinflusste, und den Hoftag von Besançon (1157), der den Konflikt weiter verschärfte. Diese Ereignisse führten zu einer Spaltung innerhalb des Kardinalkollegiums und legten den Grundstein für die spätere Doppelwahl.
Wer waren die wichtigsten Akteure des Schismas?
Die Hauptfigur ist Papst Alexander III. Seine Gegenpäpste waren Viktor IV., Paschalis III. und Calixts III. Die Arbeit analysiert die Persönlichkeiten und Strategien dieser Akteure, ihre Versuche, ihre Position zu festigen und Unterstützung zu gewinnen, sowie ihre jeweiligen Legitimitätsansprüche.
Welche Rolle spielten Synoden und Konzilien während des Schismas?
Die Synode von Pavia (1160) war ein entscheidendes Ereignis, das die Spaltung weiter festigte und die Position der Gegenpäpste stärkte. Die Arbeit untersucht die Rolle verschiedener Synoden und Konzilien im Verlauf des Schismas und ihre Auswirkungen auf den Konflikt.
Wie endete das Schisma?
Das Schisma endete mit dem Frieden von Venedig im Jahr 1177. Die Arbeit beschreibt die Annäherungsversuche nach dem Tod von Paschalis III. und die entscheidenden Schritte, die zum Abschluss des Friedens führten, einschließlich der politischen und religiösen Faktoren, die dazu beitrugen.
Welche Schlüsselthemen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schlüsselthemen: Der Vertrag von Benevent und seine Auswirkungen, die Doppelwahl von 1159, die Rolle der Synoden und Konzilien, die Persönlichkeiten der Päpste und Gegenpäpste, der Weg zum Frieden von Venedig, die Beziehungen zwischen Papsttum und Kaisertum sowie die politische und religiöse Landschaft des Mittelalters.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf historische Quellen und Sekundärliteratur. Die genauen Quellen werden innerhalb der Arbeit selbst detailliert angegeben.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Die Vorgeschichte des Schismas, Die Doppelwahl von 1159 und der Ausbruch des Schismas, Die Verfestigung des Schismas auf der Synode von Pavia 1160, Die Hochphase des Schismas, Der Weg zum Frieden: Die Ereignisse während des Gegenpontifikats von Calixts III., und Fazit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Papst Alexander III., Gegenpäpste, Alexandrinisches Schisma (1159-1177), Vertrag von Benevent, Hoftag von Besançon, Synode von Pavia, Frieden von Venedig, Kaisertum, Papsttum, Investiturstreit, Kirchenpolitik, mittelalterliche Geschichte.
- Arbeit zitieren
- Philipp Meyer (Autor:in), 2009, Papst Alexander III. und seine Gegenpäpste während des „Alexandrinischen Schismas“ (1159 – 1177), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168521