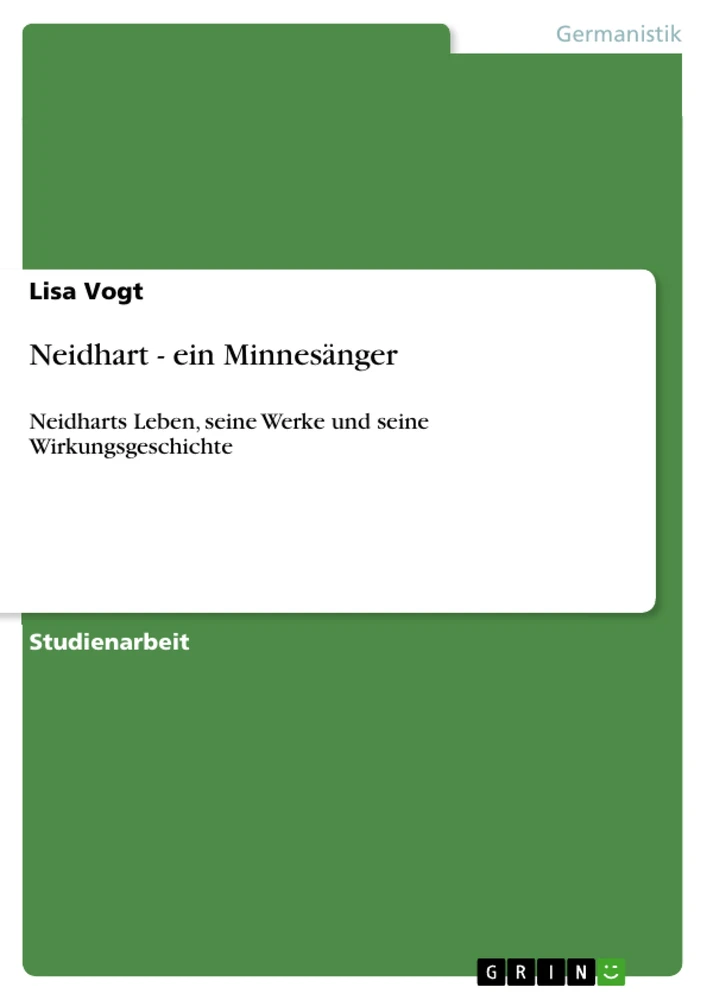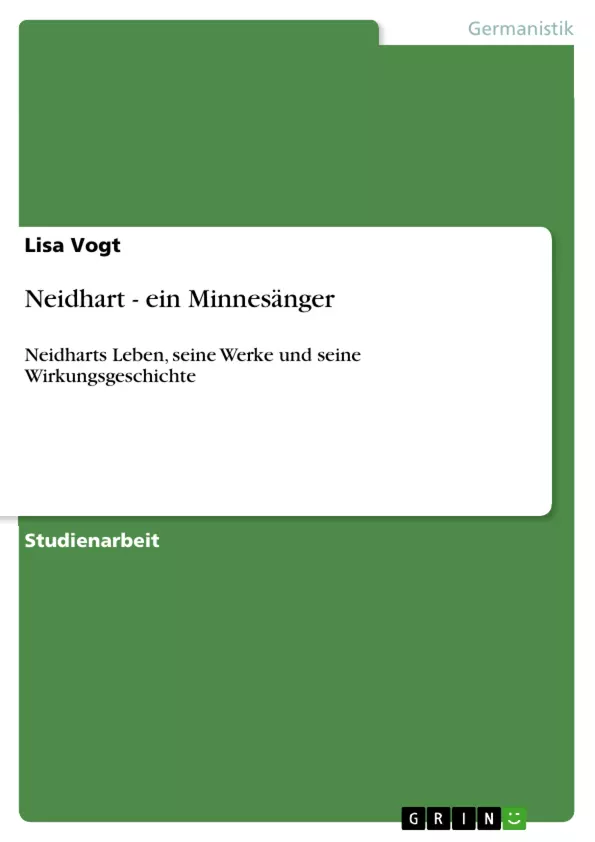Fakten über Neidhart gibt es, wie zu vielen Dichtern dieser Zeit, so gut wie keine. Urkundlich ist sein Name nirgends überliefert. Lediglich aus seinen eigenen Texten und den Erwähnungen in den Werken anderer Dichter können Rückschlüsse über seine Biografie gezogen werden.
Neidhart ist dafür bekannt, erstmals die Thematik der Bauern in die höfische Lyrik eingeführt zu haben. Seine höfische Dorfpoesie stellt einen Kontrast zur klassischen Minnelyrik dar, was ich im zweiten Kapitel noch ausführlicher schildern werde. Die offenbar beliebte Thematik sowie die hohe Zahl der überlieferten Texte und Melodien trugen zu Neidharts Berühmtheit und zu der Entwicklung einer Jahrhunderte andauernden Neidharttradition bei, die in Kapitel 4 näher beschrieben wird.
Inhaltsverzeichnis
- Neidharts Leben
- Herkunft und Wirken
- Name und Stand
- Zeitliche Einordnung in die Epoche der Minnelyrik
- Neidharts Werke
- Thematik
- Parodie der klassischen Minne
- Bauernthematik
- Andere Themen
- Form
- Literarische Herkunft
- Sommerlieder und Winterlieder
- Neidharts Lieder als Tanzlyrik
- Intentionen der Minneparodie
- Neidhart in Handschriften
- R-Block mit Codex Manesse
- c-Block
- C-Block
- Melodieaufzeichnungen
- Neidharttradition
- Schwänke und Neidhartlegende
- Neidhartspiele und andere Zeugnisse außerhalb der Handschriften
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Leben und Werk des Minnesängers Neidhart, der für seine Minneparodie und seine Einführung der Bauern in die höfische Lyrik bekannt ist. Zielsetzung ist es, Neidharts Biografie, seine Werke, deren Form und Intention sowie die spätere Neidharttradition zu analysieren und in den Kontext der Minneepoche einzuordnen.
- Neidharts Lebensweg und seine Einordnung in die Minneepoche
- Die satirische Parodie der klassischen Minne in Neidharts Werken
- Die Bedeutung der Bauern in Neidharts Lyrik und ihre Rolle in der höfischen Dorfpoesie
- Neidharts Werke als Tanzlyrik und ihre Überlieferung in Handschriften und Melodien
- Der Einfluss Neidharts auf die spätere Literatur und die Entwicklung der Neidharttradition
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit Neidharts Leben. Es beleuchtet seine Herkunft, seinen Wirkungsbereich, seinen Stand und seine zeitliche Einordnung in die Minneepoche. Das zweite Kapitel analysiert Neidharts Werke, insbesondere seine Thematik, Form und Intentionen. Es untersucht die Parodie der klassischen Minne, die Bauern thematik, die Form seiner Lieder und die Musik, die dazugehörte. Im dritten Kapitel werden die Handschriften und Melodien beschrieben, in denen Neidharts Werke überliefert sind, sowie die Veränderungen und Unechtheiten, die sich im Laufe der Zeit ergeben haben. Das vierte Kapitel behandelt die Neidharttradition, insbesondere die Schwänke, die Legende von Neithart Fuchs und die Neidhartspiele.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Neidhart, Minnesang, Minneparodie, Bauern, höfische Lyrik, Tanzlyrik, Handschriften, Neidharttradition, Schwänke, Neidhartspiele, deutscher Minnesang.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Neidhart und warum ist er berühmt?
Neidhart war ein bedeutender Minnesänger des Mittelalters, der als Erster die Thematik der Bauern in die höfische Lyrik einführte.
Was unterscheidet Neidharts Lyrik vom klassischen Minnesang?
Seine "höfische Dorfpoesie" ist eine satirische Parodie der klassischen Minne und stellt der idealisierten Liebe oft derbe bäuerliche Szenen gegenüber.
Was sind Sommer- und Winterlieder?
Dies sind die zwei Hauptformen von Neidharts Liedern, die als Tanzlyrik dienten und sich thematisch an den Jahreszeiten orientierten.
In welchen Handschriften sind Neidharts Werke überliefert?
Seine Werke finden sich unter anderem im berühmten Codex Manesse sowie in den sogenannten R- und C-Blöcken der Liederhandschriften.
Was versteht man unter der "Neidharttradition"?
Es bezeichnet die jahrhundertelange Fortführung seines Stils durch andere Dichter sowie die Entstehung von Schwänken und Neidhartspielen (z.B. Neithart Fuchs).
- Quote paper
- Lisa Vogt (Author), 2008, Neidhart - ein Minnesänger, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168557