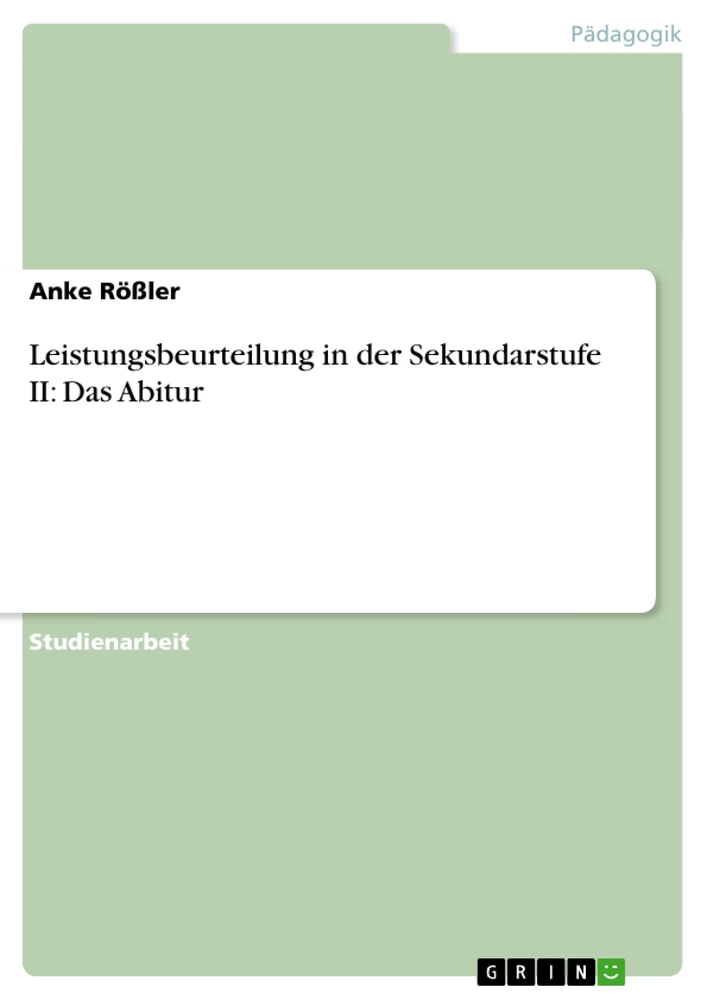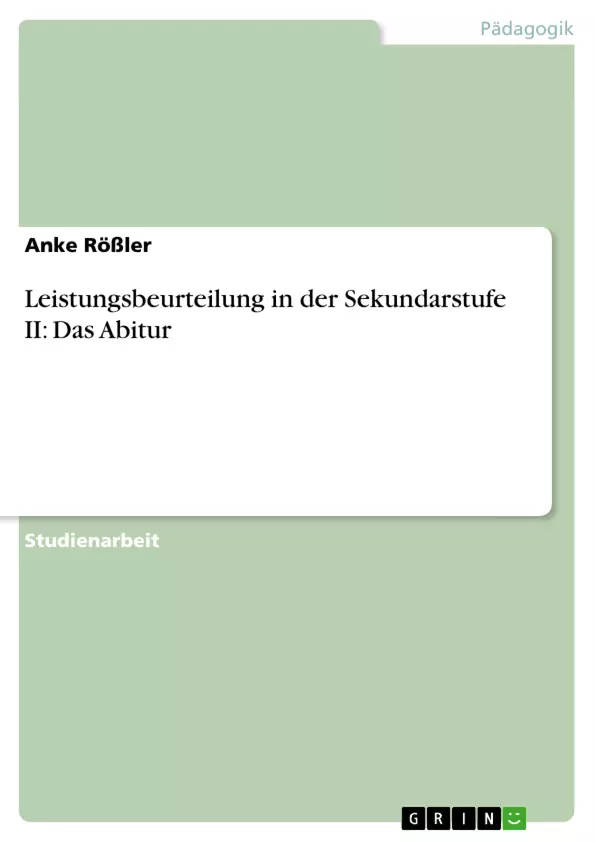Die allgemeinen Ziele des Unterrichts in der gymnasialen Oberstufe sind die vertiefte
allgemeine Bildung und der Erwerb der Studierfähigkeit. Das Abschlusszeugnis
berechtigt, ein Hochschulstudium oder eine sonstige berufliche Ausbildung
aufzunehmen1.
Beide Ziele stehen in Deutschland seit Jahren in der Kritik. Vor allem die „Abnehmer“
des Abiturs beklagen die fehlende Allgemeinbildung oder „Studierunfähigkeit“ der
jungen Studenten. So verwundert es nicht, dass Hanna-Renate Laurien, in ihrer
Festrede zum 50. Geburtstag der KMK die Diskussionen um das Abitur als „endlose
Geschichte“2 überschrieb. Bis heute steht das Thema regelmäßiger als jedes andere
auf der Tagesordnung der KMK. Und das- obwohl erst 1995 eine Expertenkommission
ins Rennen geschickt worden war, welche der KMK bestätigte, man könne im Großen
und Ganzen am bisherigen Abitursystem festhalten.
Oft trifft die Kritik Probleme, die mit der Leistungsbewertung zusammenhängen. So
wird die Studierunfähigkeit der Abiturienten beklagt, obwohl die Durchschnittsnoten Jahr für Jahr besser werden3. Die Diskussion um das Zentralabitur findet immer wieder
neuen Anlass, wenn in Hamburg 33% der Schüler eines Jahrgangs ihr Abitur schaffen,
während die Zahl in Bayern kontinuierlich um die 20% liegt. Momentan gibt es in Deutschland keine wirkliche Alternative zur Lizenzfunktion der
Regulierung des Hochschulzugangs des Abiturs, wie beispielsweise allg.
Studierfähigkeitstests wie in den USA oder Schweden oder alleinige
Aufnahmeprüfungen. "Diese Alternativen wären nicht nur mit zusätzlichen Kosten,
sondern auch unerwünschten Folgeproblemen verbunden, heißt es in einem
Expertenbericht der KMK 1995. Das Abitur hat daher eine zentrale Bedeutung im
deutschen Bildungswesen. "Innerhalb des Berechtigungswesens steht es als Gelenk
zum gehobenen Dienst, als Studienberechtigung und damit als Eintritt in den höheren
Dienst in einer Schlüsselfunktion“. 4 In Anbetracht der fortlaufenden Diskussion und unseres Seminars zur
Leistungsbeurteilung, möchte ich in meiner Hausarbeit das Bewertungssystem der
Sekundarstufe II unter die Lupe nehmen. Ich möchte die Frage beantworten, ob die
Ziele der Abiturbewertung mit dem bestehenden System erreicht werden können, wo
die Schwachstellen und die Stärken liegen. Dabei möchte ich Standpunkte einiger
aktueller Diskussionen aufzeigen und meine eigenen Schlussfolgerungen ziehen.
1 Freistaat Sachsen, SfK 1999: S.5.
2 Laurin 1998: S. 89.
3 Zum Bsp. Kraus 1998:S.56.
4 vgl. KMK 2000: S.XIX.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung: Das Abitur
- Funktionen der Leistungsbeurteilung im Abitur
- Exkurs: Zur allgemeinen schulischen Leistungsdiskussion
- Grundstrukturen des Bewertungs- und Prüfungssystems im Abitur
- Anmerkungen zum Punktesystem
- Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Bewertungssystem der Sekundarstufe II und dem Abitur. Sie untersucht, ob die Ziele der Abiturbewertung mit dem bestehenden System erreicht werden können und welche Stärken und Schwächen es aufweist. Die Arbeit analysiert aktuelle Diskussionen rund um das Abitur und zieht eigene Schlussfolgerungen.
- Die gesellschaftliche Funktion des Abiturs und seine Rolle als Selektionsinstrument
- Die Bedeutung der Leistungsbeurteilung im Abitur für verschiedene Akteure wie Staat, Wirtschaft und Schüler
- Die pädagogische Funktion der Leistungsbeurteilung im Abitur
- Die Kritik an der Zensur und die Frage, ob sie den Anforderungen gerecht werden kann
- Die Diskussionen um das Zentralabitur und die Standardisierung von Bildungsabschlüssen
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Das Abitur
Dieses Kapitel erläutert die allgemeinen Ziele des Unterrichts in der gymnasialen Oberstufe und die Funktion des Abiturs als Abschlusszeugnis. Es beleuchtet die Kritik an der fehlenden Allgemeinbildung und Studierfähigkeit von Abiturienten und die fortwährende Diskussion um das Abitur.
Funktionen der Leistungsbeurteilung im Abitur
Das Kapitel beschreibt die gesellschaftliche Funktion der Leistungsbeurteilung in der Sekundarstufe II, insbesondere ihre Rolle als Selektionsinstrument und ihre Bedeutung für verschiedene gesellschaftliche Bereiche. Es betont die Notwendigkeit von Standardisierung und Vergleichbarkeit des Abiturs für die Außenwelt und die damit verbundene Berichtsfunktion.
Darüber hinaus werden die pädagogische Funktion der Leistungsbeurteilung beleuchtet, die jedoch im Kontext des Abiturs als weniger bedeutend angesehen wird, und die Rolle der Leistungsbeurteilung als Feedback für Schüler, Eltern und Lehrer.
Exkurs: Zur allgemeinen schulischen Leistungsdiskussion
In diesem Kapitel wird die allgemeine Kritik an der Zensur und der Frage nach ihrer Fähigkeit, den zahlreichen gesellschaftlichen und pädagogischen Anforderungen gerecht zu werden, diskutiert. Es werden Argumente der Zensurengegner präsentiert, die dennoch anerkennen, dass die Zensur einige Ansprüche erfüllt.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptziele der gymnasialen Oberstufe?
Die Ziele sind eine vertiefte allgemeine Bildung und der Erwerb der Studierfähigkeit für ein Hochschulstudium.
Warum steht das Abitur häufig in der Kritik?
Kritiker bemängeln oft eine mangelnde Studierfähigkeit der Absolventen trotz immer besserer Notendurchschnitte sowie mangelnde Vergleichbarkeit zwischen den Bundesländern.
Welche Funktionen hat die Leistungsbeurteilung im Abitur?
Sie dient als Selektionsinstrument für den Hochschulzugang, als Feedback für Schüler und Lehrer sowie zur Standardisierung von Bildungsabschlüssen.
Was wird am aktuellen Zensursystem kritisiert?
Zensurengegner bezweifeln, dass Noten den komplexen pädagogischen und gesellschaftlichen Anforderungen an eine gerechte Leistungsbewertung voll entsprechen.
Welche Rolle spielt das Zentralabitur in der Diskussion?
Das Zentralabitur wird als Mittel zur Erhöhung der Vergleichbarkeit und Standardisierung der Abschlüsse über Ländergrenzen hinweg diskutiert.
- Arbeit zitieren
- Anke Rößler (Autor:in), 2001, Leistungsbeurteilung in der Sekundarstufe II: Das Abitur, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16859