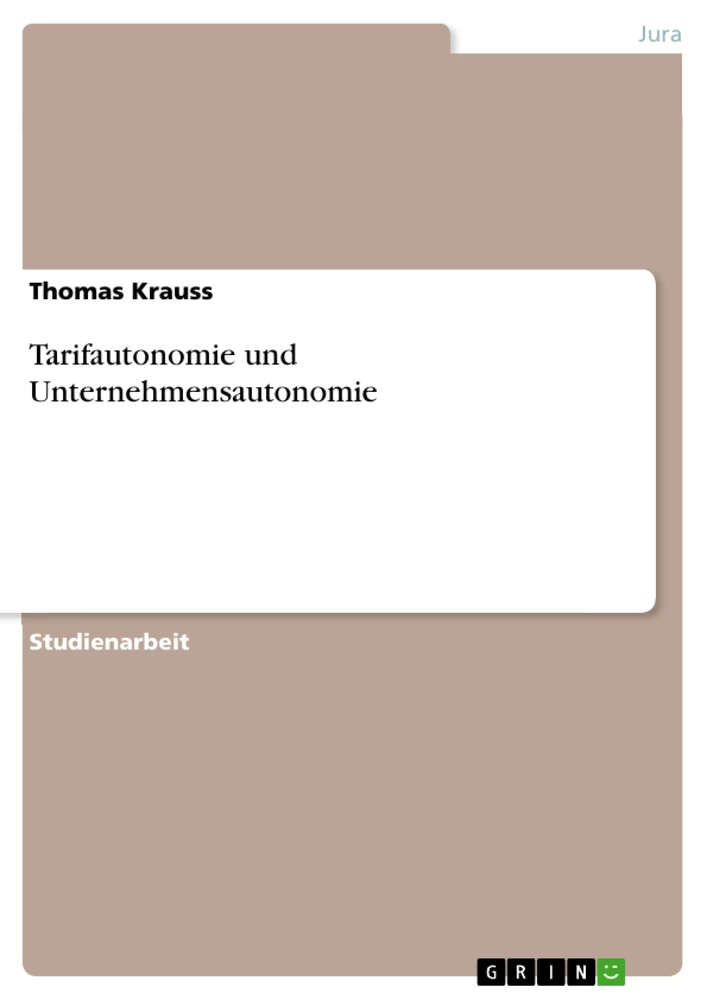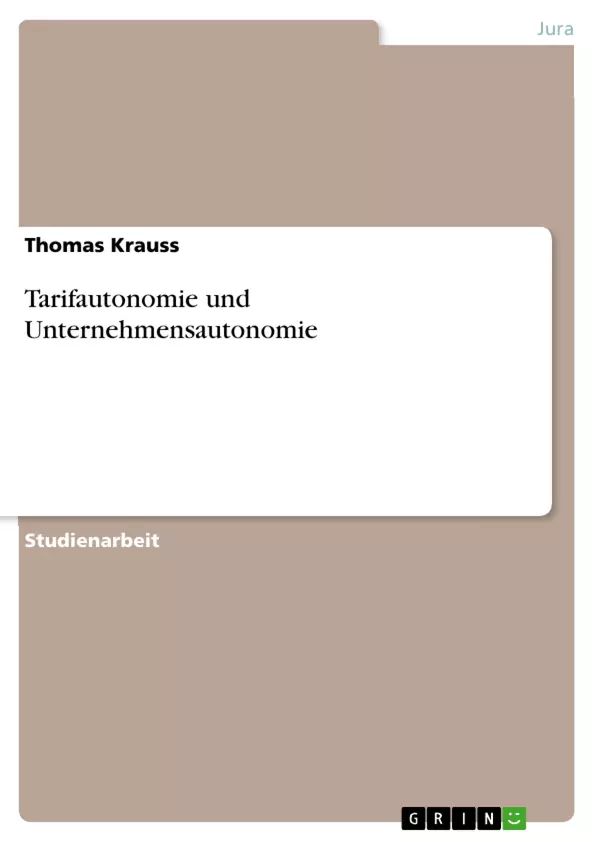Arbeit wurde 2011 aktualisiert
Betriebsbedingte Kündigungen, Betriebsschließungen, Arbeitslosigkeit. Diese und ähnliche Schreckensbilder sind in der heutigen Zeit allgegenwärtig. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Tarifautonomie, welche einst einen unumstößlichen Grundpfeiler des Arbeitsrechts bildete, nun bei vielen in Misskredit geraten ist. Ziel dieser Seminararbeit ist eine Abgrenzung der Tarifautonomie von der Unternehmensautonomie in Deutschland, deren Bedeutung im europäischen Kontext und eine abschließende Darstellung möglicher zukünftiger Entwicklungen.
Inhaltsverzeichnis
- Tarifautonomie und Unternehmensautonomie
- Einleitung
- Begriffsbestimmung und Abgrenzung
- Die Tarifautonomie im Spannungsfeld von Grundgesetz und Europäischem Recht
- Die Grenzen der Tarifautonomie
- Die Zukunft der Tarifautonomie
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Spannungsverhältnis zwischen Tarifautonomie und Unternehmensautonomie im deutschen Arbeitsrecht. Sie untersucht die rechtlichen Grundlagen und die Grenzen der Tarifautonomie sowie ihre Bedeutung für die Gestaltung von Arbeitsbedingungen und die soziale Sicherung im modernen Arbeitsmarkt.
- Die rechtlichen Grundlagen der Tarifautonomie im Grundgesetz und im Tarifvertragsgesetz
- Die Abgrenzung der Tarifautonomie von der Unternehmensautonomie
- Die Auswirkungen der Globalisierung und der europäischen Integration auf die Tarifautonomie
- Die Grenzen der Tarifautonomie durch Gesetzgebung und Rechtsprechung
- Die Rolle der Tarifautonomie im Kontext der betrieblichen Mitbestimmung
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel behandelt die Einleitung und gibt einen Überblick über die Thematik der Seminararbeit. Es erläutert die Relevanz der Tarifautonomie für die deutsche Arbeitswelt und stellt die zentralen Fragestellungen der Arbeit dar.
- Das zweite Kapitel widmet sich der Begriffsbestimmung und Abgrenzung der Tarifautonomie. Es definiert die wichtigsten Begriffe und setzt sie in Beziehung zu anderen relevanten Rechtsbegriffen wie der Unternehmensautonomie und der betrieblichen Mitbestimmung.
- Das dritte Kapitel analysiert die Tarifautonomie im Spannungsfeld von Grundgesetz und Europäischem Recht. Es untersucht die verfassungsrechtlichen Grundlagen der Tarifautonomie und beleuchtet die Auswirkungen der europäischen Integration auf die Gestaltung von Arbeitsbedingungen.
- Das vierte Kapitel befasst sich mit den Grenzen der Tarifautonomie. Es untersucht die rechtlichen und faktischen Grenzen der Tarifautonomie, die durch Gesetzgebung, Rechtsprechung und gesellschaftliche Entwicklungen gesetzt werden.
Schlüsselwörter
Tarifautonomie, Unternehmensautonomie, Arbeitsrecht, Grundgesetz, Europäisches Recht, Kollektivverträge, Tarifvertragsgesetz, Betriebsverfassung, Sozialpartnerschaft, Arbeitsbedingungen, Globalisierung, Europäische Integration.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Tarifautonomie in Deutschland?
Tarifautonomie ist das Recht der Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, Arbeitsbedingungen ohne staatliche Einmischung in Tarifverträgen auszuhandeln.
Was ist der Unterschied zur Unternehmensautonomie?
Unternehmensautonomie bezieht sich auf die Freiheit des Unternehmers, wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen, während die Tarifautonomie die kollektive Gestaltung der Arbeitsverhältnisse betrifft.
Wo ist die Tarifautonomie rechtlich verankert?
Sie basiert auf der Koalitionsfreiheit gemäß Artikel 9 Absatz 3 des Grundgesetzes und wird durch das Tarifvertragsgesetz (TVG) konkretisiert.
Welchen Einfluss hat das europäische Recht auf die Tarifautonomie?
Europäische Richtlinien und die Rechtsprechung des EuGH setzen zunehmend Rahmenbedingungen, die die nationalen Tarifsysteme beeinflussen.
Gibt es Grenzen für die Tarifautonomie?
Ja, sie wird durch zwingende Gesetze (z. B. Mindestlohn, Arbeitsschutz) und die Rechtsprechung der Arbeitsgerichte begrenzt.
- Arbeit zitieren
- Thomas Krauss (Autor:in), 2005, Tarifautonomie und Unternehmensautonomie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168650