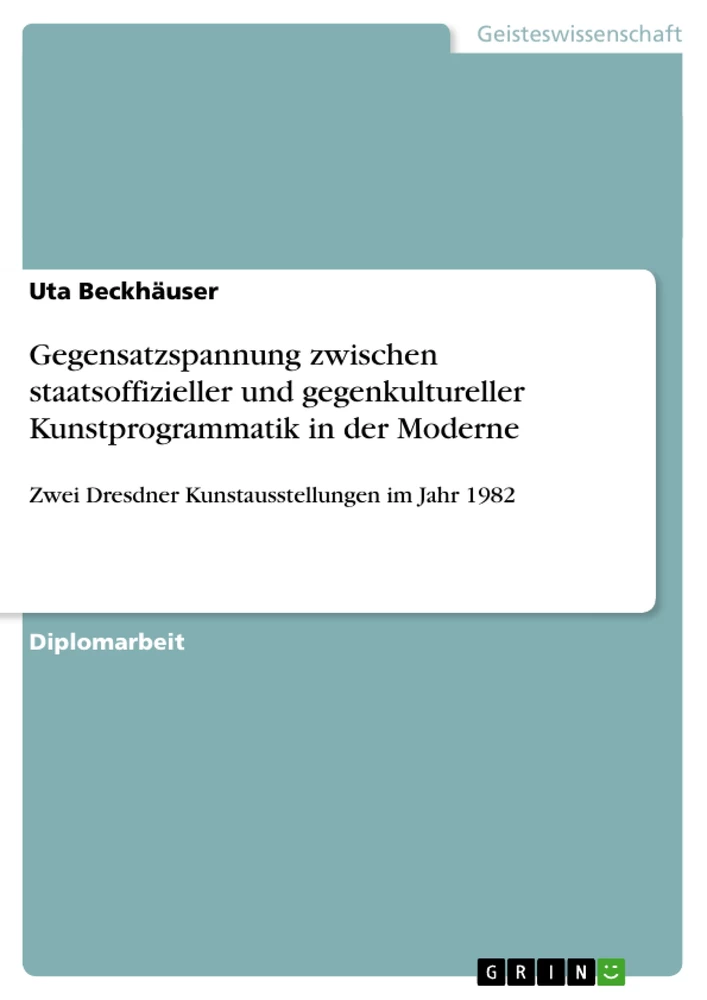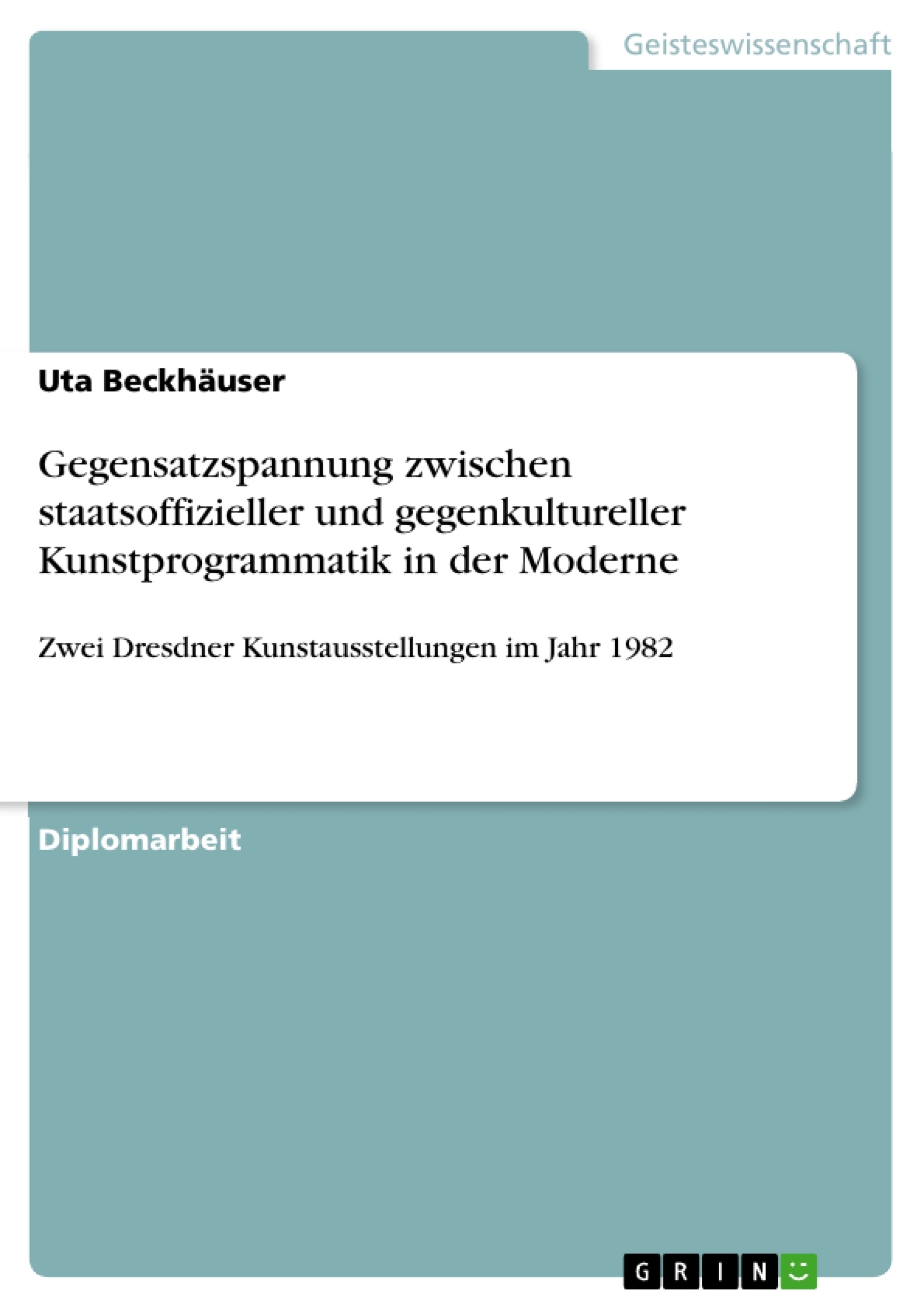Trotz der strengen Reglementierungen, und das dürfte so manchen in Staunen versetzen,
fand die alternative Künstlerszene, vor allem in den 70er und 80er Jahren, ihren
Platz im Kunstbetrieb der DDR, auch wenn dieser vielleicht vergleichsweise klein war. Gerade das Leonhardimuseum, der wohl legendärste Ausstellungsort für zeitgenössische
Kunst in Dresden, gab seit 1963 vielen Künstlern die Chance, ihre Kunst
zu zeigen, Kunst, die an anderen Ausstellungsorten und in Museen nur selten eine
Chance gehabt hätte. Die Künstler der alternativen Szene passten sich also nicht einfach
an, sondern sie suchten immer irgendeinen Platz, an dem sie Kunst nach ihrem
Verständnis, ohne Beschränkungen und politische Bevormundung, zu realisieren
versuchten. Natürlich gelang das nicht immer, dennoch ist es erstaunlich, wie sich
Künstler Freiräume schufen, wie sie diese zu erweitern suchten und
Netzwerke schufen, die sie stärker machten, und wie sie sich nicht zuletzt dadurch
ihre eigene „Gegenwelt“ aufbauten. Diese Künstler verstanden sich trotzdem nicht
als Aussteiger oder Vertreter einer Untergrundszene, vielmehr waren sie bis zuletzt
in die Strukturen der DDR eingebunden, waren Mitglied im Verband der Bildenden
Künstler (VBK) oder hatten eine feste „außerkünstlerische“ Arbeitsstelle; sie hatten
eine Art Zwischenposition inne und gingen so einen Kompromiss ein, ohne den sie
nie hätten künstlerisch überleben können.
Die Frage ist also: Wie hat sich die bildende Kunst in den 80er Jahren in Dresden
unter den gegebenen Umständen entwickelt und wie konnte das so möglich sein?
Wie wurde die Kunst vom System geformt beziehungsweise wie formte sie sich
selbst als Reaktion auf dieses? Welchen Kompromiss sind die Künstler mit dem sozialistischen Realismus auf der IX. Kunstausstellung der DDR eingegangen, welche
Kunst wurde hier gezeigt? Und wie schufen sich die Künstler ihre Freiräume, wie
haben sich Künstler mit alternativen Lebensentwürfen mit dem System arrangiert,
ohne ihre Ideen zu verleugnen und sich in ihrem künstlerischen Schaffensprozess
umformen zu lassen?
Anhaltspunkte dafür, wie die Künstler in diesem
Gesellschaftssystem versuchten, sich selbst treu zu bleiben, liefern nur Aussagen
von Zeitzeugen. Daher sollen Interviews mit Künstlern der alternativen Szene einen
Ausgangspunkt der Analyse bilden. Hierfür wurden Künstler ausgewählt, die an der
Ausstellung „Frühstück im Freien“ beteiligt waren.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Einleitende Worte und Zielstellung der Arbeit
- Argumentationsaufbau
- Teil I: Theoretische Überlegungen und Rahmenbedingungen
- Zum derzeitigen Stand der Forschung und vorhandene Literatur
- Totalitärer Herrschaftsanspruch der DDR – ihr Regime als eine Form der politischen Religion
- Die bildende Kunst unter der SED-Herrschaft
- Die Kunst als Instrument der SED
- Der sozialistische Realismus: Kunst muss nicht künstlerisch sein, auf den Inhalt komme es an, Staatskunst bis 1969
- Der offizielle Ausstellungsbetrieb: die Dresdner Kunstausstellungen
- Wie Kunst nicht sein sollte: Feindbild und Zensur in der bildenden Kunst
- Das Feindbild in der bildenden Kunst: der Formalismus
- Zensur in der bildenden Kunst
- Zur Situation der Kunst in den 70er Jahren: Die Honecker-Ära
- „Weite und Vielfalt“ in den 70er Jahren: der Anfang vom Ende
- Verschärfte Kontrollmaßnahmen
- Teil II: Die Umsetzung der offiziellen Kunstpolitik der 80er Jahre am Beispiel der IX. Kunstausstellung der DDR vom 2.10. 1982 bis zum 3.4.1983
- Besucheransturm und der Wandel der Kunstwahrnehmung
- Kunst im Spannungsfeld zwischen Kunstpolitik und Künstler
- Vorgeschichte und Konzeption der IX. Kunstausstellung
- Organisation der Ausstellung
- Juryarbeit
- Maßnahmen zur Durchsetzung der parteilichen Vorstellungen
- Auf der IX. Kunstausstellung gezeigte Kunst: wenig Sozialismus, viel Realität
- Das Arbeiterbild der 80er Jahre
- Eine andere Welt hinter dem Schleier des „sozialistischen Realismus“
- Chaos, Pessimismus und Rückzug ins Unverbindliche
- Rezeption durch die Besucher
- Teil III: Die alternative Künstlerszene und der Mythos „Frühstück im Freien“ 1982 im Leonhardi-Museum
- Gegenstand und Erkenntnisinteresse der Untersuchung
- Untersuchungsmethode
- Methode der Datenerhebung: das Leitfadeninterview
- Stichprobe
- Fragenkatalog
- Datenaufbereitung und -auswertung
- Aufbereitung des Materials, Datenerfassung
- Auswertungsverfahren
- Ergebnisse der Untersuchung
- Charakteristik der etwas anderen Künstlerszene
- Selbstverständnis der Künstler
- Reglementierungen und Widerstände
- Welchen Weg fanden die Künstler, ihre Kunst auszuüben?
- Integration der Künstler in die Strukturen der DDR
- Veränderungen nach der Wende beziehungsweise nach der Ausreise
- „Frühstück im Freien“ im Leonhardi-Museum
- Organisation der Ausstellung und Erinnerungen
- Umsetzung des Themas „Frühstück im Freien“
- Brisanz der Ausstellung und des Leonhardi-Museums
- Zitate: Was ist Kunst?
- Die Funktion und Rolle der bildenden Kunst in einem totalitären System
- Die Kunstpolitik der DDR und die Durchsetzung des sozialistischen Realismus
- Die Entwicklung des sozialistischen Realismus und seine Wandlungsprozesse
- Die alternative Künstlerszene in der DDR und ihre Auseinandersetzung mit der staatlichen Kunstpolitik
- Die Bedeutung von Freiräumen und Netzwerken für die Künstler der DDR
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit analysiert die Entwicklung der bildenden Kunst in Dresden in den 1980er Jahren unter den Vorgaben der Kunstpolitik der DDR. Sie untersucht, wie sich Künstler unter einem totalitären Regime und in einem System der staatlichen Kontrolle ihrer Kreativität selbst treu blieben und eigene Freiräume schufen.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Der erste Teil der Arbeit befasst sich mit theoretischen Überlegungen zu Kunst und Kultur in der DDR. Er beleuchtet die Rolle der Kunst als Instrument des Staats und die Instrumentalisierung des sozialistischen Realismus als Staatsdoktrin. Der zweite Teil untersucht die IX. Kunstausstellung der DDR 1982, die trotz ihrer staatlichen Kontrolle überraschend viel kritische und vielschichtige Kunst zeigte. Der dritte Teil fokussiert auf die alternative Künstlerszene, insbesondere die Ausstellung „Frühstück im Freien" im Leonhardi-Museum, ein Beispiel für den Widerstand und die Selbstorganisation der Künstler in der DDR.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit Themen wie Kunst und Kultur in der DDR, bildende Kunst, sozialistischer Realismus, alternative Künstlerszene, Kunstpolitik, Zensur, Freiräume, Netzwerke, Ausstellungskultur, „Frühstück im Freien" und Leonhardi-Museum.
Häufig gestellte Fragen
Wie konnten Künstler in der DDR trotz Zensur Freiräume finden?
Künstler schufen sich Nischen in alternativen Ausstellungsorten und Netzwerken. Sie gingen oft Kompromisse ein, indem sie offiziell im Verband der Bildenden Künstler (VBK) organisiert waren, aber privat ihre eigene "Gegenwelt" aufbauten.
Was war die offizielle Kunstvorgabe der SED?
Die Staatsdoktrin war der "Sozialistische Realismus". Kunst sollte als Instrument der Partei dienen, wobei der Inhalt und die politische Botschaft wichtiger waren als die rein künstlerische Form.
Welche Bedeutung hatte das Leonhardimuseum in Dresden?
Es war einer der legendärsten Orte für zeitgenössische Kunst in Dresden. Seit 1963 bot es Künstlern der alternativen Szene eine Plattform, die in staatlichen Museen keine Chance gehabt hätten.
Was war das Besondere an der IX. Kunstausstellung der DDR (1982)?
Trotz staatlicher Kontrolle zeigte die Ausstellung einen Wandel: Weniger Sozialismus, mehr Realität. Themen wie Chaos, Pessimismus und Rückzug ins Private waren in den Werken erkennbar.
Was verbirgt sich hinter dem Titel „Frühstück im Freien“?
Es war eine brisante Ausstellung im Leonhardimuseum im Jahr 1982, die als Symbol für die alternative Künstlerszene Dresdens und deren Selbstverständnis gilt.
Was galt in der DDR-Kunst als "Formalismus"?
Formalismus war ein politisches Feindbild. Damit wurde Kunst diffamiert, die sich zu sehr auf ästhetische Experimente konzentrierte und die ideologischen Inhaltsforderungen des Staates vernachlässigte.
- Quote paper
- Uta Beckhäuser (Author), 2009, Gegensatzspannung zwischen staatsoffizieller und gegenkultureller Kunstprogrammatik in der Moderne, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168765