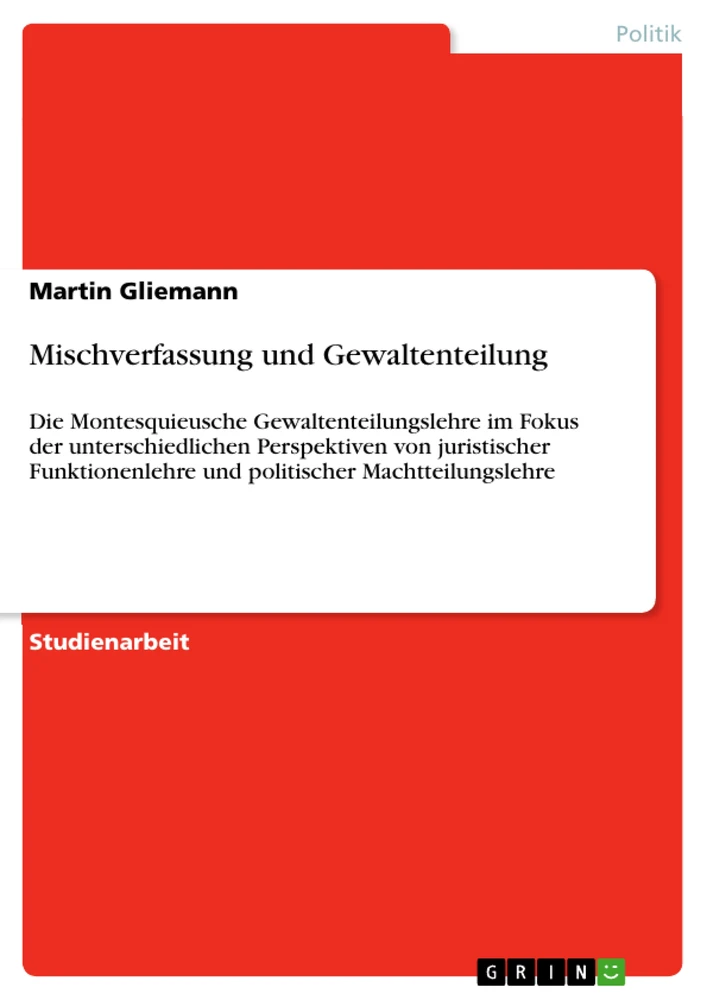„[...] aber es ist eine ewige Erfahrung, dass jeder, der Macht hat, ihrem Mißbrauch geneigt ist: er geht so weit, bis er auf Schranken stößt. [...] Um den Mißbrauch der Macht zu verhindern, muß vermöge
einer Ordnung der Dinge die Macht der Macht Schranken setzen.“
Mit dieser Sentenz fasste Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu eine seiner Fundamentalerkenntnisse zusammen und erhob sie dadurch zur allgemeinen Bedeutung, dass er konkret
begründete, wie Schranken der Macht innerhalb welchen Kontextes aussehen können. [...]
Diese Arbeit beginnt damit, die politische Freiheit als Agens der Montesquieuschen Theoriebildung aufzuzeigen. Darauf aufbauend wird gezeigt werden, inwiefern die menschliche Vernunft im Montesquieuschen Verständnis das unauflösliche Bindeglied zwischen Naturgesetzen und positiven Gesetzen
darstellt [...]. Weiterhin wird ein Begründungszusammenhang formuliert werden, der die Unmöglichkeit der Deduktion des positiven Rechts aus den Naturgesetzen aufzeigt. Die politische Wirklichkeit in ihrer jeweiligen Faktizität lässt sich nur mittels Induktion aus den positiven Gesetzen erreichen bzw. nachvollziehen.
Nach Verdeutlichung dieses methodischen Ansatzes wird das Augenmerk auf die englische Verfassung verlegt, um in ihr die Anlagen zur politischen Freiheit zu zeigen, welche eng an die Forderung
nach Machtteilung angelehnt sind. Innerhalb dieses Kontextes werden einerseits die Montesquieuschen Strukturprinzipien offengelegt und andererseits wird gezeigt werden, dass eine vorschnelle Verortung
seines Denkens innerhalb einer juristischen Funktionenlehre sehr sicher von dem Resultat geprägt sein wird, Montesquieu fehl interpretiert zu haben. Aus diesem Grund werde ich mich ausführlich der Exemplifikation des Zusammenspiels der je unterschiedlichen Perspektiven von juristischer Funktionenlehre und politischer Machtaufteilungslehre widmen. [...] Abschließen werde ich
diese Arbeit mit der Fokussierung auf ein Postulat Alois Riklins, welcher einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Idee der Machtteilung und der Idee gemischter Verfassungen gesehen und
aufgemacht hat. Vorweggenommen sei, dass ich mich der Riklinschen Postulierung deswegen anschließe, weil die immerwährende und übliche Reduktion machtaufteilender Gedanken auf die Funktionenlehre
zu Fehlschlüssen führt, welche im politikwissenschaftlichen Bereich schlichtweg
nicht weiterverwendet werden können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Die politische Freiheit als Agens der Theoriebildung
- Die positiven Gesetze im Verhältnis zu den Naturgesetzen
- Die Montesquieuschen Strukturprinzipien unter Beachtung der Unterschiedlichkeit von Funktionenlehre und Machtteilungslehre
- Der Zusammenhang von Gewaltenteilung und Mischverfassung
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Montesquieuschen Gewaltenteilungslehre und untersucht diese aus den Perspektiven der juristischen Funktionenlehre und der politischen Machtteilungslehre. Das Ziel ist es, die Montesquieuschen Strukturprinzipien zu analysieren und den Zusammenhang zwischen Gewaltenteilung und Mischverfassung aufzuzeigen.
- Die politische Freiheit als Agens der Montesquieuschen Theoriebildung
- Das Verhältnis von Naturgesetzen und positiven Gesetzen im Montesquieuschen Verständnis
- Die Montesquieuschen Strukturprinzipien im Kontext der englischen Verfassung
- Die unterschiedlichen Perspektiven von Funktionenlehre und Machtteilungslehre
- Der Zusammenhang zwischen Gewaltenteilung und Mischverfassung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung präsentiert Montesquieus Grundverständnis von politischer Freiheit und Macht, verknüpft mit seinem zentralen Werk „Vom Geist der Gesetze“. Sie stellt Montesquieus Fokus auf die Bedeutung von Gesetzen für die politische Ordnung und die Bedeutung des Verhältnisses zwischen Naturgesetzen und positiven Gesetzen heraus.
- Die politische Freiheit als Agens der Theoriebildung: Dieses Kapitel beleuchtet, wie Montesquieu die politische Freiheit als Motor seiner Theoriebildung betrachtet, in enger Verbindung mit den Gesetzen eines Gemeinwesens und der Bedeutung von Sicherheit. Es werden auch tradierte Bedeutungen des Wortes „Freiheit“ diskutiert, die Montesquieu kritisch hinterfragt und seine Ansicht, dass nur gemäßigte Regierungsformen wahre politische Freiheit ermöglichen können, vorgestellt.
- Die positiven Gesetze im Verhältnis zu den Naturgesetzen: Dieses Kapitel erforscht die Rolle der menschlichen Vernunft im Montesquieuschen Verständnis, die als Verbindung zwischen Naturgesetzen und positiven Gesetzen fungiert. Es werden die ersten Grundsteine des Rechtspositivismus in Montesquieus Werk beleuchtet, und es wird gezeigt, dass die politische Wirklichkeit nur durch Induktion aus den positiven Gesetzen erschlossen werden kann.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Begriffen und Konzepten wie politischer Freiheit, Gewaltenteilung, Mischverfassung, Naturgesetze, positive Gesetze, Funktionenlehre, Machtteilungslehre und der englischen Verfassung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Kernprinzip der Gewaltenteilung bei Montesquieu?
Um Machtmissbrauch zu verhindern, muss die Macht der Macht Schranken setzen. Dies geschieht durch die Trennung von Legislative, Exekutive und Judikative.
Was versteht Montesquieu unter politischer Freiheit?
Politische Freiheit ist das Recht, alles zu tun, was die Gesetze erlauben, verbunden mit dem Gefühl der Sicherheit des Bürgers.
Wie hängen Gewaltenteilung und Mischverfassung zusammen?
Die Gewaltenteilung wird oft durch eine Mischverfassung realisiert, in der verschiedene gesellschaftliche Kräfte (Monarch, Adel, Volk) an der Macht beteiligt sind.
Warum ist die englische Verfassung für Montesquieu ein Vorbild?
Er sah in ihr die praktische Umsetzung der Machtteilung, die den Schutz der politischen Freiheit als oberstes Ziel verfolgte.
Was ist der Unterschied zwischen Funktionenlehre und Machtteilungslehre?
Die Funktionenlehre betrachtet die juristische Trennung der Staatsaufgaben; die Machtteilungslehre fokussiert auf die politische Balance zwischen verschiedenen Machtträgern.
- Citar trabajo
- Martin Gliemann (Autor), 2010, Mischverfassung und Gewaltenteilung , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168769