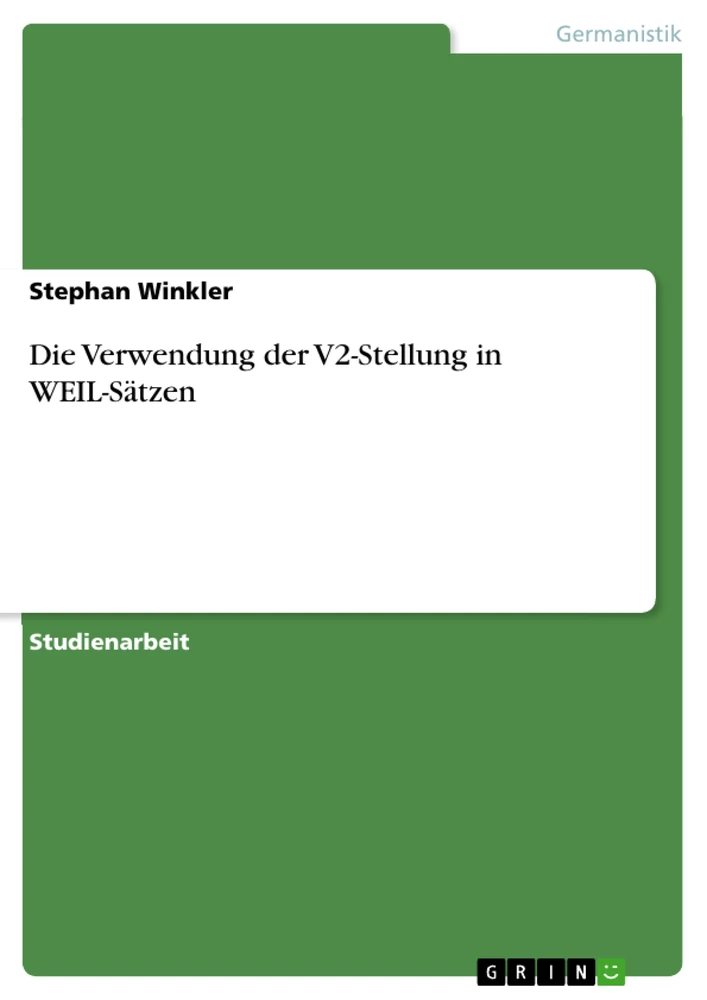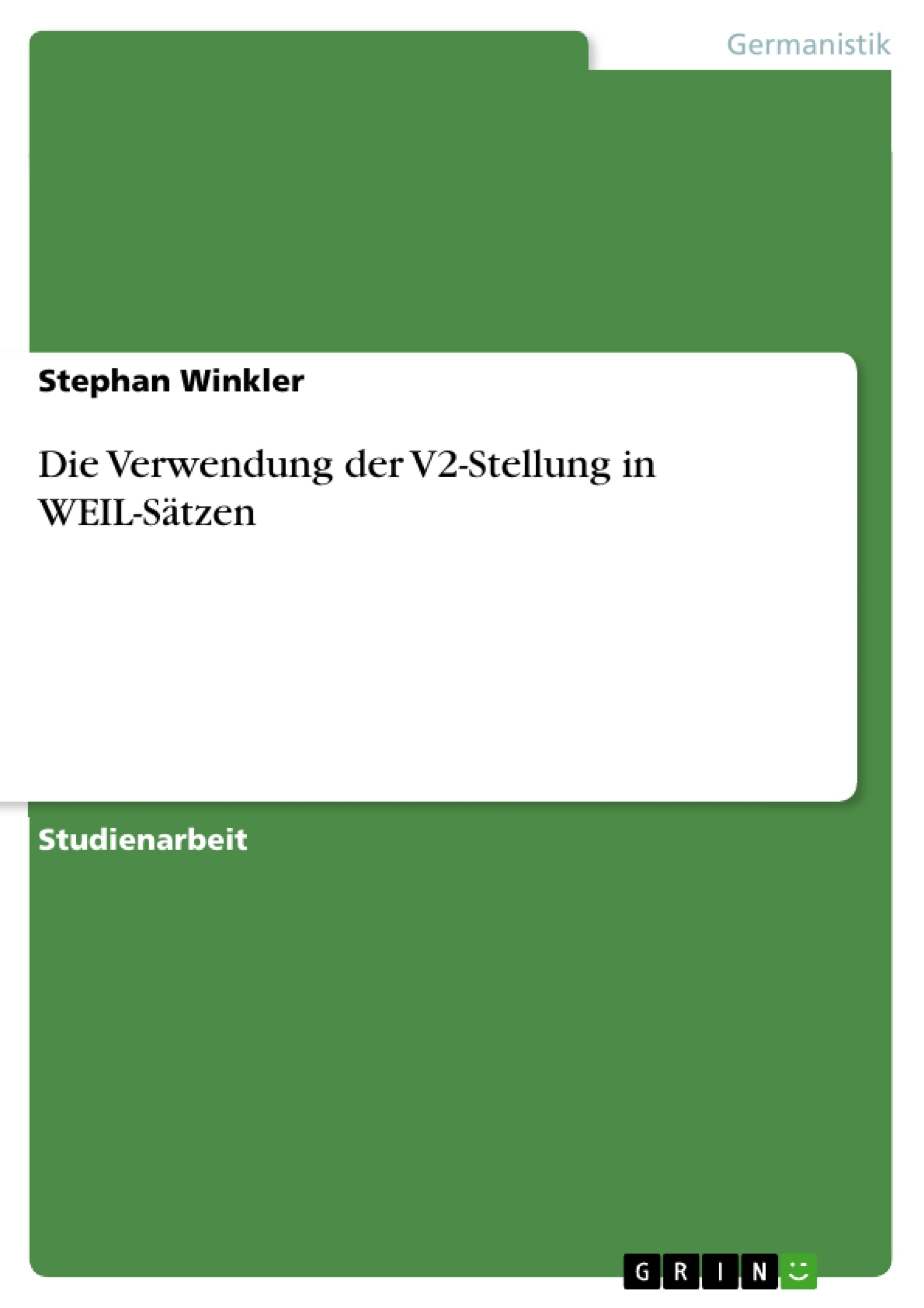In dieser Hausarbeit soll gezeigt werden, auf welche Art und Weise die WEIL+V2-Stellung in Nebensätzen zu verwenden ist. Mit einem kurzen geschichtlichen Überblick, der das Aufkommen der WEIL-V2 Sätze und deren Verbreitung beleuchtet, soll in dieses Thema eingeführt werden. Darauf folgen die verschiedenen Verwendungsarten der WEIL+V2 Stellung. Dieser Teil orientiert sich hauptsächlich an dem Text von Susanne Günthner aus dem Jahre 1993, da dieser Text Grundlage des, im Seminar gehaltenen, Referates war. In dem darauf folgendem Kapitel werden noch die Verwendungsweisen der altbekannten WEIL-VE Sätze behandelt. Dies dient dazu, um deutlich zu machen, wozu welche Variante in der gesprochenen Sprache verwendet wird. Zum Schluss werden wesentliche Punkte noch einmal zusammengefasst und ein Ausblick gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Werdegang der WEIL-V2 Sätze
- Verwendungsweisen der V2-Stellung in WEIL-Sätzen
- Sprechakt-Qualifikationen
- Epistemizität
- Faktische WEIL-Sätze
- Weil+V2 Stellung als konversationelles Fortsetzungsmittel
- Verwendungsweisen der VE-Stellung in WEIL-Sätzen
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verwendung der V2-Stellung in "weil"-Sätzen im Deutschen. Sie verfolgt das Ziel, die verschiedenen Verwendungsweisen dieser Konstruktion in der gesprochenen Sprache zu beschreiben und deren Entwicklung nachzuzeichnen. Die Arbeit stützt sich dabei maßgeblich auf die Arbeit von Susanne Günthner (1993).
- Historische Entwicklung der WEIL-V2-Stellung
- Unterscheidung zwischen faktischen und nicht-faktischen WEIL-Sätzen
- Sprechaktbezogene Verwendung von WEIL-V2-Sätzen
- Epistemische Funktion von WEIL-V2-Sätzen
- Die WEIL-V2-Stellung als konversationelles Mittel
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt das Ziel der Arbeit, welches darin besteht, die Verwendung der WEIL+V2-Stellung in Nebensätzen zu untersuchen. Es wird ein kurzer geschichtlicher Überblick über das Aufkommen und die Verbreitung dieser Konstruktion versprochen, gefolgt von der Darstellung verschiedener Verwendungsarten. Abschließend wird die Behandlung der Verwendungsweisen der traditionellen WEIL-VE-Sätze angekündigt, um die jeweiligen Anwendungskontexte in der gesprochenen Sprache herauszuarbeiten. Die Arbeit konzentriert sich auf die gesprochene Sprache und bezieht sich stark auf die Arbeit von Susanne Günthner (1993).
Der Werdegang der WEIL-V2 Sätze: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der WEIL-V2-Sätze. Es zeigt, dass die Konstruktion bereits Ende der 1950er Jahre von Arndt erwähnt wurde, zunächst als Mundart- oder „Ausländer-Deutsch“ eingestuft. Erst in den 1980er Jahren fand eine intensivere sprachwissenschaftliche Auseinandersetzung statt, beginnend mit Gaumanns Dissertation (1984). Die zunehmende Verbreitung der WEIL-V2-Sätze im Gesamtdeutschen Raum im Laufe der 1980er und 1990er Jahre führte zu einer verstärkten Beachtung in der Sprachwissenschaft und in Grammatiken. Lange Zeit ignoriert, wurden sie schließlich in den 1990er Jahren vom Duden als akzeptable Form in der gesprochenen Sprache anerkannt und finden sich mittlerweile sogar in Deutschlehrbüchern für Ausländer wieder.
Verwendungsweisen der V2-Stellung in WEIL-Sätzen: Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Verwendungsweisen der WEIL+V2-Stellung in Sätzen, wobei der Fokus auf der gesprochenen Sprache liegt. Es werden die von Günthner differenzierten Kategorien der Sprechakt-Qualifikationen und der Epistemizität sowie faktische WEIL-Sätze und die WEIL+V2-Stellung als konversationelles Fortsetzungsmittel behandelt. Die Kapitel 3.1-3.4 gehen detailliert auf jede dieser Kategorien ein, mit Beispielen aus Transkriptionen zur Veranschaulichung. Der Schwerpunkt liegt auf der Unterscheidung zwischen der Bezugnahme auf den Sachverhalt und der Bezugnahme auf die Sprechhandlung selbst.
Schlüsselwörter
WEIL-Sätze, V2-Stellung, VE-Stellung, gesprochenen Sprache, Satzstruktur, Grammatik, Sprachgeschichte, Sprechakt, Epistemizität, Konversation, Günthner.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Verwendung der V2-Stellung in "weil"-Sätzen
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Verwendung der V2-Stellung in "weil"-Sätzen im Deutschen, insbesondere in der gesprochenen Sprache. Sie verfolgt das Ziel, die verschiedenen Verwendungsweisen dieser Konstruktion zu beschreiben und deren Entwicklung nachzuzeichnen.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung der WEIL-V2-Stellung, die Unterscheidung zwischen faktischen und nicht-faktischen WEIL-Sätzen, die sprechaktbezogene Verwendung von WEIL-V2-Sätzen, deren epistemische Funktion und die WEIL-V2-Stellung als konversationelles Mittel. Sie analysiert die Verwendungsweisen der V2-Stellung im Vergleich zur traditionellen VE-Stellung in "weil"-Sätzen.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit stützt sich maßgeblich auf die Arbeit von Susanne Günthner (1993) und analysiert die Verwendung der V2-Stellung in "weil"-Sätzen anhand von Beispielen aus Transkriptionen der gesprochenen Sprache. Der Fokus liegt auf der Unterscheidung zwischen der Bezugnahme auf den Sachverhalt und der Bezugnahme auf die Sprechhandlung selbst.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur historischen Entwicklung der WEIL-V2-Sätze, ein Kapitel zu den Verwendungsweisen der V2-Stellung in WEIL-Sätzen (unterteilt in Sprechakt-Qualifikationen, Epistemizität, faktische WEIL-Sätze und konversationelle Fortsetzungsmittel), ein Kapitel zu den Verwendungsweisen der VE-Stellung in WEIL-Sätzen und einen Schluss.
Wie ist die historische Entwicklung der WEIL-V2-Sätze dargestellt?
Das Kapitel zur historischen Entwicklung zeigt, dass die Konstruktion zunächst als Mundart oder "Ausländer-Deutsch" eingestuft wurde, aber im Laufe der Zeit eine zunehmende Verbreitung im Gesamtdeutschen Raum erfuhr und schließlich vom Duden als akzeptable Form in der gesprochenen Sprache anerkannt wurde.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: WEIL-Sätze, V2-Stellung, VE-Stellung, gesprochene Sprache, Satzstruktur, Grammatik, Sprachgeschichte, Sprechakt, Epistemizität, Konversation, Günthner.
Auf welche Quelle wird besonders Bezug genommen?
Die Arbeit bezieht sich maßgeblich auf die Arbeit von Susanne Günthner (1993).
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke gedacht und richtet sich an Personen, die sich für die deutsche Grammatik, Satzstruktur und Sprachgeschichte interessieren, insbesondere im Bereich der gesprochenen Sprache.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die verschiedenen Verwendungsweisen der V2-Stellung in "weil"-Sätzen in der gesprochenen Sprache zu beschreiben und deren Entwicklung nachzuzeichnen.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den einzelnen Verwendungsweisen der V2-Stellung?
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Verwendungsweisen der V2-Stellung (Sprechakt-Qualifikationen, Epistemizität, faktische WEIL-Sätze und konversationelle Fortsetzungsmittel) finden sich in Kapitel 3 der Arbeit.
- Citation du texte
- Stephan Winkler (Auteur), 2007, Die Verwendung der V2-Stellung in WEIL-Sätzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168789