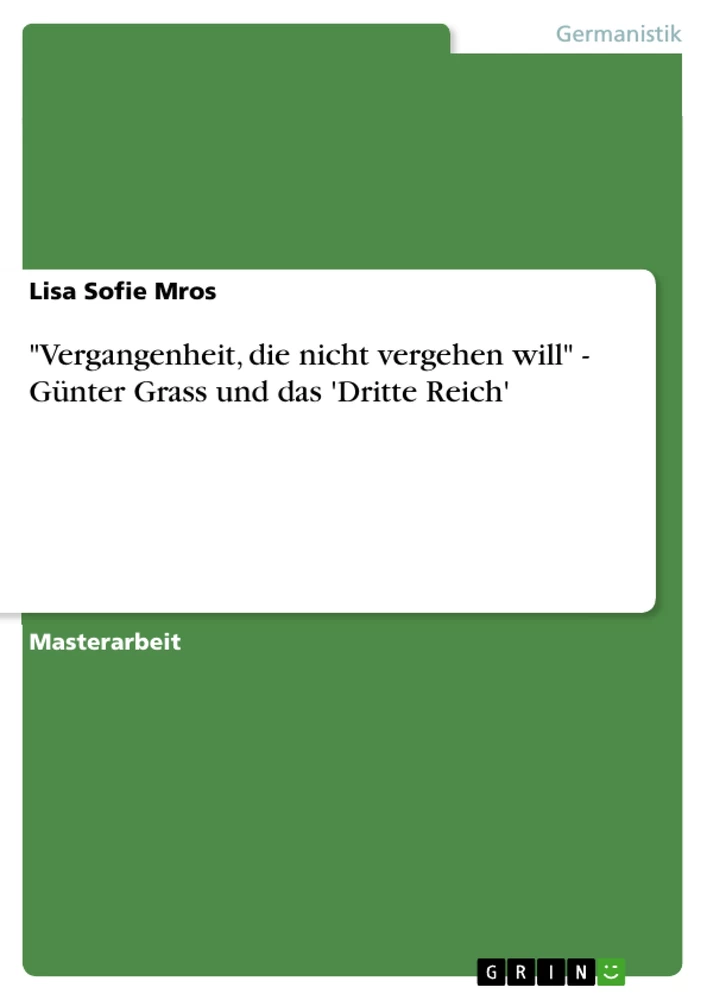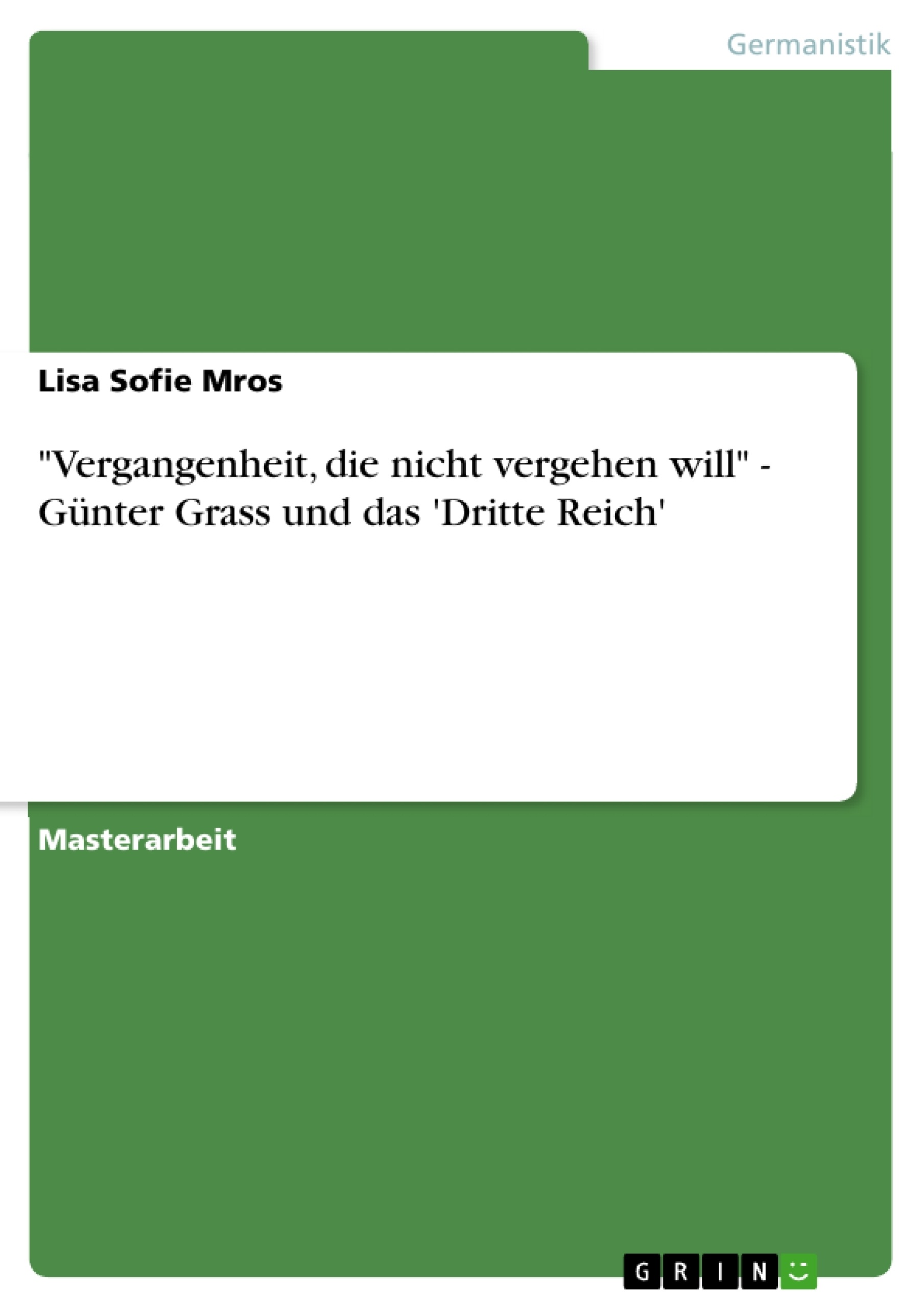"Das wird nicht aufhören, gegenwärtig zu bleiben; unsere Schande wird sich weder verdrängen noch bewältigen lassen […] Auschwitz wird […] nie zu begreifen sein. Soviel Zeit seitdem vergangen ist, bei aller Beflissenheit einiger Historiker, Vergleichbares herbeizuzitieren, um einer, wie man sagt, unglücklichen Phase deutscher Geschichte historischen Stellenwert zu unterschieben, was immer auch eingestanden, beklagt, sonstwie aus Schuldbewußtsein gesagt wird […], das Ungeheure, auf den Namen Auschwitz gebracht, ist, weil eben nicht vergleichbar, weil durch nichts historisch zu unterfüttern, weil keinem Schuldgeständnis zugänglich, unfaßbar geblieben und dergestalt zur Zäsur geworden […]."
Dieser Auszug entstammt einer Rede des Schriftstellers Günter Grass, die den Titel Schreiben nach Auschwitz trägt. Er setzt sich darin mit der deutschen Schuld an der nationalsozialistischen ‘Endlösung’ der NS-Zeit auseinander und folgert, dass sich die historische Schuld der Deutschen durch einen gegenwärtigen Charakter auszeichne sowie dass die Verdrängung oder Bewältigung der aus dem Verbrechen resultierenden Schande ausgeschlossen sei. (...)Die immanente Kritik in Grass’ Rede muss im Kontext des sogenannten ‘Historikerstreits’ von 1986 betrachtet werden. Im Fokus der Mediendebatte um den zukünftigen „gesellschaftspolitischen und historiographischen Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit“ stand die Frage nach der Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung. (...) Grass erweist sich offensichtlich als Gegner einer solchen Historisierung der NS-Vergangenheit: Die Beschäftigung mit seiner Persönlichkeit und seinen Werken scheint prädestiniert, um einen Eindruck über ein gegenteiliges Konzept im Umgang mit dem Nationalsozialismus zu gewinnen gewinnen.
INHALT:
1. Einleitung
2. Stand der Grass-Forschung
3. Vorbemerkung zur Auswahl der Grass-Texte
4. „Schreiben gegen das Vergessen“
4.1 Günter Grass u. die NS-Vergangenheit
4.2 Vergegenwärtigung des Vergangenen
5. Das ‘Dritte Reich’ u. die Deutschen: Eckpunkte in Grass’
Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit
5.1 Die Unfähigkeit der Deutschen zur Auseinandersetzung
5.1.1 Ausgebliebene Aufarbeitung u. Schuldverdrängung
5.1.2 Die Schuld der Mitläufer
5.2 „Das hört nicht auf. Nie hört das auf“: Das Nachwirken der
Vergangenheit
5.2.1 Streben nach Einheit
5.2.2 Radikalismus von rechts
6. Fazit u. Ausblick
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Siglenverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Stand der Grass-Forschung
- 3. Vorbemerkung zur Auswahl der Grass-Texte
- 4. „Schreiben gegen das Vergessen“
- 4.1 Günter Grass und die NS-Vergangenheit
- 4.2 Vergegenwärtigung des Vergangenen
- 5. Das ‘Dritte Reich’ und die Deutschen: Eckpunkte in Grass’ Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit
- 5.1 Die Unfähigkeit der Deutschen zur Auseinandersetzung
- 5.1.1 Ausgebliebene Aufarbeitung und Schuldverdrängung
- 5.1.2 Die Schuld der Mitläufer
- 5.2 „Das hört nicht auf. Nie hört das auf“: Das Nachwirken der Vergangenheit
- 5.2.1 Streben nach Einheit
- 5.2.2 Radikalismus von rechts
- 5.1 Die Unfähigkeit der Deutschen zur Auseinandersetzung
- 6. Fazit und Ausblick
- 7. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Masterarbeit befasst sich mit dem Werk und der Person Günter Grass und untersucht die Gründe, warum die NS-Vergangenheit für ihn nicht zu vergehen scheint. Die Arbeit analysiert Grass’ Verhältnis zur NS-Vergangenheit, seine Motive und die Art und Weise, wie er sie in seinen literarischen und politischen Texten zum Thema macht. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für Grass’ Faszination mit der NS-Vergangenheit zu gewinnen und seine Rolle als kritischer Beobachter deutscher Verhältnisse zu beleuchten.
- Die Bedeutung von Auschwitz und dem Zivilisationsbruch
- Die Rolle des Kleinbürgertums im Nationalsozialismus
- Die Schuldverdrängung und die Unfähigkeit zur Aufarbeitung der Vergangenheit
- Das Nachwirken der Vergangenheit in der Gegenwart und Zukunft
- Der deutsche Idealismus und seine Gefahren
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung gibt eine Einführung in die Thematik und stellt die zentrale Frage nach den Motiven für Günter Grass’ fortwährende Beschäftigung mit der NS-Vergangenheit. Kapitel 2 bietet einen Überblick über die Grass-Forschung mit besonderem Fokus auf Werke, die sich mit der Geschichte und Zeitgeschichte in Verbindung mit Grass' Œuvre befassen.
Kapitel 3 erläutert die Auswahl der Grass-Texte, die für diese Arbeit als Quellenbasis dienen. Hier werden die fünf Werke der Danziger Trilogie, Im Krebsgang und Beim Häuten der Zwiebel sowie ausgewählte Reden und Essays vorgestellt.
Kapitel 4 befasst sich mit Grass’ Konzept der Zeitgenossenschaft. Es analysiert seine Auffassung von Auschwitz als unheilbarem Bruch in der Zivilisation und sein Streben nach Vergegenwärtigung der NS-Vergangenheit, um die Erinnerung an die Opfer wachzuhalten und zukünftige Wiederholungen zu verhindern.
Kapitel 5 analysiert die zentralen Aspekte in Grass’ Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit. Es wird deutlich, dass die Unfähigkeit der Deutschen zur Auseinandersetzung mit der Vergangenheit aus der historischen Schuld resultiert, die in Form der Schuldverdrängung und des opportunistischen Mitläufertums in Erscheinung trat.
Kapitel 5.2 thematisiert das Nachwirken der NS-Vergangenheit. Es werden die Gefahren des Strebens nach Einheit und die Beständigkeit des Rechtsradikalismus als Ausdruck der deutschen Wesensart und ihrer ungelösten Probleme aufgezeigt.
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und stellt Grass' Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit in den Kontext der Debatten um die Vergangenheitsbewältigung.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit beschäftigt sich mit Günter Grass, NS-Vergangenheit, deutsche Schuld, Verdrängung, Vergegenwärtigung, Zivilisationsbruch, Auschwitz, Kleinbürgertum, Opportunismus, Identitätslosigkeit, Einheitsstaat, Rechtsradikalismus, Wiederholung, Erinnerungskultur.
- Citar trabajo
- M.A. Lisa Sofie Mros (Autor), 2010, "Vergangenheit, die nicht vergehen will" - Günter Grass und das 'Dritte Reich', Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168808