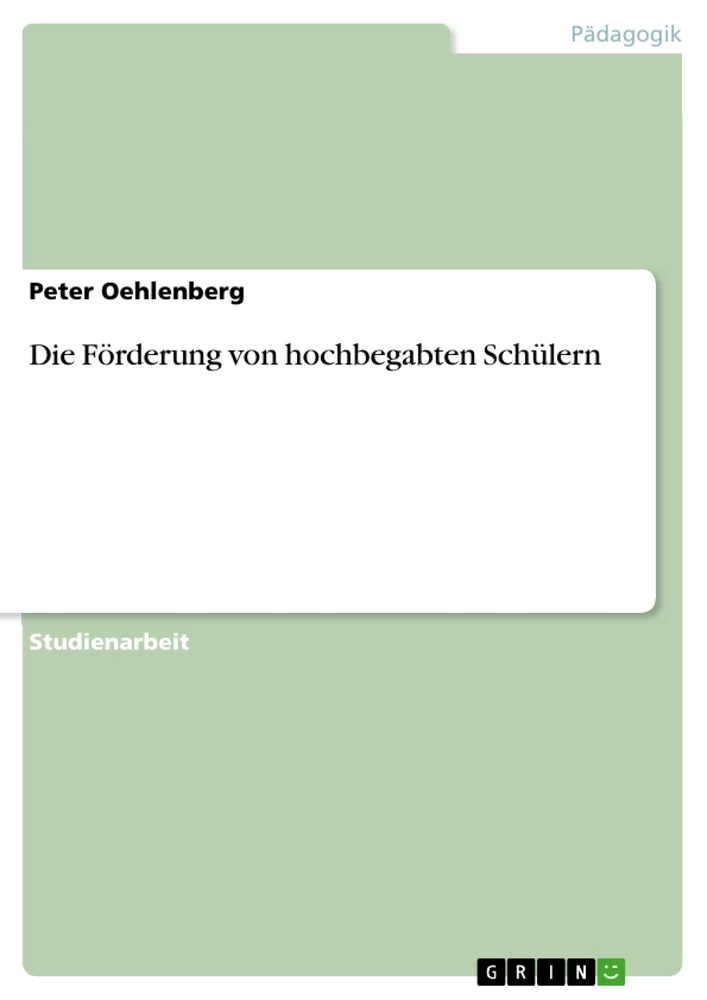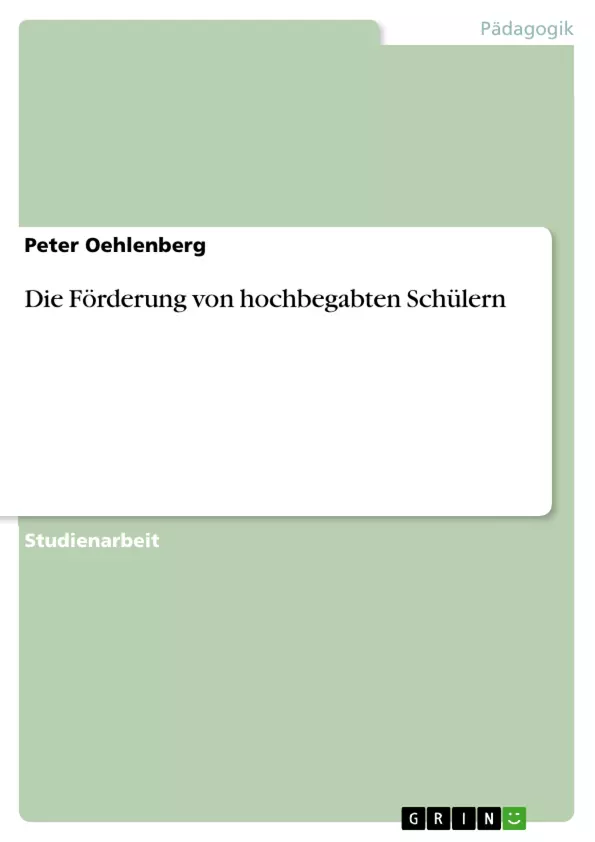Wenn es um die Förderung von hochbegabten Schülern geht, ist es immer wieder erstaunlich, dass für viele Personen die erste Frage, die sie sich dabei stellen, nicht „Wie kann ich Begabte am besten fördern?“ lautet, sondern: „Ist es prinzipiell sinnvoll, dass begabte Schüler gefördert werden?“ Sie gehen davon aus, dass Begabte den anderen Schülern gegenüber schon genug Vorzüge genießen und es überflüssig ist, ihnen noch zusätzlich Zeit, Aufmerksamkeit und Engagement zu widmen.
Nach meiner Meinung ist dies der falsche Ansatz. Viel zu häufig kann man an deutschen Schulen beobachten, dass der Unterricht für einen imaginären Durchschnittsschüler konzipiert wird. Dabei sind alle Anstrengungen nur darauf gerichtet, den Schülern, deren Leistungen diesen Anforderungen nicht gerecht werden, zu helfen, dieses Durchschnittslevel zu erreichen. Wenn man sich Staaten ansieht, die traditionell über einen sehr hohen Bildungsstandard verfügen und bei der PISA-Studie regelmäßig die obersten Plätze belegen, wie etwa Schweden und Finnland, so wird man feststellen, dass dort versucht wird, jeden Schüler nach seinen Begabungen optimal zu fördern, unabhängig davon, ob es sich dabei um einen lernbehinderten, einen hochbegabten oder einen durchschnittlich begabten Schüler handelt.
In dieser Arbeit soll gezeigt werden, auf welche Art und Weise die Förderung von begabten Schülern gelingen kann. Zu diesem Zwecke wird zunächst knapp geklärt, was man unter dem Begriff „Begabung“ zu verstehen hat und welche Methoden benutzt werden, um eine Begabung zu diagnostizieren. Danach werden die am häufigsten angewandten Methoden der Förderung, also die Akzeleration, das Enrichment sowie die innere und äußere Differenzierung, theoretisch erklärt. Zuletzt wird an den Beispielen des Elsa-Brändström-Gymnasiums und der Laborschule Bielefeld gezeigt, wie die theoretischen Grundlagen dort praktisch in die Tat umgesetzt werden.
Als primäre Literaturgrundlage dienen die Werke „Begabungsförderung in heterogenen Lerngruppen. Materialien zur Diagnostik, Förderpläne und Anregungen für die Unterrichtspraxis“, herausgegeben von Katrin Höhmann (2005), „Heterogenität in Schule und Unterricht. Handlungsansätze zum pädagogischen Umgang mit Vielfalt“, herausgegeben von Sebastian Boller, Elke Rosowski und Thea Stroot (2007) und „Unser Kind ist hochbegabt“ von Franz J. Mönks und Irene H. Ypenburg (1998).
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Definition von Begabung
- Die Diagnose von Begabung
- Methoden der Diagnose
- Die Fehldiagnose
- Underarchiever
- Anforderungen an den Lehrer
- Arten der Förderung
- Akzeleration
- Enrichment
- Äußere Differenzierung
- Innere Differenzierung
- Das Elsa-Brändström-Gymnasium in Oberhausen
- Vereinbarung zum Bündnis für Erziehung und Lernen
- Das Drehtürmodell
- Die Laborschule Bielefeld
- Heterogenität an der Laborschule
- Das Stufenmodell
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Ziel dieser Arbeit ist es, verschiedene Ansätze zur Förderung von hochbegabten Schülern darzustellen und anhand von Beispielen aus der Praxis zu beleuchten. Dabei soll aufgezeigt werden, wie Begabung definiert und diagnostiziert werden kann, welche Anforderungen an Lehrkräfte gestellt werden und welche Arten der Förderung sich bewährt haben.
- Definition und Diagnose von Begabung
- Anforderungen an den Lehrer in der Förderung von Hochbegabten
- Verschiedene Arten der Förderung (z.B. Akzeleration, Enrichment, Differenzierung)
- Praktische Umsetzung der Förderung an Beispielen (Elsa-Brändström-Gymnasium, Laborschule Bielefeld)
- Vergleich der Ansätze und deren Stärken und Schwächen
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, in der die Problematik der Begabtenförderung und die Notwendigkeit einer individuellen Förderung für alle Schüler beleuchtet werden. Im zweiten Kapitel wird der Begriff „Begabung“ definiert, wobei zwei wichtige Modelle zur Erklärung von Begabung vorgestellt werden: Das Modell der triadischen Interdependenz von Franz J. Mönks und das Münchner (Hoch-)Begabungsmodell.
Kapitel 3 befasst sich mit der Diagnose von Begabung. Hier werden verschiedene Methoden vorgestellt und die Probleme der Fehldiagnose sowie die Besonderheiten von Underarchievern beleuchtet. Im Anschluss werden die Anforderungen, die an den Lehrer gestellt werden, um hochbegabte Schüler erfolgreich fördern zu können, im vierten Kapitel erläutert.
Kapitel 5 beschreibt verschiedene Arten der Förderung, darunter Akzeleration, Enrichment sowie äußere und innere Differenzierung. Die Kapitel 6 und 7 beleuchten die praktische Umsetzung der Förderung an den Beispielen des Elsa-Brändström-Gymnasiums in Oberhausen und der Laborschule Bielefeld.
Schlüsselwörter (Keywords)
Hochbegabung, Förderung, Diagnose, Akzeleration, Enrichment, Differenzierung, Elsa-Brändström-Gymnasium, Laborschule Bielefeld, heterogene Lerngruppen, Unterrichtspraxis, triadische Interdependenz, Münchner (Hoch-)Begabungsmodell.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Förderung von hochbegabten Schülern notwendig?
Eine individuelle Förderung ist notwendig, um jedem Schüler – unabhängig von seinem Begabungsniveau – eine optimale Entwicklung zu ermöglichen und Unterforderung zu vermeiden.
Was versteht man unter Akzeleration in der Begabtenförderung?
Akzeleration bedeutet das Beschleunigen der Schullaufbahn, beispielsweise durch das Überspringen von Klassen oder das vorzeitige Belegen von Kursen.
Was ist der Unterschied zwischen Enrichment und Differenzierung?
Enrichment bietet zusätzliche Lerninhalte über den Lehrplan hinaus, während Differenzierung (innerhalb oder außerhalb der Klasse) den Unterricht an verschiedene Leistungsniveaus anpasst.
Welche Modelle erklären Hochbegabung in dieser Arbeit?
Es werden insbesondere das Modell der triadischen Interdependenz von Franz J. Mönks und das Münchner (Hoch-)Begabungsmodell herangezogen.
Was sind Underachiever?
Underachiever sind Schüler, deren tatsächliche schulische Leistungen deutlich hinter ihrem intellektuellen Potenzial bzw. ihrer hohen Begabung zurückbleiben.
Wie setzen Schulen wie die Laborschule Bielefeld die Förderung um?
Diese Schulen nutzen Konzepte wie das Stufenmodell oder das Drehtürmodell, um der Heterogenität der Schüler gerecht zu werden und individuelle Lernpfade zu ermöglichen.
- Arbeit zitieren
- Peter Oehlenberg (Autor:in), 2008, Die Förderung von hochbegabten Schülern, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168826