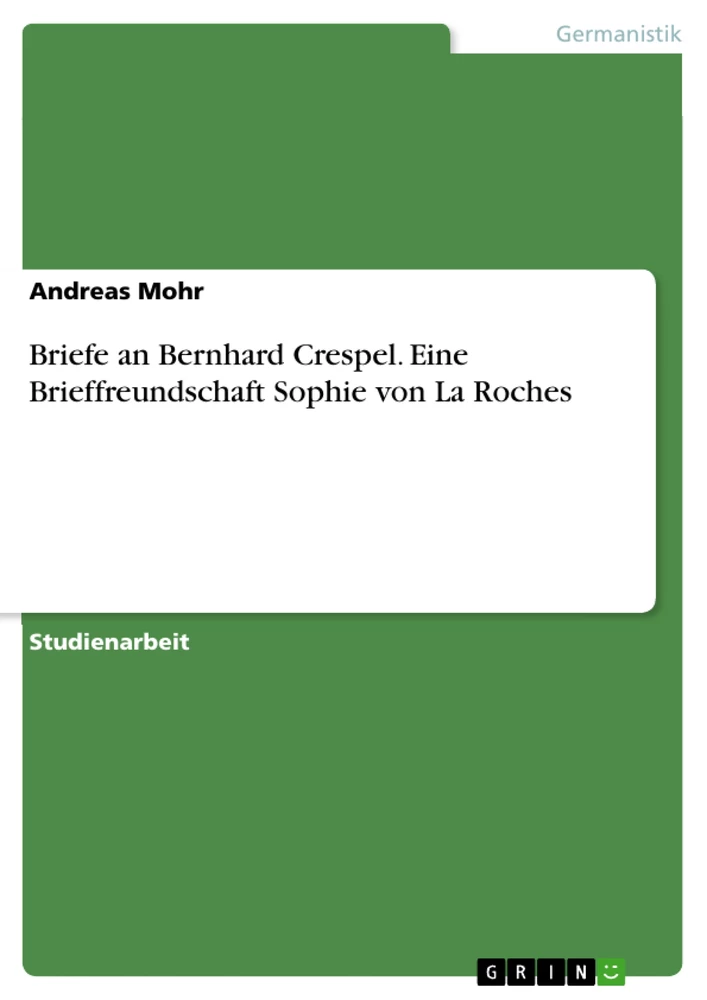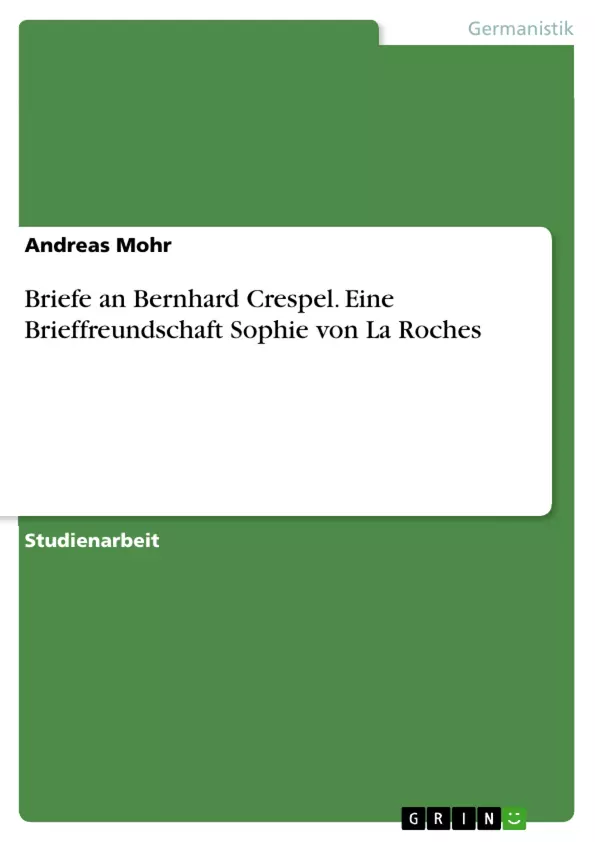Die Biographie der Sophie von La Roche ist schillernd: Von der Bürgertochter brachte sie es bis zur Hofdame, bevor sie schließlich als Schriftstellerin den Grundstein für ihren (späten) Ruhm legte. Sophie von La Roche war Deutschlands erste „Bestsellerautorin“ – ihr gelang es, sich bereits mit ihrem Debütroman „Die Geschichte des Fräuleins von Sternheim“ im männerdominierten Literaturbetrieb des 19. Jahrhunderts durchzusetzen. Die vorliegende Arbeit gibt einen kurzen Abriss über die Biographie Sophie von La Roches und schildert das dichte Beziehungsnetz, das die Großmutter Bettina von Arnims und Clemens Brentanos bis in den Frankfurter Zirkel um die Frau Rat Goethe knüpfte. Mit einem Mitglied dieses Kreises, Goethes Jugendfreund Bernhard Crespel, verband Sophie eine besonders tiefe und langjährige Freundschaft. Die vorliegende Arbeit vollzieht Sophies Werdegang nach, gibt einen Überblick über Sophies Beziehungsgeflecht und gibt einen Abriss über die Briefkulultur im Zeitalter der Empfindamkeit, von der Sophies private Korrespondenz ein beredtes Zeugnis ablegt: Dies zeigen vier ausgewählte Briefe Sophies an Bernhard Crespel, versehen mit einem Apparat sowie mit einem Kommentar.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Sophie von La Roche: Zur Rezeption und Edition
- 2. Von der Kaufbeurer Bürgertochter zur Mainzer Hofdame
- 2.1. Im Elternhaus: Zwischen Aufklärung und Pietismus
- 2.2. Bianconi und Wieland: Gehversuche einer Schriftstellerin
- 2.3. Die Ehe: Eine Bürgertochter als Hofdame
- 3. Sophie von La Roche: Schriftstellerin und Gesellschafterin
- 3.1. Der Durchbruch: ‚Die Geschichte des Fräuleins von Sternheim’
- 3.2. Zeiterscheinung Geselligkeit: Der literarische Salon in Ehrenbreitenstein
- 3.3. Der Kontakt zu Bernhard Crespel
- 4. Die Briefe
- 4.1. Der Briefverkehr zwischen Sophie von La Roche und Bernhard Crespel
- 4.2. Sophie als Briefautorin
- 4.3. Zur Briefauswahl und Textgestalt
- 4.4. Die Transkriptionen
- 5. Der Kommentar
- 5.1. Zur Vorgehensweise
- 5.2. Einzelstellenkommentar
- 5.2.1. 1. Brief an Bernhard Crespel vom 16. Januar 1776
- 5.2.2. 2. Brief an Bernhard Crespel vom 10. Dezember 1776
- 5.2.3. 3. Brief an Bernhard Crespel vom 13. Juli 1777
- 5.2.4. 4. Brief an Bernhard Crespel vom Januar 1778
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit der Korrespondenz zwischen Sophie von La Roche und Bernhard Crespel. Ziel ist es, diese Brieffreundschaft im Kontext von Sophies Leben und Werk sowie der Frankfurter Gesellschaft des späten 18. Jahrhunderts zu betrachten.
- Die Sozialisation und der Lebensweg Sophie von La Roches
- Die Rolle der Briefkultur in der zeitgenössischen empfindsamen Geselligkeit
- Die Beziehungen Sophie von La Roches zu wichtigen Persönlichkeiten ihres Umfelds, wie Christoph Martin Wieland, Johann Wolfgang Goethe und der Frankfurter Gesellschaft
- Die Bedeutung der Brieffreundschaft für Sophie von La Roche
- Die Auswahl und Edition ausgewählter Briefe Sophie von La Roches an Bernhard Crespel
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel beleuchtet die Rezeption Sophie von La Roches in der Literaturgeschichte und die Bedeutung ihrer Briefe. Der zweite Teil der Arbeit zeichnet einen biographischen Abriss über Sophies Leben: ihre Kindheit, ihre Beziehungen zu Bianconi und Wieland sowie ihre Ehe mit Georg Michael Frank von La Roche. Das dritte Kapitel widmet sich Sophies schriftstellerischem Werk, ihrem gesellschaftlichen Salon und ihrem Kennenlernen von Bernhard Crespel. Im vierten Kapitel werden ausgewählte Briefe Sophies transkribiert und analysiert, die Einblicke in ihre Persönlichkeit und ihre Beziehungen bieten. Der abschließende Kommentar erläutert und interpretiert die Briefe im Detail.
Schlüsselwörter (Keywords)
Sophie von La Roche, Brieffreundschaft, Bernhard Crespel, Frankfurter Gesellschaft, Empfindsamkeit, Briefkultur, Gesellschafterin, Schriftstellerin, Edition, Textkritik, Kommentar.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Sophie von La Roche?
Sophie von La Roche (1730–1807) war eine bedeutende deutsche Schriftstellerin und Salonière. Ihr Debütroman „Die Geschichte des Fräuleins von Sternheim“ machte sie zur ersten „Bestsellerautorin“ Deutschlands.
Welche Bedeutung hatte ihre Brieffreundschaft mit Bernhard Crespel?
Die langjährige Korrespondenz mit Crespel, einem Jugendfreund Goethes, ist ein wichtiges Zeugnis der Briefkultur des 18. Jahrhunderts und gibt Einblicke in das dichte soziale Netzwerk der Empfindsamkeit.
Was zeichnet die Briefkultur im Zeitalter der Empfindsamkeit aus?
Briefe waren in dieser Zeit nicht nur Informationsmittel, sondern dienten dem Ausdruck von Gefühlen, der Selbsterforschung und der Pflege intensiver freundschaftlicher Beziehungen innerhalb literarischer Zirkel.
In welchem Verhältnis stand Sophie von La Roche zu Goethe und Wieland?
Sophie war zeitweise mit Christoph Martin Wieland verlobt und blieb ihm lebenslang verbunden. Sie war zudem Teil des Frankfurter Kreises um Goethes Mutter und die Großmutter von Bettina von Arnim und Clemens Brentano.
Warum ist ihr Roman „Die Geschichte des Fräuleins von Sternheim“ so wichtig?
Es war einer der ersten psychologischen Romane in Deutschland, der die weibliche Perspektive in den Mittelpunkt stellte und den Weg für Frauen im Literaturbetrieb ebnete.
- Arbeit zitieren
- Andreas Mohr (Autor:in), 2007, Briefe an Bernhard Crespel. Eine Brieffreundschaft Sophie von La Roches, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168842