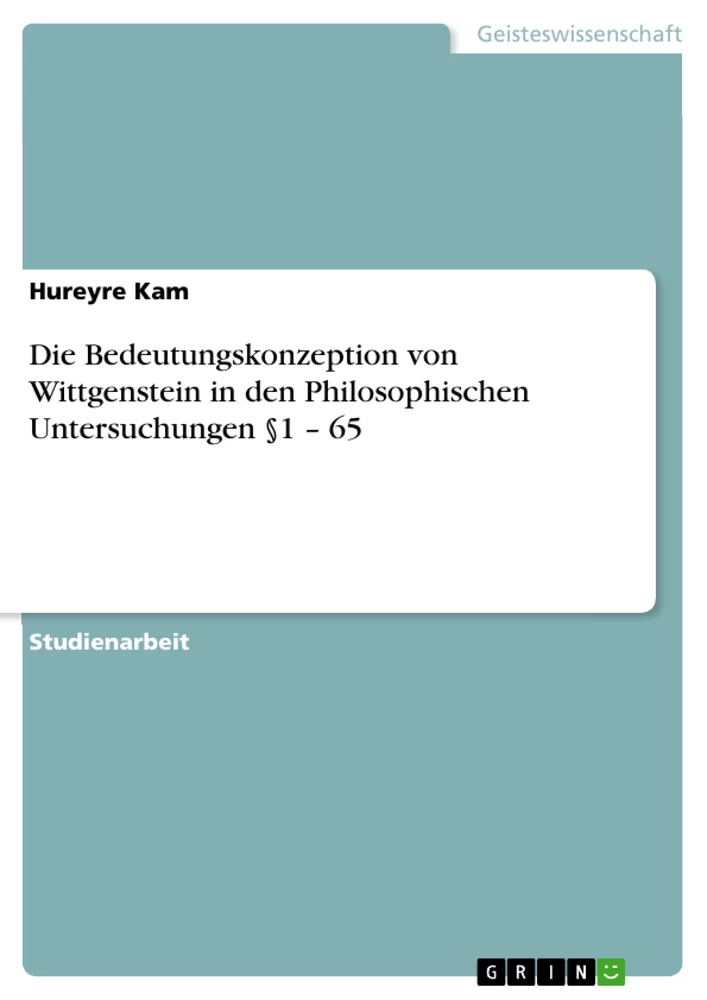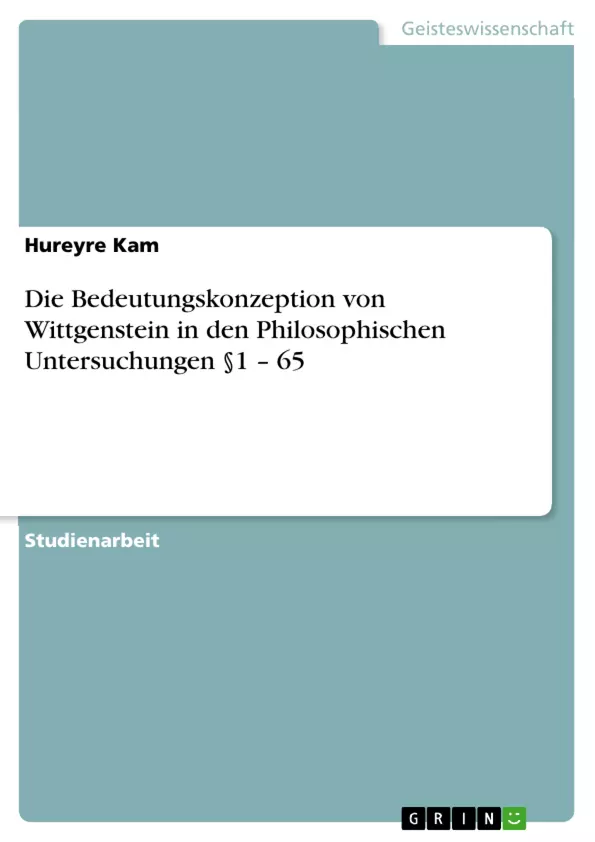Diese Arbeit hat es sich zur Aufgabe gemacht die Bedeutungskonzeption von Wittgenstein, soweit sich dies aus den ersten 65 Paragraphen der „Philosophischen Untersuchungen“ erschließen lässt, erläuternd darzulegen. Dabei werde ich als erstes auf die Bedeutungskonzeption des Augustinus eingehen. Aber dies nur insoweit, als sie aus dem ersten Paragraphen der PU ersichtlich ist. Die Position Augustinus ist die Grundlage auf der Wittgenstein seine eigenen Ansichten und Einsichten in Bezug auf das Funktionieren der Sprache entwickelt. Eben deshalb soll in dieser Arbeit auch stets versucht werden einen Rückbezug zu dieser Grundlage zu finden, um die Sachlage besser zu kontrastieren. Dieser Kontrast soll dazu dienen, dass man erstens das von Wittgenstein neu herausgearbeitete besser erkenne und zweitens, dass man somit ein Verständnis dafür gewinne, worin gerade das Besondere an seiner Konzeption besteht.
Weiterhin soll im Verlauf der Arbeit der „Tractatus Logico Philosophicus“ kurz angeschnitten werden, zumal schon Wittgenstein im Vorwort der PU erwähnt, dass er die PU am liebsten mit dem Tractatus zusammen veröffentlichen wollte, da diese erst durch den Kontrast zum Tractatus besser eingesehen werden könne.
Ich werde versuchen mich während der Arbeit ausschließlich mit dem Originaltext zu beschäftigen. Es wird also keine Sekundärliteratur zur Hilfe gezogen werden. Zumindest nicht insofern, dass ich meine Betrachtungen von Interpretationen aus zweiter Hand bezöge und im Weiteren darauf aufbaute. Wenn Informationen aus externen Quellen verarbeitet werden, so nur um manche Kontexte oder Rückbezüge klarzustellen, ohne die die Arbeit nicht fortkommen würde. Das Ergebnis dieser Arbeit wird – ob zufrieden stellend oder nicht – das Ergebnis meiner Bemühungen sein im Rahmen meiner Möglichkeiten Wittgensteins Gedanken nachzuvollziehen. Das Ergebnis soll schließlich allein die Bestrebungen eines Geistes widerspiegeln, welcher auf nackten Sohlen die Gedankenschritte eines großen Philosophen nachzuspüren sucht.
Im Folgenden liegt es mir im Sinn während der Ausarbeitung chronologisch vorzugehen – obschon das nicht immer möglich sein wird. Bevor jedoch mit der Hauptarbeit begonnen wird, scheint es mir von Vorteil zu sein aufgrund seiner Bedeutsamkeit auf das Vorwort näher einzugehen. Auf eine Zusammenfassung des Gesamtwerkes soll in diesem Zusammenhang verzichtet werden, da es nicht von unabdingbarer Relevanz für das Verständnis der ersten 65 Paragraphen ist.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- I. Einleitung
- II. Einführung
- 1. Das Vorwort
- 2. Gliederung und Methode
- III. Die Konzeption
- 1. Augustinus
- 2. Der Tractatus
- 3. Sprachspiele und Lebensformen
- 4. Eine Partie Schach
- 5. Die Taufe
- 6. Nothung – Das Schwert
- IV. „Denk nicht, sondern schau!“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Bedeutungskonzeption von Wittgenstein in den ersten 65 Paragraphen der Philosophischen Untersuchungen. Sie analysiert Wittgensteins Gedanken und stellt sie in Bezug zu früheren Positionen, insbesondere zu Augustinus und dem Tractatus Logico-Philosophicus.
- Kritik an der traditionellen metaphysischen Methode
- Die Bedeutung von Sprache als Werkzeug und in verschiedenen Kontexten
- Die Rolle von Sprachspielen und Lebensformen im Verständnis von Sprache
- Die Abkehr von einer einheitlichen "Glasheit" und die Betonung von "Familienähnlichkeiten"
- Der Aufruf, nicht zu denken, sondern zu schauen
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- I. Einleitung: Die Arbeit stellt die Zielsetzung dar, Wittgensteins Bedeutungskonzeption anhand der ersten 65 Paragraphen der Philosophischen Untersuchungen zu erläutern. Sie kündigt an, Augustinus und den Tractatus als Bezugspunkte heranzuziehen.
- II. Einführung:
- 1. Das Vorwort: Das Vorwort der Philosophischen Untersuchungen wird analysiert. Es beleuchtet die Entwicklungsgeschichte des Werkes und Wittgensteins Haltung gegenüber einer abschließenden Theorie der Sprache.
- 2. Gliederung und Methode: Die Arbeit beleuchtet die ungewohnte Struktur der Philosophischen Untersuchungen und Wittgensteins spezifische Denkweise, die sich von der traditionellen Argumentationsweise abhebt. Sie betont die Wichtigkeit von Beschreibung statt Erklärung und die Rolle von alltäglichen Beispielen.
- III. Die Konzeption:
- 1. Augustinus: Wittgensteins Kritik an Augustinus' Bedeutungskonzeption wird dargestellt. Augustinus' Vorstellung von Sprache als Benennung von Gegenständen wird als unzureichend betrachtet, da sie die Komplexität der Sprache übersieht.
- 2. Der Tractatus: Die Arbeit beschreibt Wittgensteins Abkehr vom Tractatus und seiner früheren Theorie, dass Sprache ein Bild der Welt ist. Der Tractatus wird als Ausdruck einer theoretisierenden Haltung kritisiert, die von der Sprachrealität abgekoppelt sei.
- 3. Sprachspiele und Lebensformen: Wittgensteins Konzept von Sprachspielen und Lebensformen wird erklärt. Die Bedeutung eines Wortes wird als abhängig vom Kontext und der Sprachgemeinschaft gesehen. Es gibt keine einheitliche Bedeutung, sondern vielfältige Verwendungsmöglichkeiten.
- 4. Eine Partie Schach: Das hinweisende Lehren von Wörtern wird anhand des Beispiels des Schachspiels erläutert. Die Bedeutung eines Wortes wird nicht durch die hinweisende Definition erschlossen, sondern setzt bereits ein bestimmtes Vorwissen voraus.
- 5. Die Taufe: Wittgensteins Kritik an der Vorstellung von "Namen" als elementaren Bestandteilen der Sprache wird erläutert. Die Namensgebung wird als ein Akt der "Taufe" betrachtet, der die Bedeutung eines Wortes nicht erschließt.
- 6. Nothung – Das Schwert: Die Arbeit stellt Wittgensteins Unterscheidung zwischen dem Träger des Namens und dessen Bedeutung dar. Die Bedeutung eines Wortes wird nicht mit seinem Träger identisch, sondern ist an seinen Gebrauch in der Sprache gebunden.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen der Sprachphilosophie, wie Bedeutung, Sprachspiel, Lebensform, Familienähnlichkeit, hinweisende Definition, Sprachlogik, und die Abkehr von einer abstrakten Theorie der Sprache zugunsten einer pragmatischen Betrachtungsweise. Sie zeigt Wittgensteins Einfluss auf die Entwicklung der modernen Sprachphilosophie auf und beleuchtet die Komplexität des menschlichen Sprachgebrauchs.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Wittgensteins zentrale These in den Philosophischen Untersuchungen?
Wittgenstein bricht mit der Vorstellung einer einheitlichen Sprachlogik und betont, dass die Bedeutung eines Wortes durch dessen Gebrauch in "Sprachspielen" bestimmt wird.
Warum kritisiert Wittgenstein Augustinus?
Er kritisiert Augustinus' Auffassung, dass Sprache primär aus dem Benennen von Gegenständen besteht, da dies die vielfältigen Funktionen der Sprache ignoriert.
Was versteht Wittgenstein unter 'Familienähnlichkeiten'?
Es beschreibt das Phänomen, dass Begriffe (wie 'Spiel') keine gemeinsame Essenz haben, sondern durch ein Netz überlappender Ähnlichkeiten miteinander verwandt sind.
Wie unterscheidet sich die PU von Wittgensteins früherem Werk 'Tractatus'?
In der PU rückt er von der Abbildtheorie der Sprache ab und ersetzt die Suche nach einer idealen Logik durch die Beschreibung des alltäglichen Sprachgebrauchs.
Was bedeutet der Aufruf 'Denk nicht, sondern schau!'?
Es ist eine Aufforderung, keine theoretischen Erklärungen zu konstruieren, sondern die tatsächliche Verwendung der Sprache in der Realität unvoreingenommen zu beobachten.
- Quote paper
- M.A Hureyre Kam (Author), 2008, Die Bedeutungskonzeption von Wittgenstein in den Philosophischen Untersuchungen §1 – 65, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168858