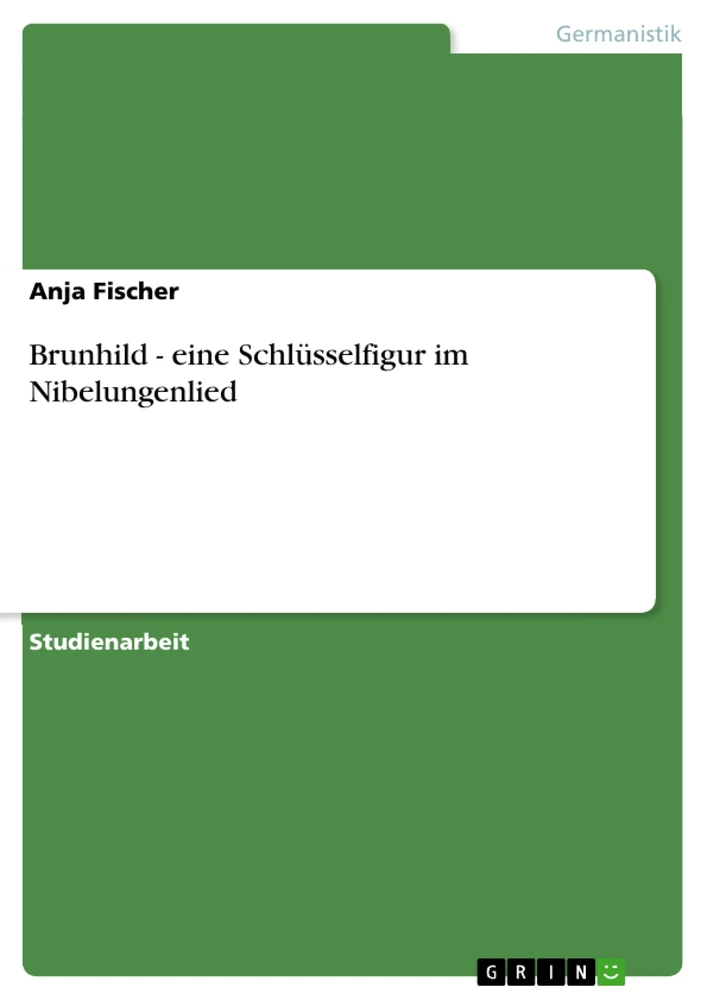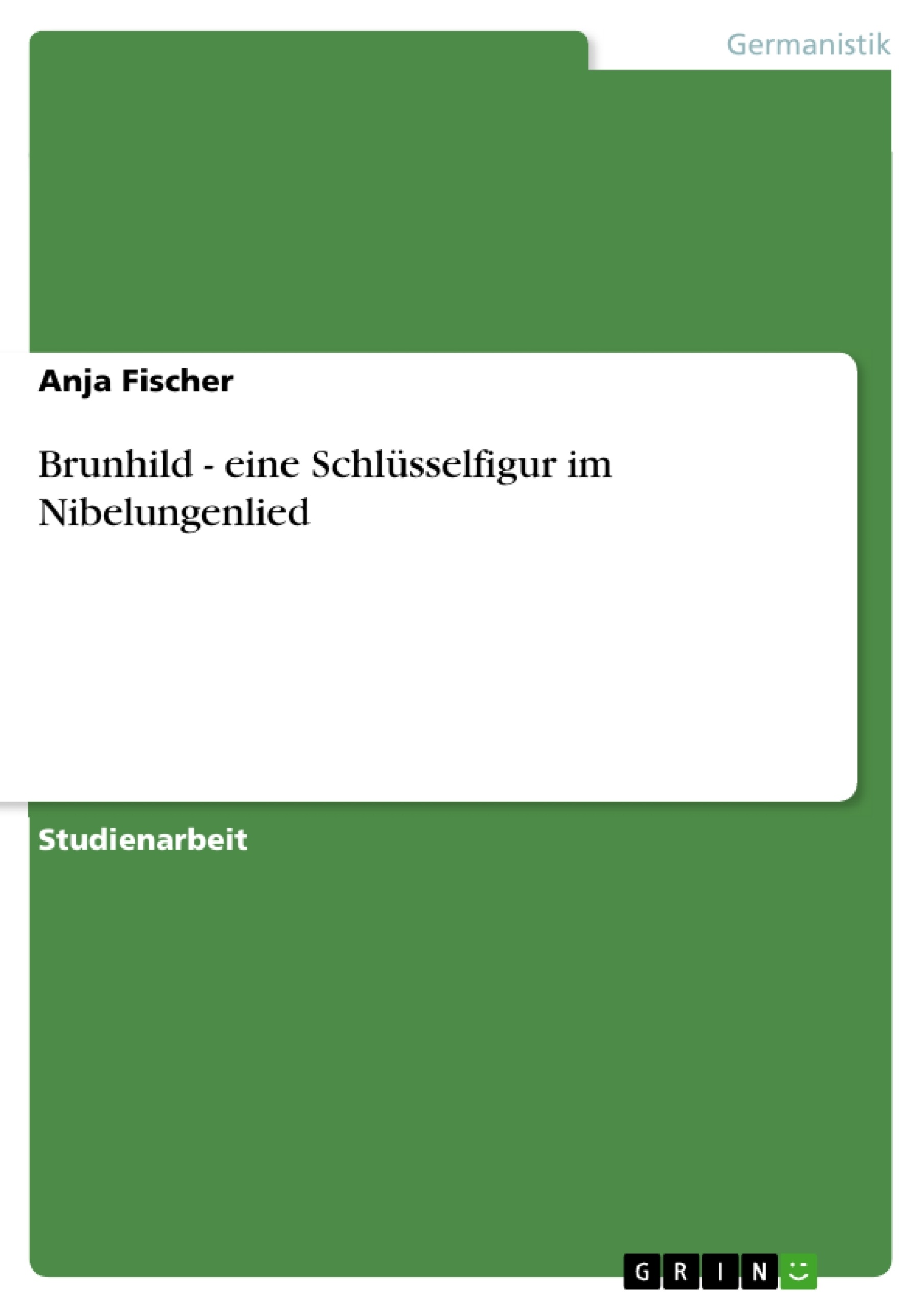Brunhild gehört neben Gunther, Siegfried, Kriemhild und Hagen nicht nur zum Kreis der fünf wichtigsten Figuren im Nibelungenlied. Nein, sie steht auch an der Herrschaftsspitze einer matriarchalischen Gesellschaft. Obwohl ihr Auftritt gemessen an der Länge des Nibelungenliedes eher kurz ist, hält diese ungewöhnliche Figur mehr als genug Untersuchungsstoff bereit: sie ist eine mit übermenschlichen Kräften ausgestattete Walküre genauso wie Betrugsopfer, liebende Ehefrau, gekränkte Eitelkeit und erfolgreiche Intrigantin. Die vorliegende Arbeit wird sie in ihrem vielseitigen Rollen genau unter die Lupe nehmen. Dabei sind sowohl literarische Normen des Mittelalters als auch die rekonstruierte damalige Realität als Bezugrahmen mit in die Analyse eingewebt. Die erste Frage, die sich beim Herantasten an Brunhild stellt ist, ob diese ungewöhnliche Figur ausschließlich der Phantasie des Dichters entsprungen ist oder ob sie einer Königin nachempfunden ist, die tatsächlich existierte. Um diese Frage beantworten zu können, haben Forscher tief gegraben und ein mögliches historisches Vorbild zu Tage gefördert, dessen angeblicher Lebensweg fast ebenso effektvoll und schauderhaft tragisch ist, wie der ihrer literarischen Erbin. Nachdem ihr vermeintliches historisches Modell hinreichend abgeklopft ist, zentriert sich die Betrachtung ganz auf sie. Da es sich bei Brunhild durch ihre Stärke und ihr Kraft erprobendes Auswahlverfahren unzweifelhaft um eine mit männlichen Merkmalen versehene Frau handelt, wird der ihre Konstruktion verhandelnde Themenkomplex durch die für die Untersuchung notwendige Theorie über das Ideal der ´männlichen Frau´ eingeleitet. Im Nibelungenlied kommt Brunhild streng genommen nur in zwei Räumen vor. Einmal als souveräne Herrscherin in Island und einmal als domestizierte Ehefrau in Worms. Daher scheint es nur folgerichtig, dass der nächste Schwerpunkt auf ihr Ehekonzept gelegt ist. Wie verlief die Minne und wie sah die Ehe zwischen Adligen üblicherweise aus? Fügt sich Brunhilds Ehe darin ein? Bei der Analyse hat sich neben dem Nutzen schnell die Gefahr der geschlossenen Bündnisse herausgestellt, woraufhin dieser Beobachtung extra Analyseraum geschaffen wurde. Durch die allgemeine Strategie, vom Generellem zum Speziellen thematisch immer weiter zu verdichten, gipfelt die Arbeit anschließend im Dreh- und Angelpunkt des Nibelungenliedes: dem Werbungsbetrug.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Historisches Vorbild
- 2.1 Der Blutrachekrieg zwischen Austrien und Neustrien
- 2.2 Brunhild, Königin der Burgunden
- 2.3 Parallelen zwischen Historie und Nibelungenlied
- 3. Die Figur 'Brunhild' im Nibelungenlied
- 3.1 Das Ideal der 'manlîchiu wîp' in der mittelalterlichen Literatur
- 3.2 Die Zwiespältigkeit zwischen verführerischer Schönheit und Verderbnis
- 3.3 Die Zähmung der Widerspenstigen
- 4. Die Ehekonzeptionen
- 4.1 Übliches Ehemodell, Werbungsverhalten und Minneaffekt
- 4.2 Das politische Funktionieren eines Herrscherpaares
- 4.3 Die Bewährung des Wormser Herrscherpaares
- 4.4 Die Ambivalenz der Eheallianzen
- 5. Die Brautwerbung
- 5.1 Gunthers Werbungsmotive
- 5.2 Werbungsbetrug und Verschiebung der Machtverhältnisse
- 5.3 Brunhilds Rolle bei der Zuspitzung der Ereignisse
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die vielschichtige Figur Brunhild im Nibelungenlied. Ziel ist es, Brunhilds Rolle im Kontext der mittelalterlichen Literatur und der rekonstruierten historischen Realität zu analysieren. Dabei werden sowohl literarische Normen als auch mögliche historische Vorbilder berücksichtigt.
- Brunhilds historisches Vorbild und mögliche Parallelen zum Nibelungenlied
- Das Ideal der „manlîchiu wîp“ und Brunhilds Darstellung als starke, unabhängige Frau
- Brunhilds Ehe mit Gunther und die damit verbundenen politischen und sozialen Aspekte
- Die Brautwerbung und der damit verbundene Betrug als zentraler Konfliktpunkt
- Die Ambivalenz von Brunhilds Charakter: zwischen Stärke, Schönheit und Intrige
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt die zentrale Figur Brunhild ein und stellt ihre Bedeutung für das Nibelungenlied heraus. Sie beschreibt Brunhild als komplexe Figur mit übermenschlichen Kräften, aber auch als Opfer von Betrug und Intrigen. Die Arbeit kündigt an, Brunhilds vielseitige Rollen im Kontext der mittelalterlichen Literatur und möglicher historischer Vorbilder zu untersuchen.
2. Historisches Vorbild: Dieses Kapitel erörtert die Suche nach einem historischen Vorbild für Brunhild. Es präsentiert die These, dass Brunhild, die Tochter des Westgotenkönigs Athanagild, ein mögliches Vorbild sein könnte, basierend auf den Aufzeichnungen von Gregor von Tours. Der Fokus liegt auf Brunhilds Leben, ihrer Heirat mit Sigibert I. und dem darauffolgenden Blutrachekrieg gegen ihren Schwager Chilperich I. Die Parallelen zwischen dem historischen Vorbild und der literarischen Figur Brunhild werden angedeutet.
3. Die Figur 'Brunhild' im Nibelungenlied: Dieses Kapitel analysiert Brunhilds Darstellung im Nibelungenlied. Es untersucht sie im Kontext des Ideals der „manlîchiu wîp“ – der starken, männlichen Frau – der mittelalterlichen Literatur. Die Analyse konzentriert sich auf die Ambivalenz von Brunhilds Charakter, ihre Stärke und ihren Einfluss, ihre verführerische Schönheit und ihre Rolle als Opfer und Intrigantin. Die „Zähmung der Widerspenstigen“ wird als zentraler Aspekt ihrer Geschichte innerhalb des Epos betrachtet.
4. Die Ehekonzeptionen: Dieses Kapitel befasst sich mit den Ehekonzeptionen des Mittelalters und Brunhilds Ehe mit Gunther. Es beleuchtet das übliche Ehemodell, das Werbungsverhalten und den Minneaffekt im Kontext der damaligen Gesellschaft. Die Analyse konzentriert sich auf die politische Funktion der Ehe zwischen Herrschern und die Bewährung des Wormser Herrscherpaares. Die Ambivalenz der Eheallianzen und die damit verbundenen Risiken werden ebenfalls thematisiert.
5. Die Brautwerbung: Dieses Kapitel analysiert die Brautwerbung um Brunhild als zentralen Wendepunkt des Nibelungenliedes. Es untersucht Gunthers Motive, den Betrug bei der Werbung und die daraus resultierende Verschiebung der Machtverhältnisse. Besonders wird Brunhilds Rolle bei der Zuspitzung der Ereignisse untersucht, indem ihr Anteil am Konflikt und ihre Reaktionen auf die Ereignisse im Detail analysiert werden.
Schlüsselwörter
Nibelungenlied, Brunhild, historisches Vorbild, manlîchiu wîp, Ehekonzeptionen, Brautwerbung, Werbungsbetrug, Machtverhältnisse, Mittelalter, literarische Analyse.
Häufig gestellte Fragen zum Nibelungenlied: Brunhild - Analyse einer komplexen Figur
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert die vielschichtige Figur Brunhild im Nibelungenlied. Sie untersucht Brunhilds Rolle im Kontext der mittelalterlichen Literatur und der rekonstruierten historischen Realität, unter Berücksichtigung literarischer Normen und möglicher historischer Vorbilder.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit Brunhilds möglichem historischen Vorbild und Parallelen zum Nibelungenlied, dem Ideal der „manlîchiu wîp“ und Brunhilds Darstellung als starke, unabhängige Frau, ihrer Ehe mit Gunther und den damit verbundenen politischen und sozialen Aspekten, der Brautwerbung und dem damit verbundenen Betrug als zentraler Konfliktpunkt, sowie der Ambivalenz von Brunhilds Charakter: zwischen Stärke, Schönheit und Intrige.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt die Figur Brunhild ein und beschreibt die Ziele der Arbeit. Kapitel 2 (Historisches Vorbild) erörtert die Suche nach einem historischen Vorbild für Brunhild, z.B. Brunhild, Tochter des Westgotenkönigs Athanagild. Kapitel 3 (Die Figur 'Brunhild' im Nibelungenlied) analysiert Brunhilds Darstellung im Nibelungenlied im Kontext des Ideals der „manlîchiu wîp“. Kapitel 4 (Die Ehekonzeptionen) behandelt die Ehekonzeptionen des Mittelalters und Brunhilds Ehe mit Gunther. Kapitel 5 (Die Brautwerbung) analysiert die Brautwerbung um Brunhild als zentralen Wendepunkt des Nibelungenliedes. Kapitel 6 (Fazit) fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Nibelungenlied, Brunhild, historisches Vorbild, manlîchiu wîp, Ehekonzeptionen, Brautwerbung, Werbungsbetrug, Machtverhältnisse, Mittelalter, literarische Analyse.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, Brunhilds Rolle im Nibelungenlied umfassend zu analysieren und ihre Bedeutung im Kontext der mittelalterlichen Literatur und möglicher historischer Vorbilder zu ergründen.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die genaue Quellenangabe ist nicht im gegebenen HTML-Auszug enthalten. Die Arbeit bezieht sich aber offensichtlich auf das Nibelungenlied selbst und historische Quellen (z.B. Gregor von Tours) zur Rekonstruktion eines möglichen historischen Vorbilds für Brunhild.
- Quote paper
- Anja Fischer (Author), 2005, Brunhild - eine Schlüsselfigur im Nibelungenlied, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168883