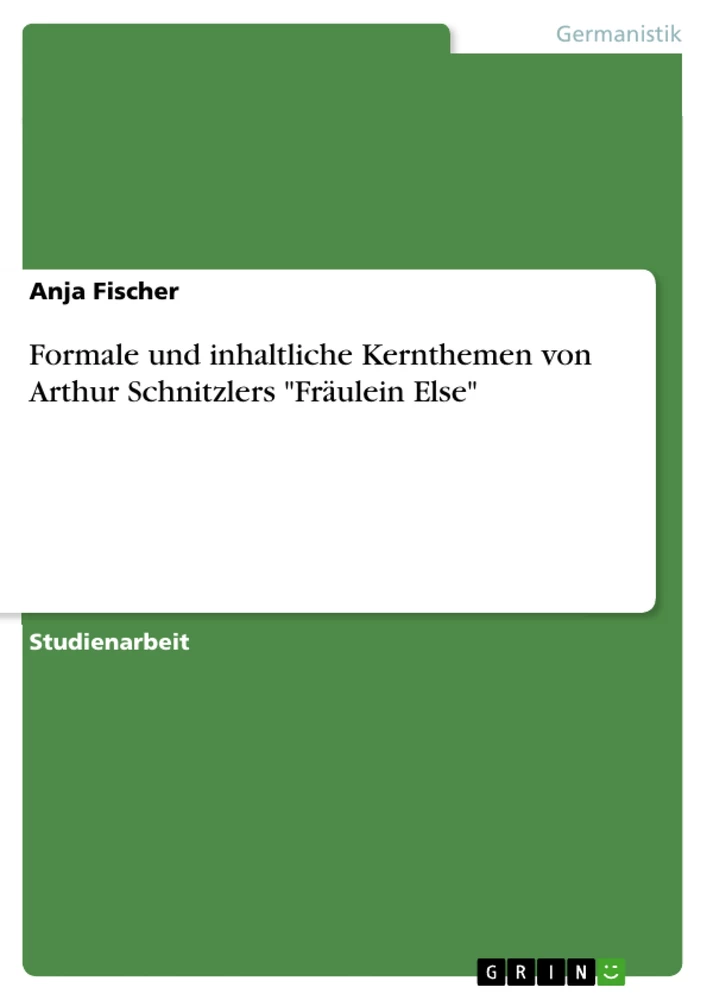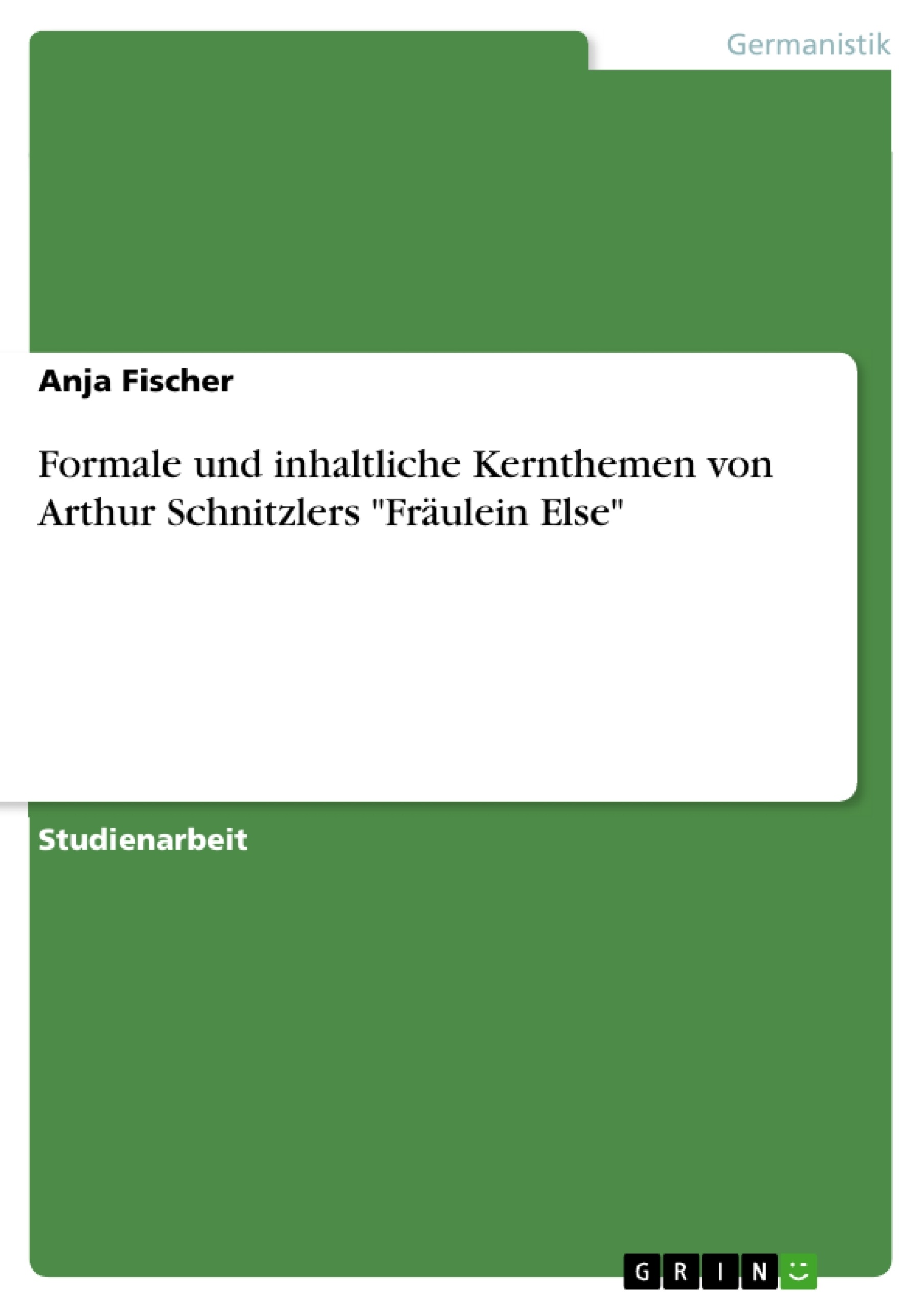Diese Arbeit beschäftigt sich mit formalen wie inhaltlichen Kernthemen von “Fräulein Else“, um sie im Rahmen einer Gesamtdeutung miteinander zu verquicken. Eine erschöpfende Interpretation ist jedoch aufgrund der Komplexität und Vielschichtigkeit der Einzelaspekte sowie deren Deutungsalternativen nicht möglich. Daher wird es an einigen Stellen bei Ansätzen und Anmerkungen bleiben müssen- die grundsätzliche Zielsetzung bleibt davon aber unbeeinträchtigt.
Besonderes Augenmerk wird auf die Untersuchung der Figuren und deren Beziehung zueinander gelegt, da den handelnden Personen als Repräsentanten des herrschenden Systems eine spezielle Bedeutung zukommt. Zudem wird der Versuch unternommen ’Fräulein Else’ als eine Art Fallgeschichte zu lesen um dem psychologischen Diskurs mehr Raum zu geben.
Ein weiterer zentraler Punkt in Schnitzlers Text wie auch auf den folgenden Seiten ist die Erpressung Elses. Warum und wie ist Else erpressbar? Wie geht sie mit dieser Fremdbestimmung um? Fragen, die im Laufe der vorliegenden Arbeit beantwortet werden sollen.
Der Aufbau der Arbeit folgt dabei im Groben folgender Struktur: beginnend mit Elses Innenperspektive, tastet sich die Analyse anschließend an das Außen heran, um dann auf die Else umgebenden Figuren überzuspringen. Alle drei Punkte liefern wichtige Erkenntnisse, die Elses Selbstmord erklären oder gar begünstigen. Aus diesem Grunde ist der Selbstmorddiskurs quasi als Schlusspunkt gesetzt.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Das „Selbst“
- Implikationen des inneren Monologs
- Fremd- und Selbstzensur
- Rollenspaltung
- Sehen und gesehen werden
- Beobachtungsposition
- Enthüllung
- Ersatzfiguren
- Vaterfiguren
- Elses Vater
- Direktor Wilomitzer
- Herr von Dorsday
- Elses Cousin Paul
- Der Filou
- Frauenfiguren
- Elses Mutter
- Cissy Mohr
- Elses Tante
- Vaterfiguren
- Selbstmord
- Suizid
- Todeswunsch
- Spielarten des Todes
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit befasst sich mit formalen wie inhaltlichen Kernthemen von „Fräulein Else“, um sie im Rahmen einer Gesamtdeutung miteinander zu verquicken. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Untersuchung der Figuren und deren Beziehung zueinander gelegt. Zudem wird der Versuch unternommen, ’Fräulein Else’ als eine Art Fallgeschichte zu lesen, um dem psychologischen Diskurs mehr Raum zu geben.
- Elses Innenperspektive und ihre Beziehung zu den Figuren in ihrer Umgebung
- Elses „Selbst“ und die Auswirkungen der gesellschaftlichen Normen auf ihre Identität
- Die Rolle der Beobachtungsposition in Elses Selbstverständnis und ihrer Beziehung zur Welt
- Vaterfiguren in Elses Leben und ihre Bedeutung für ihr Schicksal
- Der Suizid Elses im Kontext ihrer psychischen Verfassung und der sie umgebenden Umstände
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit dar.
- Das „Selbst“: Dieser Abschnitt analysiert Elses Selbstverständnis im Kontext der gesellschaftlichen Normen und Rollenvorstellungen.
- Sehen und gesehen werden: Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit Elses doppelter Beobachtungsposition - als Beobachtete und Beobachterin - und ihrer Bedeutung für ihre Selbsteinsicht und -inszenierung.
- Ersatzfiguren: In diesem Kapitel werden Elses Vaterfiguren und Frauenfiguren analysiert und deren Einfluss auf ihr Leben und ihren Tod beleuchtet.
- Selbstmord: Dieser Abschnitt betrachtet Elses Selbstmord aus psychologischer Sicht und untersucht die Ursachen und Auslöser ihrer Tat.
Schlüsselwörter (Keywords)
Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: „Fräulein Else“, Arthur Schnitzler, Selbstmord, Geschlechterrollen, gesellschaftliche Normen, Identitätskrise, Beobachtungsposition, Vaterfiguren, Frauenfiguren, innerer Monolog, Psychologiediskurs, Emanzipation.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Schnitzlers „Fräulein Else“?
Die Novelle thematisiert die psychische Notlage der jungen Else, die von ihrer Familie gedrängt wird, sich für Geld nackt zu zeigen, um die Schulden ihres Vaters zu begleichen.
Was ist das Besondere am Erzählstil von „Fräulein Else“?
Schnitzler nutzt konsequent den inneren Monolog, um Elses ungefilterte Gedanken, Ängste und ihre Identitätskrise für den Leser unmittelbar erlebbar zu machen.
Warum begeht Else am Ende Selbstmord?
Der Suizid wird als Folge der ausweglosen Erpressung, der psychischen Zerrüttung und des Konflikts mit den herrschenden gesellschaftlichen Normen analysiert.
Welche Rolle spielen die Vaterfiguren in der Novelle?
Figuren wie Elses Vater oder Herr von Dorsday repräsentieren ein ausbeuterisches System, das Else zur Ware degradiert.
Was bedeutet das Motiv „Sehen und gesehen werden“?
Es beschreibt Elses Beobachtungsposition in der Gesellschaft und die traumatische Erfahrung der Enthüllung vor den Blicken anderer.
- Citation du texte
- Anja Fischer (Auteur), 2007, Formale und inhaltliche Kernthemen von Arthur Schnitzlers "Fräulein Else", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168886