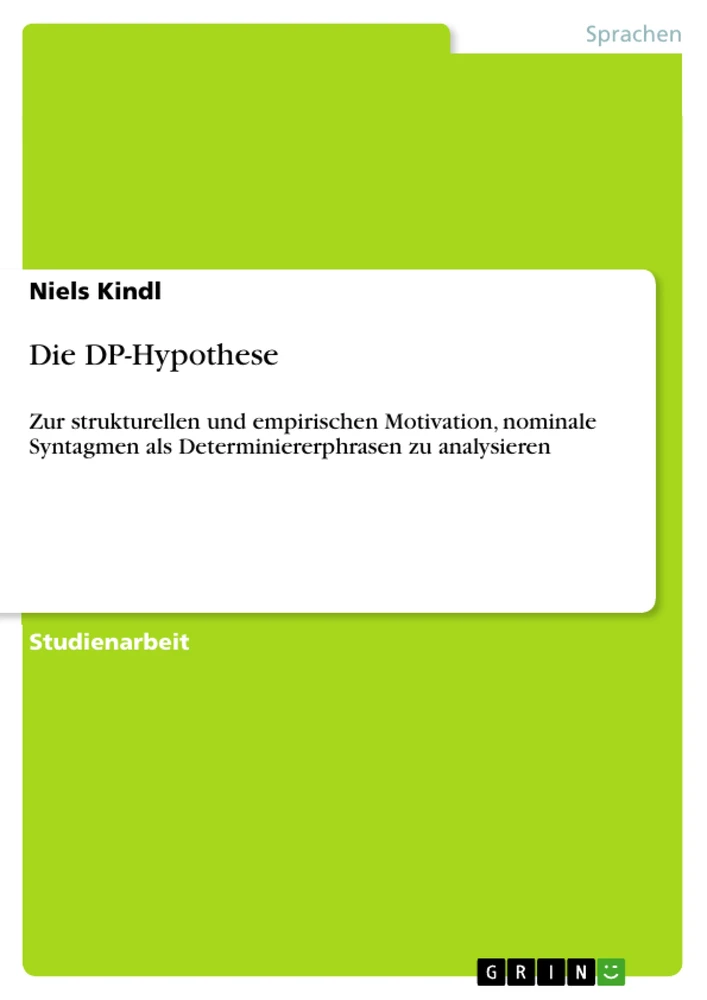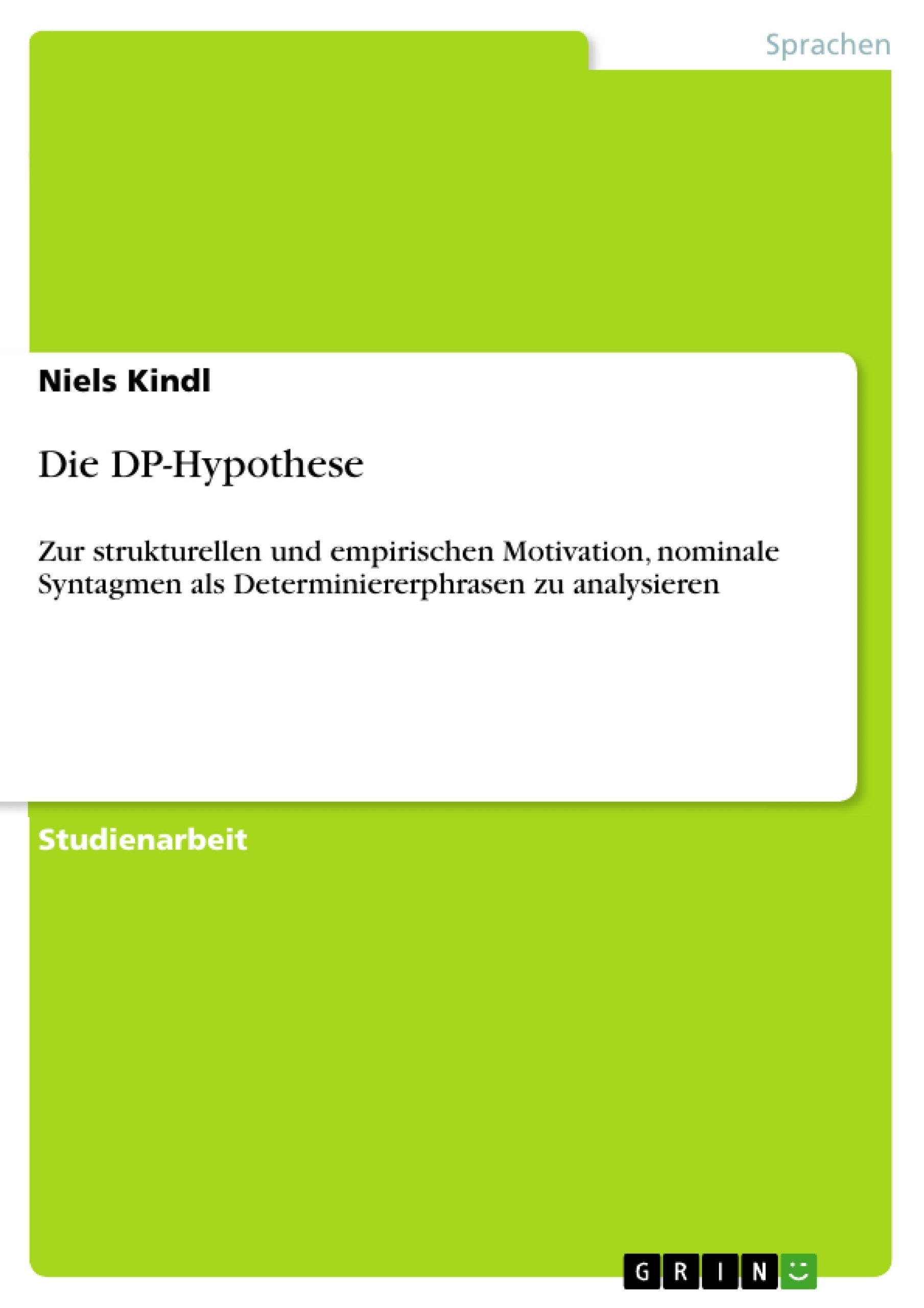Nominale Syntagmen werden traditionell als Nominalphrase analysiert, deren Kopf das lexikalische Element N bildet. Diese Analyse scheint im ersten Moment im Lichte verschiedener linguistischer Theoriebereiche absolut nachvollziehbar zu sein, da Nomina aus semantischer Sicht (a) die zentralen lexikalischen Informationen des nominalen Syntagmas tragen, aus morpho-syntaktischer Sicht (b) die Kategorie Genus im Nomen inhärent ist sowie aus syntaktischer Sicht (c) zählbare Nomina im Singular einen Determinierer selegieren und (d) Nomina im Plural distributionell äquivalent zu einer vollen NP sind.
Nichtsdestoweniger ist die Analyse des Nomens als Kopf der NP durchaus umstritten: So ist der Determinierer im Deutschen stärker markiert als das Nomen, was sich auf der Sprachoberfläche daran zeigt, dass das Genus am Determinierer und nicht am Nomen selbst markiert ist. Außerdem können Nomina nicht immer ohne Determinierer eine NP bilden und sind darüber hinaus auch nicht immer obligatorisch.
Neben diesen Argumenten, die zweifelsohne gegen den Kopfstatus des Nomens im nominalen Syntagma sprechen, ergeben sich beim Vergleich der Strukturen von NPs mit Sätzen weitere Evidenzen, den bisherigen Kopfstatus des Nomens in der NP zu verwerfen und eine sog. funktionale Kategorie als Kopf anzunehmen. Im Sinne eines universellen Aufbaus von Phrasen ist es ein sicherlich wünschenswertes Ziel, nominale Syntagmen parallel zu Sätzen zu analysieren, wie es erstmals ABNEY (1987: 21) für das Englische vorschlägt.
Mit BHATT (vgl. 1990: 18) werden auf diese Weise die strukturellen Parallelen zwischen nominalen Syntagmen und Sätzen theoretisch erfasst.
Ziel dieser Arbeit ist es, ausgehend von der strukturellen Analyse von Sätzen in einem erweiterten X-Bar-Schema eine zu Sätzen analoge Analyse des nominalen Syntagmas in Anlehnung an ABNEY (1987) vorzuschlagen, strukturell zu motivieren und argumentativ zu fundieren. Hierbei richtet sich der Fokus neben den funktionalen Eigenschaften von Köpfen auch auf die kategoriale Form des Spezifizierers, die beim Vergleich von Satz und traditioneller NP signifikant voneinander abweicht.
Abschließend soll gezeigt werden, dass eine DP-Analyse nicht nur theoriegeleitet infolge struktureller Parallelität zur Analyse von Sätzen, sondern auch im Hinblick auf die Analyse ausgewählter sprachlicher Phänomene – also auf Basis empirischer Befunde wie ‚Indefinita‘, ‚Pronomen‘ und ‚Pränominale Genitive‘ – im Vergleich zu einer NP-Analyse zu präferieren ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur X-Bar-Struktur von Sätzen
- Die Struktur der CP
- Die Struktur der TP
- Gemeinsamkeiten von CP und TP
- Das nominale Syntagma
- Zur traditionellen Nominalphrase
- CP/TP-Analyse und traditionelle NP-Analyse im Vergleich
- Die DP-Hypothese
- Erweiterung der NP um die funktionale Kategorie D°
- Zur Argumentstruktur von Verben und Nomina
- ,,In Sachen Nullartikel''
- Zur f-Selektion im nominalen Syntagma
- Die DP-Hypothese - ein Zwischenfazit
- Was kann die DP-Hypothese leisten?
- Indefinita
- Pronomen
- Pränominale Genitive
- Konklusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Analyse des nominalen Syntagmas im Deutschen. Ziel ist es, die traditionelle Analyse der Nominalphrase (NP) mit dem Kopf N° in Frage zu stellen und eine alternative Analyse als Determiniererphrase (DP) vorzuschlagen. Hierbei wird die strukturelle Motivation für die DP-Analyse im Vergleich zur Struktur von Sätzen (CP und TP) erörtert.
- Strukturelle Parallelen zwischen Sätzen und nominalen Syntagmen
- Die Rolle des Determinierers in der Analyse des nominalen Syntagmas
- Empirische Evidenz für die DP-Hypothese anhand von Indefinita, Pronomen und pränominalen Genitiven
- Vergleich der DP-Analyse mit der traditionellen NP-Analyse
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die traditionelle Analyse des nominalen Syntagmas als NP vorstellt und die Problematik dieser Analyse anhand von Beispielen aus dem Deutschen erläutert. Im zweiten Kapitel wird die Struktur von Sätzen, speziell die CP und die TP, im Rahmen der neuen Generativen Grammatiken dargestellt. Der Vergleich der Strukturen von Sätzen und nominalen Syntagmen legt den Grundstein für die in Kapitel 3 vorgeschlagene DP-Analyse. In diesem Kapitel wird die DP-Hypothese im Detail vorgestellt und mit der traditionellen NP-Analyse verglichen. Die Erweiterung der NP um die funktionale Kategorie D° wird diskutiert, ebenso die Argumentstruktur von Verben und Nomina, sowie die Rolle des Nullartikels. Weiterhin werden die f-Selektion im nominalen Syntagma sowie die Vorteile der DP-Hypothese gegenüber der NP-Analyse beleuchtet. Kapitel 4 befasst sich mit den empirischen Daten, die die DP-Hypothese stützen. Dabei werden Indefinita, Pronomen und pränominale Genitive im Deutschen analysiert und die Vorzüge der DP-Analyse in diesen Bereichen aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen der Syntax, insbesondere mit der Analyse des nominalen Syntagmas im Deutschen. Die DP-Hypothese, X-Bar-Struktur, CP, TP, funktionale Kategorien, Determinierer, NP, Indefinita, Pronomen und pränominale Genitive stehen im Mittelpunkt der Ausführungen. Die Arbeit stellt den Vergleich der strukturellen Motivation der DP-Analyse mit der traditionellen NP-Analyse in den Vordergrund und zeigt die Vorteile der DP-Analyse anhand empirischer Daten auf.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kernaussage der DP-Hypothese?
Die DP-Hypothese besagt, dass nicht das Nomen (N), sondern der Determinierer (D) der Kopf eines nominalen Syntagmas ist, weshalb man von einer Determiniererphrase (DP) spricht.
Welche strukturellen Parallelen gibt es zwischen Sätzen und DPs?
Die DP-Analyse ermöglicht es, nominale Syntagmen parallel zu Sätzen (CP/TP) zu analysieren, wobei der Determinierer eine ähnliche funktionale Rolle einnimmt wie Köpfe in der Satzstruktur.
Wie erklärt die DP-Hypothese Pronomen?
In der DP-Analyse werden Pronomen als Köpfe der Kategorie D° betrachtet, die ohne ein lexikalisches Komplement (Nomen) auftreten können.
Was ist ein „Nullartikel“ in diesem Zusammenhang?
Wenn ein Nomen ohne sichtbaren Artikel erscheint, wird in der DP-Theorie oft ein abstrakter, nicht hörbarer Kopf (Nullartikel) angenommen, um die strukturelle Einheitlichkeit zu wahren.
Warum wird die traditionelle NP-Analyse in Frage gestellt?
Gründe sind unter anderem, dass Genusmerkmale im Deutschen oft am Artikel und nicht am Nomen markiert sind und das Nomen nicht immer obligatorisch für die Bildung der Phrase ist.
- Citar trabajo
- Niels Kindl (Autor), 2011, Die DP-Hypothese, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168937