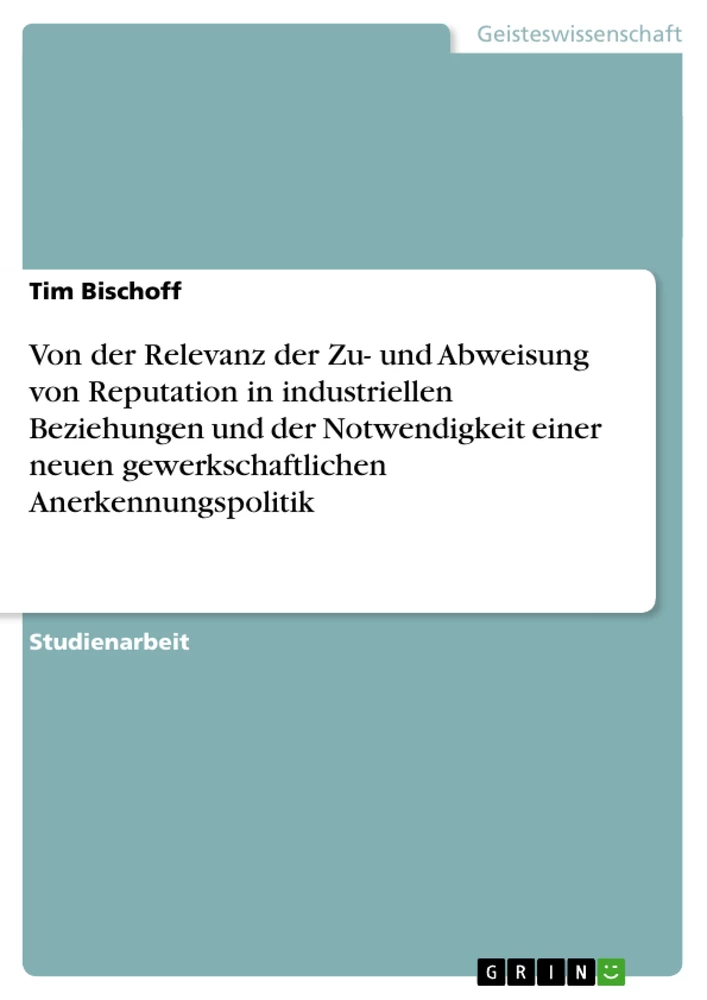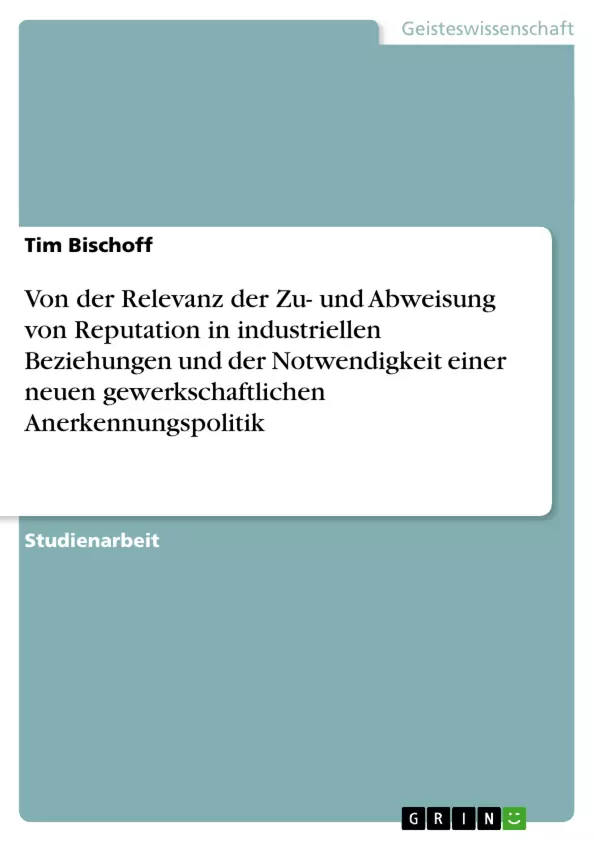Der Beruf hat sowohl zeitlich als auch für die eigene Persönlichkeit der Menschen einen zentralen Stellenwert in der Gesellschaft eingenommen. Beruflicher Erfolg schafft Anerkennung und Respekt anderer Menschen, die häufig direkt in ein entsprechendes Entgelt führen und dadurch einen bestimmten Lebensstandard ermöglichen. Statussymbole werden zu einem Indikator dafür, dass man es "geschafft" hat. Die Werbung und Ansprüche der Menschen richten sich genau auf dieses Bedürfnis, so wird neben "jung" und "dynamisch" immer häufiger "erfolgreich" in der Werbebotschaft transportiert. Auch wenn nicht alle Menschen dauerhaft erfolgreich sein können, so möchten sie sich doch zumindest die Dinge aneignen, die ihnen suggerieren, dass sie es sind. So ist z.B. in Deutschland die Anzahl neuer Autos so hoch wie noch nie, einen alten Käfer sieht man immer seltener.
Tatsächlich sind die Menschen nahezu erfolgsabhängig geworden. Ist diese Erfolgsabhängigkeit, die in den letzten Jahren beständig in Form von "mein Haus, mein Auto, mein Boot, mein/e Frau/Mann" zelebriert worden ist evtl. die Ursache der Veränderung der Arbeitsverhältnisse, der„Humanisierung der Arbeit„- Bewegung der 80er Jahren? Liegt in der Wandlung von einst eintönigen und durchorganisierten Arbeitsprozessen mit direkter Kontrolle von oben in kleine nahezu selbständig arbeitende, autarke Gruppen im Unternehmen mit einem hohen Grad an Entscheidungsspielräumen, die Ursache für den Zwang zum Erfolg? Geht mit Enthierarchiesierung, Dezentralisierung und Gruppenarbeit im Zuge betrieblicher Reorganisationsprozesse die Anforderung der Arbeitgeber an die Arbeitnehmer einher selbst für ihren eigenen beruflichen Erfolg zu sorgen?
Gleichzeitig stellt sich die Frage wie es zu diesem Wandel hin zur Humanisierung der Arbeit kam. Ab wann und warum waren die Arbeitnehmer nicht mehr bereit die gegebenen Arbeitsbedingungen des Taylorismus zu ertragen. Worin könnten die Ursachen liegen, dass die Arbeitnehmer diese Bedingungen so lange hingenommen haben?
Diesen Fragen möchte ich in dieser Arbeit nachgehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. ANERKENNUNG
- 2.1 VON DER WÜRDIGUNG ZUR REPUTATION
- 2.2 EROSION UND WANDEL
- 2.3 DUALITÄT KURZFRISTIGER BEZIEHUNGEN - ORGANISATIONEN UND DAS PROBLEM DES VERTRAUENS
- 2.4 BEDEUTUNGSGEWINN DER REPUTATION = ZUNAHME DER UNSICHERHEIT
- 3. URSACHEN VON UNTERORDNUNG UND WIDERSTAND
- 3.1 GESELLSCHAFT UND SOZIALE UNGLEICHHEIT
- 3.2 EXISTENZFÄHIGKEIT DER GESELLSCHAFT UND IHRE PRINZIPIEN
- 3.2.1 AUTORITÄT
- 3.2.2 ARBEITSTEILUNG
- 3.2.2 VERTEILUNG VON RESSOURCEN
- 4. GEWERKSCHAFTLICHE ANERKENNUNGSPOLITIK
- 4.1 NEUE ANFORDERUNGEN AN DIE GEWERKSCHAFTEN
- 5. RESÜME UND SCHLUSS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Bedeutungswandel der Anerkennungsformen im Kontext industrieller Beziehungen und die damit verbundenen Herausforderungen für die gewerkschaftliche Politik. Sie beleuchtet die Entwicklung von einer Anerkennung durch Leistung und Loyalität hin zu einer Anerkennung durch Reputation und die Folgen für die Arbeitsverhältnisse.
- Die Erosion traditioneller Anerkennungsformen und der Aufstieg der Reputation als entscheidender Faktor in Arbeitsbeziehungen.
- Die Auswirkungen des Wandels auf die Arbeitsbedingungen und die Rolle der Arbeitnehmer.
- Die Bedeutung von Vertrauen in kurzfristigen Beziehungen zwischen Organisationen und Arbeitnehmern.
- Die Ursachen für Unterordnung und Widerstand in Arbeitsbeziehungen und die Rolle von sozialer Ungleichheit.
- Die Herausforderungen für gewerkschaftliche Politik in der Bewältigung der neuen Anforderungen durch den Wandel der Arbeitswelt.
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung stellt die zentrale These der Arbeit dar, dass die steigende Erfolgsabhängigkeit in der Gesellschaft eine Ursache für den Wandel der Arbeitsverhältnisse ist. Sie verdeutlicht, wie der berufliche Erfolg zu Anerkennung und Respekt führt, die wiederum mit einem bestimmten Lebensstandard verbunden sind. Die Einleitung thematisiert die Bedeutung der „Humanisierung der Arbeit"-Bewegung und stellt die Frage, ob die veränderten Arbeitsbedingungen eine Folge der gestiegenen Erfolgsabhängigkeit sind.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Begriff der Anerkennung und beleuchtet verschiedene Aspekte sozialen Handelns. Es werden die Unterschiede zwischen pragmatischem und expressivem Handeln herausgearbeitet sowie die Bedeutung von Identität und Beziehungen im Kontext von Anerkennung. Der Begriff der Nicht-Anerkennung wird vorgestellt, wobei zwischen aktiver Missachtung und passiver Nicht-Beachtung unterschieden wird. Schließlich wird die Verbindung von Anerkennung mit Achtung und Wertschätzung im Sinne von sozialem Gut und Prestige deutlich gemacht.
- Kapitel 3: Das Kapitel untersucht die Ursachen für Unterordnung und Widerstand in Arbeitsbeziehungen. Es beleuchtet die Rolle der gesellschaftlichen Ungleichheit und die Prinzipien sozialer Koordination, die durch die Arbeitsteilung, die Verteilung von Ressourcen und die Autorität bestimmt werden. Das Kapitel zeigt, dass Ungerechtigkeit nicht automatisch zu Konflikten führen muss, sondern auch durch Unterordnung oder Akzeptanz der bestehenden Machtstrukturen bewältigt werden kann.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel befasst sich mit der gewerkschaftlichen Anerkennungspolitik. Es analysiert die neuen Anforderungen an Gewerkschaften im Kontext der veränderten Arbeitsbedingungen und der wachsenden Bedeutung von Reputation. Der Fokus liegt auf den Herausforderungen, die die gewerkschaftliche Politik im Umgang mit den neuen Anforderungen der Arbeitswelt bewältigen muss.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themenfelder Anerkennung, Reputation, Arbeitsverhältnisse, gewerkschaftliche Politik, soziale Ungleichheit, Unterordnung und Widerstand. Sie analysiert die Veränderung der Anerkennungsformen in Arbeitsbeziehungen und die damit verbundenen Herausforderungen für die gewerkschaftliche Politik im Kontext der „Humanisierung der Arbeit".
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Würdigung und Reputation?
Während Würdigung oft auf langfristiger Loyalität und Leistung basiert, ist Reputation ein flüchtigeres Gut, das stark von externer Wahrnehmung und kurzfristigem Erfolg abhängt.
Wie hat sich die „Humanisierung der Arbeit“ entwickelt?
In den 80er Jahren gab es eine Bewegung weg von starren Taylorismus-Strukturen hin zu Gruppenarbeit und größeren Entscheidungsspielräumen für Arbeitnehmer.
Warum sind Menschen heute so erfolgsabhängig?
Beruflicher Erfolg schafft sozialen Status und ermöglicht einen Lebensstandard, der über Statussymbole (Haus, Auto) die persönliche Identität und Anerkennung definiert.
Welche neuen Anforderungen ergeben sich für Gewerkschaften?
Gewerkschaften müssen eine neue Anerkennungspolitik entwickeln, die der zunehmenden Unsicherheit und dem Bedeutungsgewinn von Reputation in dezentralen Arbeitswelten Rechnung trägt.
Was sind die Ursachen für Widerstand in Arbeitsbeziehungen?
Widerstand entsteht oft aus empfundener Ungerechtigkeit bei der Ressourcenverteilung, Autoritätsmissbrauch oder der Erosion traditioneller Sicherheitsversprechen.
- Quote paper
- Tim Bischoff (Author), 2002, Von der Relevanz der Zu- und Abweisung von Reputation in industriellen Beziehungen und der Notwendigkeit einer neuen gewerkschaftlichen Anerkennungspolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16898