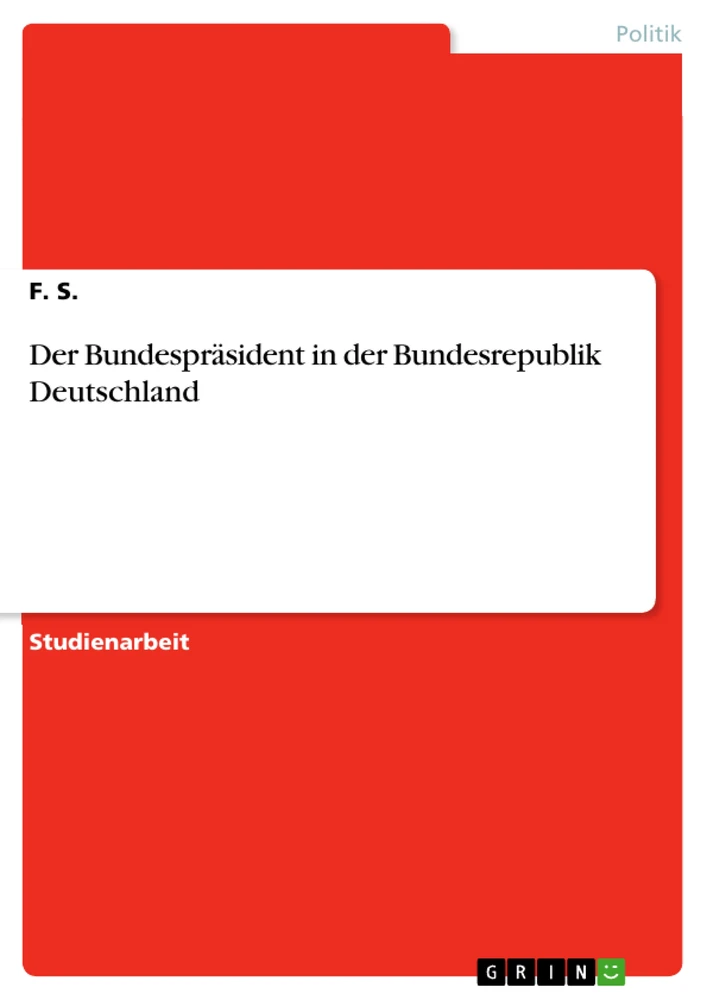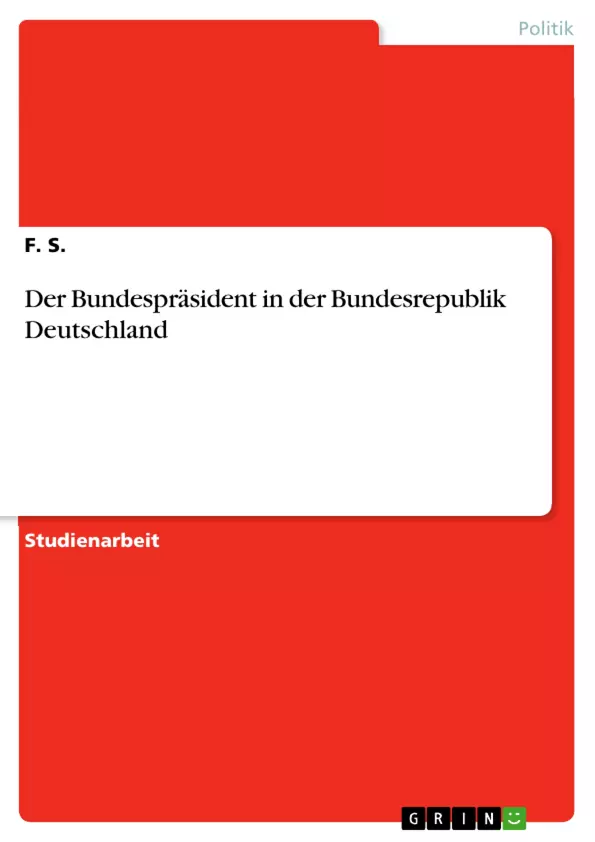Der Bundespräsident ist eines der fünf deutschen Bundesorgane und findet im Grundgesetz der Bundesrepublik einen eigenen Abschnitt. Er wird für seine Tätigkeit mit 10/9 der Bezüge des Bundeskanzlers entlohnt. Ihm allein untersteht ein gesamter Beamtenapparat der als Bundespräsidialamt zwar nicht so groß ist, wie das Bundeskanzleramt, jedoch ein funktionierendes System darstellt. Doch lässt sich anhand dessen eine relevante Gewichtung dieses Amtes feststellen und wenn ja worin besteht diese Bedeutung?
Diese Hausarbeit erhebt nicht den Anspruch das Amt des Bundespräsidenten anhand der Persönlichkeiten, die diesen Posten innehatten, zu beleuchten. Sie kann in diesem Rahmen nur anhand der hinlänglichen Literatur einen generellen Überblick über den Bundespräsidenten bieten und beleuchten, wie der Bundespräsident zu seinem Amt kam, welche Aufgaben er als Folge seiner Wahl zu vollführen hat und welche Rechte und Pflichten ihm dabei zukommen. Aus geschichtlicher und aus staatsrechtlicher Sicht ist dieses Amt zweifelsohne ein besonderes.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Verfassungsrechtliche Grundlagen
- III. Wahl durch die Bundesversammlung
- 1. Die Bundesversammlung
- 2. Die persönliche Voraussetzung des Kandidaten
- 3. Die Wahl des Bundespräsidenten
- 4. Amtsantritt und Verlust des Amtes, Stellvertretung und Wiederwahl
- IV. Die Aufgaben des Bundespräsidenten
- 1. Repräsentativaufgaben und Integrationsfunktion
- 2. Rechte und Aufgaben bezüglich der Bundesregierung
- 3. Rechte und Aufgaben bezüglich des Bundestages
- 4. Sonstige Pflichten und Aufgaben
- V. Prägung des Amtes durch die Person
- VI. Abkehr von der Weimarer Republik
- VII. Fazit und Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert das Amt des deutschen Bundespräsidenten. Sie zielt darauf ab, die verfassungsrechtlichen Grundlagen des Amtes zu beleuchten, die Wahl durch die Bundesversammlung zu untersuchen und die Aufgaben und Befugnisse des Bundespräsidenten zu erläutern. Darüber hinaus beleuchtet die Arbeit die Prägung des Amtes durch die Persönlichkeit des Amtsinhabers und setzt den Bundespräsidenten in den historischen Kontext der Weimarer Republik.
- Verfassungsrechtliche Grundlagen des Amtes des Bundespräsidenten
- Wahl durch die Bundesversammlung
- Aufgaben und Befugnisse des Bundespräsidenten
- Prägung des Amtes durch die Persönlichkeit des Amtsinhabers
- Vergleich des Bundespräsidenten mit dem Reichspräsidenten der Weimarer Republik
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik des Bundespräsidenten ein und erläutert den Zweck der Hausarbeit. Sie betont die Relevanz des Amtes und hebt die Notwendigkeit eines umfassenden Überblicks über die Aufgaben, Rechte und Pflichten des Bundespräsidenten hervor. Außerdem wird der Vergleich mit dem Reichspräsidenten der Weimarer Republik als wichtiges Element der Analyse angekündigt.
II. Verfassungsrechtliche Grundlagen
Dieses Kapitel analysiert die Verfassungsrechtlichen Grundlagen des Amtes des Bundespräsidenten im Grundgesetz. Es beleuchtet die Artikel 54 bis 61, die die Wahl, Unvereinbarkeiten, den Amtseid und die Stellvertretung des Bundespräsidenten regeln. Darüber hinaus werden die im Grundgesetz verstreuten Regelungen zu seinen Aufgaben und Befugnissen zusammengefasst.
III. Wahl durch die Bundesversammlung
Das Kapitel befasst sich mit der Wahl des Bundespräsidenten durch die Bundesversammlung. Es beschreibt die Zusammensetzung der Bundesversammlung, die Voraussetzungen für die Kandidatur und das Wahlverfahren. Besonderes Augenmerk liegt auf der Einberufung der Bundesversammlung und der Rolle des Bundestagspräsidenten.
IV. Die Aufgaben des Bundespräsidenten
Dieses Kapitel behandelt die vielfältigen Aufgaben des Bundespräsidenten. Es erläutert die repräsentativen und integrativen Funktionen des Amtes, sowie die Rechte und Pflichten des Bundespräsidenten gegenüber der Bundesregierung, dem Bundestag und anderen Institutionen. Darüber hinaus werden weitere wichtige Aufgaben und Verpflichtungen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Bundespräsident, Bundesversammlung, Grundgesetz, verfassungsrechtliche Grundlagen, Wahl, Aufgaben, Befugnisse, Repräsentativaufgaben, Integrationsfunktion, Weimarer Republik, Reichspräsident, Vergleich, Staatsoberhaupt, Amtseid, Stellvertretung, Unvereinbarkeiten, Gesetzgebung, Regierung, Bundestag, Bundesrat.
Häufig gestellte Fragen
Welche Aufgaben hat der deutsche Bundespräsident?
Zu den Hauptaufgaben gehören die Repräsentation des Staates nach innen und außen, die Ausfertigung von Gesetzen sowie die Integrationsfunktion für die Gesellschaft.
Wie wird der Bundespräsident gewählt?
Die Wahl erfolgt durch die Bundesversammlung, die aus allen Bundestagsabgeordneten und einer gleichen Anzahl von Delegierten aus den Landesparlamenten besteht.
Welche Rechte hat der Bundespräsident gegenüber der Regierung?
Er schlägt den Bundeskanzler zur Wahl vor, ernennt und entlässt Minister auf Vorschlag des Kanzlers und kann den Bundestag unter bestimmten Bedingungen auflösen.
Wie unterscheidet sich das Amt von dem des Reichspräsidenten der Weimarer Republik?
Der Bundespräsident hat deutlich weniger Machtbefugnisse als der Reichspräsident, insbesondere keine Notverordnungsrechte, um eine Schwächung der Demokratie zu verhindern.
Welche persönlichen Voraussetzungen muss ein Kandidat erfüllen?
Ein Kandidat muss die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, das Wahlrecht zum Bundestag haben und mindestens 40 Jahre alt sein.
- Quote paper
- F. S. (Author), 2003, Der Bundespräsident in der Bundesrepublik Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168993