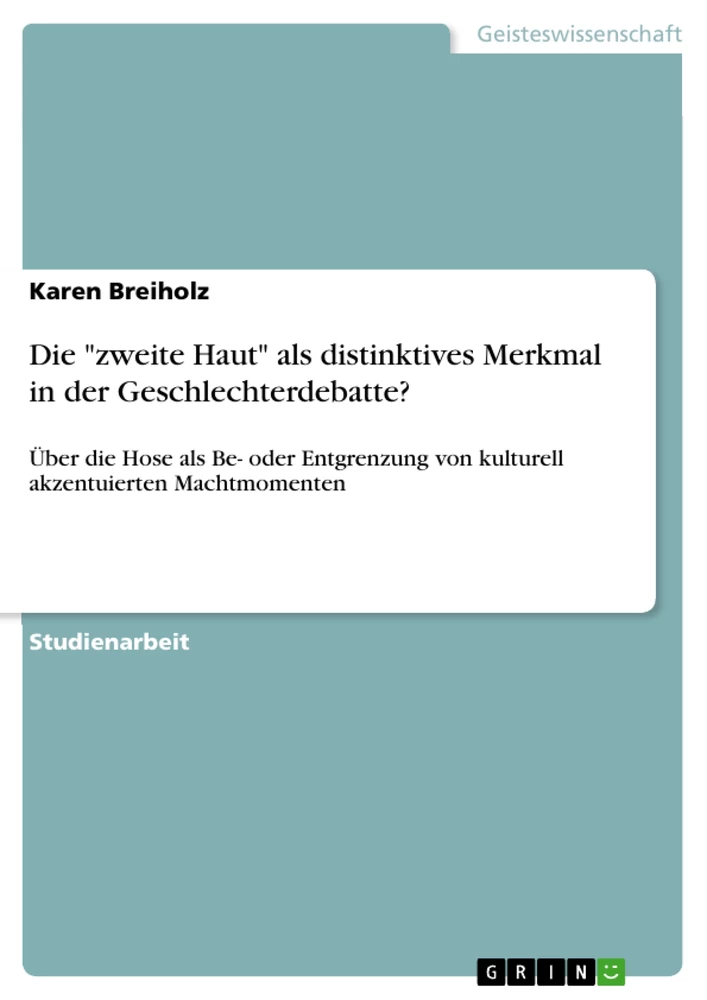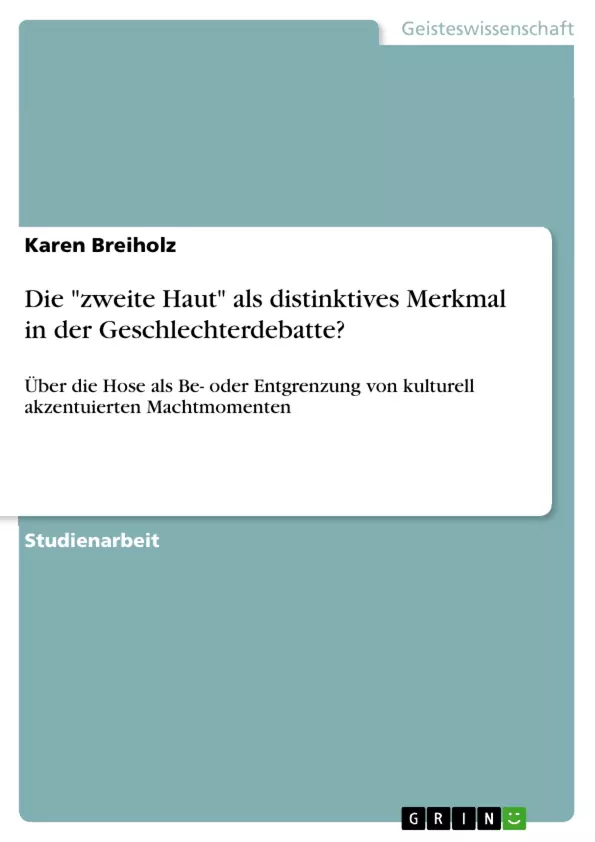Abgesehen vom Minirock hat wohl kaum ein anderes Kleidungsstück in der jüngeren westlich geprägten Kulturgeschichte für so viel Aufsehen und öffentliche Auseinandersetzung gesorgt, wie der Durchbruch der Hose für die Frau.
Um zu verstehen, warum das weibliche Beinkleid einen derartigen Aufschrei nach sich zog, muss man einen kurzen Blick in die Emanzipationshistorie der Frauen werfen, denn die Hose besäße - so die Meinung einiger Wissenschaftler - einen symbolischen Gehalt, der sich aus der Macht der männlichen Spezies speise. Geläufig ist beispielsweise der Ausdruck die „Hosen anhaben“, was soviel bedeuten kann, wie: der Bestimmende, Machthabende sein.
Doch erschöpft sich das Hosenthema bereits daran, dass heute Frau und Mann wie selbstverständlich Hosen tragen?
Inwieweit sind kulturelle Prägungen und Rahmungen wie das Hosentragen wandelbar beziehungsweise flexibel für das Subjekt verhandelbar / ausgestaltbar und welche normativen Vorgaben haben dabei für die Akteure nach wie vor nicht an Geltungsvermögen verloren?
In dieser Hausarbeit operiere ich mit volkskundlich und soziologisch durchleuchteten Rahmenanalysen und bringe diese mit Körper- und dazugehörigen Kleidungskonzepten zusammen, um meiner Fragestellung nachzugehen. In diesem Zusammenhang wird es auch um das Problem gehen, wie Machtverhältnisse sich in die geschlechtlichen Körper einschreiben und mithilfe von langer Beinkleidung möglicherweise manifestieren oder dekonstruieren lassen. Die Spieltheorie von Johan Huizinga liefert für die Bearbeitung der Rahmentheorie ebenfalls wichtige Impulse.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Der schleppende Durchbruch der Hose für die Frau
- 2.1 Ein kurzer Abriss über die Entwicklung der männlichen Hose
- 2.2 Über Hosenkämpfe
- 2.3 Die Mode um die Zeit der Französischen Revolution
- 2.4 Biedermeierkleidung und Kriegshosen
- 2.5 Die Weimarer Jahre
- 2.6 Die Arbeitshose Lotte
- 3 Die Weiterentwicklung der weiblichen Hose ab den 60er Jahren
- 3.1 Die Jeanshose als politisches Statement und Teil der Jugendkultur
- 3.2 Die neue Jeanshose - zurück zu alten Zeiten?
- 4 Rahmentheoretische Überlegungen zur Hosengeschichte
- 5 Körpererfahrungen und Körpergrenzen
- 5.1 Männliche und weibliche Körperkonzepte im Vergleich
- 5.2 Wie die Hose in die Körperkonzepte hineinpasst
- 6 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Durchbruch der Hose als Kleidungsstück für Frauen in der westlichen Kulturgeschichte und analysiert die damit verbundenen sozialen und kulturellen Implikationen. Die Arbeit beleuchtet den symbolischen Gehalt der Hose als Ausdruck von Macht und Emanzipation und untersucht, wie sich kulturelle Normen und Körperkonzepte im Laufe der Zeit verändert haben. Methodisch werden volkskundliche und soziologische Rahmenanalysen angewendet, um die Fragestellung zu bearbeiten.
- Der symbolische Gehalt der Hose als Ausdruck von Macht und Geschlechterrollen
- Die Entwicklung der weiblichen Hose im historischen Kontext
- Körperkonzepte und Körpergrenzen im Zusammenhang mit Kleidung
- Der Einfluss kultureller Normen und sozialer Praktiken auf den Kleidungsstil
- Die Rolle der Hose in der Geschlechterdebatte
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem symbolischen Gehalt der Hose für Frauen und deren Bedeutung in der Geschlechterdebatte. Es wird die methodische Herangehensweise der Arbeit skizziert, die volkskundliche und soziologische Perspektiven verbindet und die Spieltheorie von Johan Huizinga heranzieht, um den Wandel kultureller Rahmenbedingungen zu analysieren. Die Autorin unterstreicht den performativen Charakter von Bedeutungskonstitutionen im Kontext der Körper- und Geschlechterdebatte.
2 Der schleppende Durchbruch der Hose für die Frau: Dieses Kapitel verfolgt die historische Entwicklung der Hose, beginnend mit einem Abriss der männlichen Hosengeschichte. Es werden die "Hosenkämpfe" als Ausdruck des Widerstands von Frauen gegen traditionelle Geschlechterrollen beleuchtet. Die Analyse umfasst verschiedene Epochen, von der Französischen Revolution bis zur Weimarer Republik, um die schrittweise Akzeptanz der Hose durch Frauen zu veranschaulichen. Besondere Aufmerksamkeit wird der "Arbeitshose Lotte" als Beispiel für einen pragmatischen und emanzipatorischen Kleidungsstil gewidmet. Die Kapitel verdeutlicht die langsame und widerständige Veränderung traditioneller Kleidernormen.
3 Die Weiterentwicklung der weiblichen Hose ab den 60er Jahren: Dieses Kapitel fokussiert die Entwicklung der weiblichen Hose ab den 1960er Jahren. Es betont die Jeanshose als politisches Symbol und Teil der Jugendkultur, die eine neue Form des weiblichen Selbstverständnisses repräsentiert. Der Wandel der Jeanshose wird in Bezug auf ihre Geschichte und ihre soziale Bedeutung analysiert. Die Kapitel erörtert, wie die Jeanshose als Ausdruck von Rebellion und Emanzipation dient, aber gleichzeitig auch an ältere Traditionen anknüpft.
4 Rahmentheoretische Überlegungen zur Hosengeschichte: Dieser Abschnitt beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Arbeit. Es werden verschiedene theoretische Ansätze, wie die Rahmenanalysen von Bateson, Goffman und Schütz, diskutiert, um die dynamischen Prozesse der Bedeutungskonstitution zu erklären. Der performative Turn in den Kulturwissenschaften wird in den Kontext der Analyse eingeordnet, um den Prozesscharakter des Kleidungswandels zu verdeutlichen. Die Kapitel verknüpft Theorie und empirische Beobachtungen, um den Rahmen für die Interpretation der Hosengeschichte zu bilden.
5 Körpererfahrungen und Körpergrenzen: Dieses Kapitel widmet sich dem Zusammenhang zwischen Körperkonzepten, Körpergrenzen und Kleidung. Es vergleicht männliche und weibliche Körperkonzepte und analysiert, wie die Hose in diese Konzepte integriert ist. Die Analyse bezieht soziologische Perspektiven mit ein, um die konstitutiven Machtstrukturen im Kontext des Körperwandels zu verdeutlichen. Die Kapitel untersucht die Wechselwirkung zwischen Körper, Kleidung und sozialen Normen.
Schlüsselwörter
Hose, Geschlechterdebatte, Kleidung, Emanzipation, Macht, Körperkonzept, Körpergrenze, Rahmenanalyse, Spieltheorie, historische Entwicklung, Kulturgeschichte, Soziologie, Volkskunde, Jugendkultur, Jeanshose, Weimarer Republik.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: "Der Durchbruch der Hose für die Frau"
Was ist das Thema der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den Durchbruch der Hose als Kleidungsstück für Frauen in der westlichen Kulturgeschichte und die damit verbundenen sozialen und kulturellen Implikationen. Sie analysiert den symbolischen Gehalt der Hose als Ausdruck von Macht und Emanzipation und untersucht, wie sich kulturelle Normen und Körperkonzepte im Laufe der Zeit verändert haben.
Welche Methoden werden in der Hausarbeit angewendet?
Methodisch werden volkskundliche und soziologische Rahmenanalysen angewendet, um die Fragestellung zu bearbeiten. Die Arbeit bezieht theoretische Ansätze wie die Rahmenanalysen von Bateson, Goffman und Schütz mit ein und ordnet den performativen Turn in den Kulturwissenschaften in die Analyse ein. Die Spieltheorie von Johan Huizinga wird herangezogen, um den Wandel kultureller Rahmenbedingungen zu analysieren.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: den symbolischen Gehalt der Hose als Ausdruck von Macht und Geschlechterrollen; die Entwicklung der weiblichen Hose im historischen Kontext; Körperkonzepte und Körpergrenzen im Zusammenhang mit Kleidung; den Einfluss kultureller Normen und sozialer Praktiken auf den Kleidungsstil; und die Rolle der Hose in der Geschlechterdebatte.
Welche historischen Perioden werden untersucht?
Die Hausarbeit beleuchtet die Entwicklung der weiblichen Hose von einem kurzen Abriss der männlichen Hosengeschichte über die "Hosenkämpfe" und verschiedene Epochen wie die Französische Revolution, das Biedermeier, die Weimarer Republik bis hin zu den 1960er Jahren und darüber hinaus.
Welche Rolle spielt die Jeanshose in der Analyse?
Die Jeanshose wird als politisches Symbol und Teil der Jugendkultur der 1960er Jahre analysiert, das eine neue Form des weiblichen Selbstverständnisses repräsentiert. Der Wandel der Jeanshose wird in Bezug auf ihre Geschichte und ihre soziale Bedeutung untersucht.
Wie werden Körpererfahrungen und Körpergrenzen in die Analyse einbezogen?
Das Kapitel "Körpererfahrungen und Körpergrenzen" vergleicht männliche und weibliche Körperkonzepte und analysiert, wie die Hose in diese Konzepte integriert ist. Es wird die Wechselwirkung zwischen Körper, Kleidung und sozialen Normen untersucht.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Hose, Geschlechterdebatte, Kleidung, Emanzipation, Macht, Körperkonzept, Körpergrenze, Rahmenanalyse, Spieltheorie, historische Entwicklung, Kulturgeschichte, Soziologie, Volkskunde, Jugendkultur, Jeanshose, Weimarer Republik.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung, gefolgt von Kapiteln zur historischen Entwicklung der weiblichen Hose, theoretischen Überlegungen, Körpererfahrungen und Körpergrenzen und schliesslich einem Ausblick. Ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und die Zielsetzung mit Themenschwerpunkten sind ebenfalls enthalten.
Welche zentrale Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage ist der symbolische Gehalt der Hose für Frauen und deren Bedeutung in der Geschlechterdebatte.
- Citation du texte
- Karen Breiholz (Auteur), 2010, Die "zweite Haut" als distinktives Merkmal in der Geschlechterdebatte?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169018