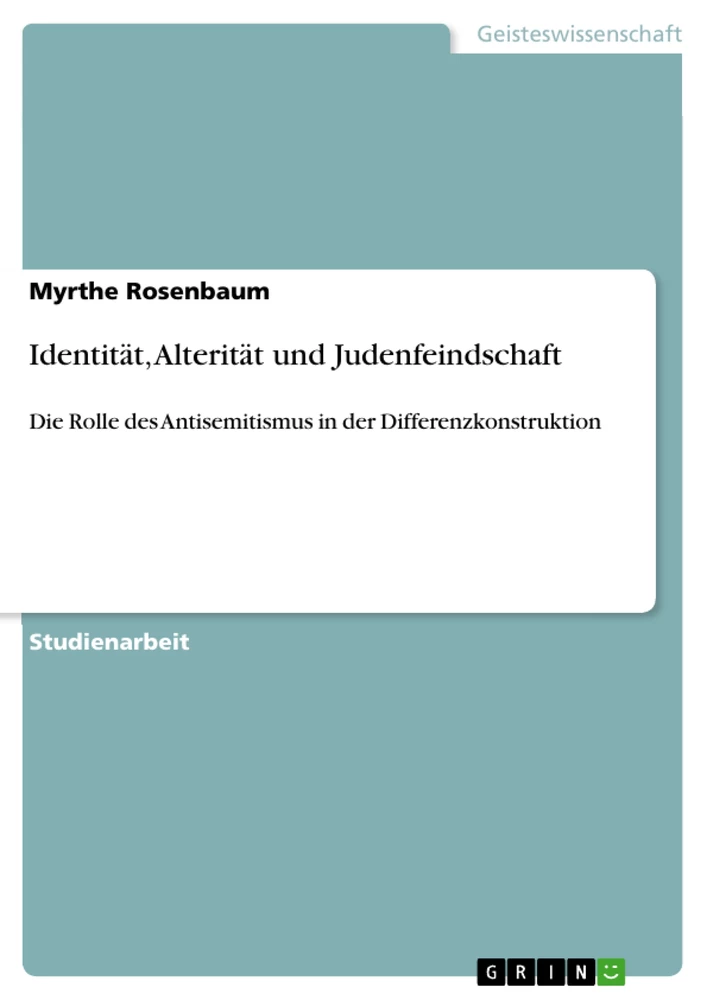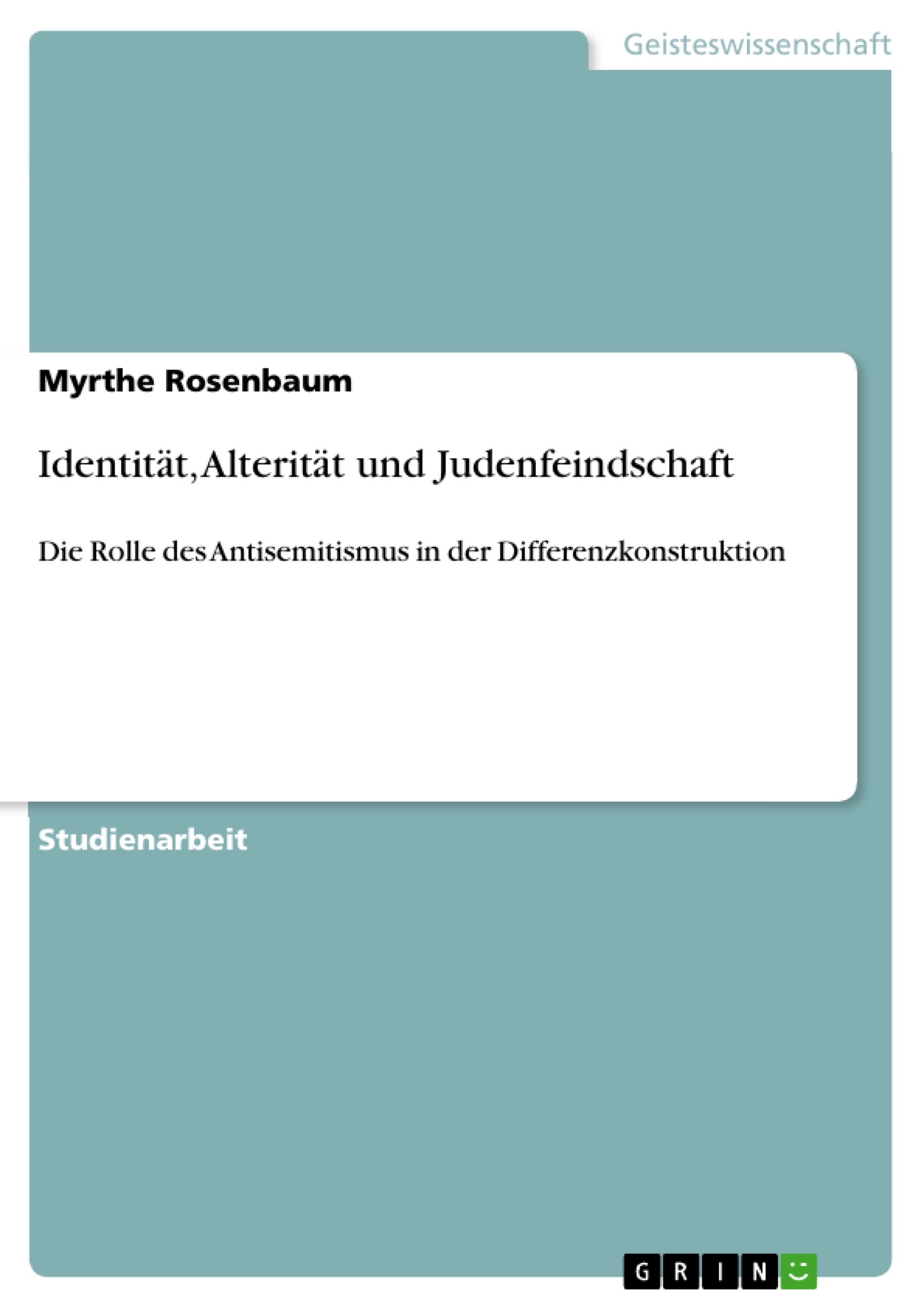Die vorliegende Ausarbeitung befasst sich mit dem modernen, sog. sekundären Antisemitismus und dessen Funktion für die und in der Identitätsstiftung. Nachdem einleitend kurz die unterschiedlichen Richtungen des Antisemitismus zusammengefasst werden, sollen Arbeiten von Theodor W. Adorno und Max Horkheimer zum Antisemitismus umrissen werden um aufzuzeigen, wie und welche soziologischen Ansätze der Antisemitismusforschung für die Themenstellung relevant sind. Ausgehend von poststrukturalistischen Theorien, welche das Augenmerk besonders auf Konstruktionsbedingungen von Strukturen sowie normative Vorstellungen und theoretische Prinzipien der Identitätsbildung richten, soll erläutert werden, in welcher Form die antisemitische Denkweise Fremd- und Selbstbilder entwirft, und aus welcher Motivation heraus sie dies tut. Der Sammelband „Die Verneinung des Judentums. Antisemitismus als religiöse und säkulare Waffe“ (Holz/ Kauffman/ Paul (Hg.) 2009) dient hierbei als Grundlage um die Verschachtelung der jeweiligen Fremd- und Selbstbilder und ihrer Einbettung ins Gesellschaftssystem darzustellen. Außerdem sind an dieser Stelle die Arbeiten von Wolfgang Wippermann zu nennen, dessen umfangreiche und kritische Auseinandersetzung mit den Vielschichtigkeiten des Antisemitismus, des Faschismus und seiner Anhänger das gedankliche Fundament dieser Ausarbeitung bilden. Zum Schluss soll das komplexe Feld von Antisemitismus und Identität nach der Shoa, bzw. „nach Auschwitz“ wie es anlehnend an Adorno von Holz formuliert wird, beleuchtet werden.
„Die duale Trennung muss man machen. Das ist unausweichlich. Wir haben nicht die Option zu sagen: das wollen wir nicht, das schaffen wir ab. Möglich ist nur, diesen Zwang des Unterscheidens zu reflektieren. (...)Identitätswahn ist die verweigerte Reflexion darauf, dass Identität durch Unterscheiden konstruiert wird.“ (Holz, 138)
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Formen des Antisemitismus
- Soziologische Ansätze
- Identitätsbilder im und durch den Antisemitismus
- Täter und Opfer-Dichotomie
- Gemeinschaft versus Gesellschaft
- Identität versus nicht-identische Identität
- Identität und Antisemitismus „nach Auschwitz“
- Die Opfer-Täter-Umkehr
- Versuch eines Fazits
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Ausarbeitung analysiert den modernen Antisemitismus und seine Rolle in der Identitätsbildung. Sie untersucht die verschiedenen Formen des Antisemitismus, beleuchtet soziologische Ansätze zur Erklärung seiner Entstehung, und erklärt, wie antisemitische Denkweise Fremd- und Selbstbilder konstruiert.
- Die verschiedenen Formen des Antisemitismus: vom religiösen Antijudaismus bis zum modernen, „sekundären“ Antisemitismus
- Soziologische Ansätze zur Erklärung des Antisemitismus, insbesondere die Kritische Theorie von Horkheimer und Adorno
- Die Konstruktion von Fremd- und Selbstbildern im Antisemitismus: Täter-Opfer-Dichotomie, Gemeinschaft versus Gesellschaft, Identität versus nicht-identische Identität
- Die Rolle des Antisemitismus in der deutschen Identität „nach Auschwitz“ und die Täter-Opfer-Umkehr
- Die Bedeutung der Unterscheidung zwischen Identität und Alterität im Kontext des Antisemitismus
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Die Einleitung stellt das Thema der Ausarbeitung vor: den modernen Antisemitismus und seine Funktion für die Identitätsstiftung. Es werden die Forschungsfragen und die Methodik skizziert.
- Das Kapitel "Formen des Antisemitismus" gibt einen Überblick über verschiedene Formen der Judenfeindschaft: vom christlichen Antijudaismus, über den säkularen Antisemitismus bis hin zum "sekundären" Antisemitismus, der sich durch die Holocaust-Erfahrung und die daraus resultierende Schuldthematik auszeichnet.
- Das Kapitel "Soziologische Ansätze" beleuchtet soziologische Theorien zur Erklärung des Antisemitismus, insbesondere die Kritische Theorie von Horkheimer und Adorno. Die Autoren sahen die Wurzeln des Antisemitismus in der Ökonomie und der kapitalistischen Gesellschaft.
- Das Kapitel "Identitätsbilder im und durch den Antisemitismus" analysiert, wie antisemitische Denkweise Fremd- und Selbstbilder konstruiert. Holz stellt drei Gegensatzpaare vor: Opfer versus Täter, Gemeinschaft versus Gesellschaft und Identität versus nicht-identische Identität.
- Das Kapitel "Identität und Antisemitismus „nach Auschwitz“ " befasst sich mit der spezifischen Form des Antisemitismus nach der Shoa. Es wird argumentiert, dass dieser sich durch eine Täter-Opfer-Umkehr auszeichnet, die die Schuld des deutschen Volkes zu relativieren versucht.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Antisemitismus, Identität, Alterität, Differenzkonstruktion, Judenfeindschaft, Fremdbild, Selbstbild, nationale Identität, Täter-Opfer-Dichotomie, Gemeinschaft, Gesellschaft, "nach Auschwitz", Schuld, Holocaust.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter „sekundärem Antisemitismus“?
Es ist eine Form des Antisemitismus nach der Shoa, die sich durch Schuldabwehr und Täter-Opfer-Umkehr auszeichnet, oft motiviert durch den Wunsch nach einer „unbelasteten“ nationalen Identität.
Welche Rolle spielt Identität bei der Entstehung von Antisemitismus?
Antisemitismus dient oft der Konstruktion eines positiven Selbstbildes durch die Abgrenzung von einem negativ besetzten „Anderen“ (Alterität).
Was sagten Adorno und Horkheimer zum Antisemitismus?
In der Kritischen Theorie sahen sie Antisemitismus als Resultat gesellschaftlicher und ökonomischer Strukturen im Kapitalismus sowie als Ausdruck einer „pathischen Projektion“.
Was ist die Täter-Opfer-Dichotomie?
Es beschreibt die starre Aufteilung der Welt in Opfer und Täter, die im antisemitischen Denken genutzt wird, um eigene Schuld zu externalisieren oder umzukehren.
Wie hängen Gemeinschaft und Gesellschaft in diesem Kontext zusammen?
Antisemitisches Denken idealisiert oft die „organische Gemeinschaft“ und lehnt die moderne, abstrakte „Gesellschaft“ ab, die den Juden zugeschrieben wird.
Was bedeutet „nach Auschwitz“ für die deutsche Identität?
Es beschreibt die Herausforderung, eine Identität zu bilden, die die historische Schuld reflektiert, anstatt sie durch antisemitische Denkmuster zu verdrängen.
- Citation du texte
- Myrthe Rosenbaum (Auteur), 2010, Identität, Alterität und Judenfeindschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169052