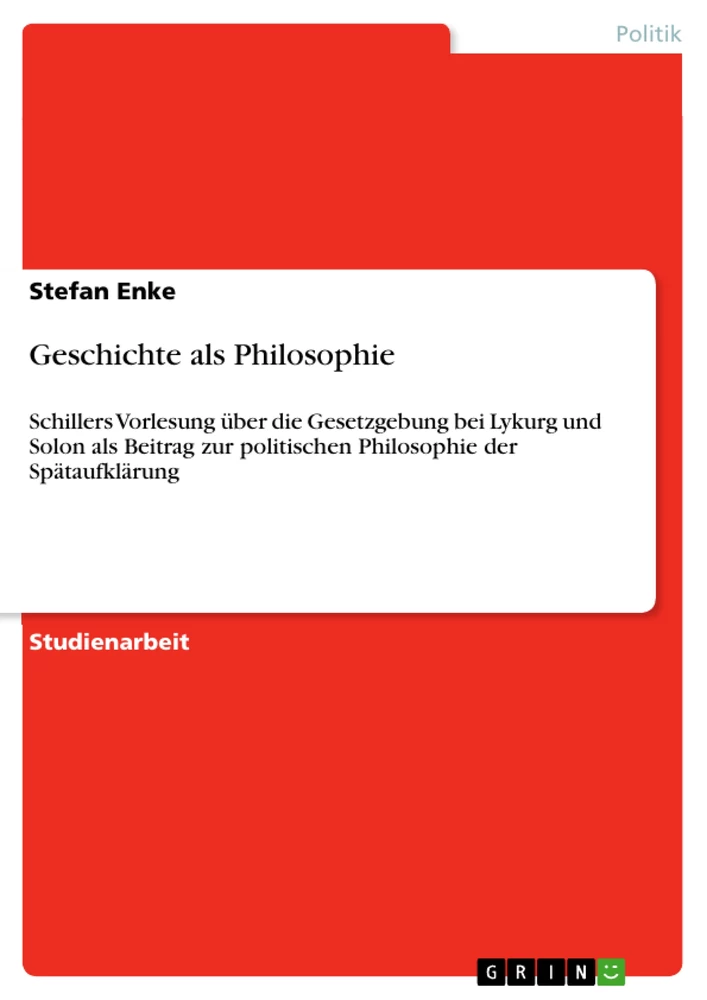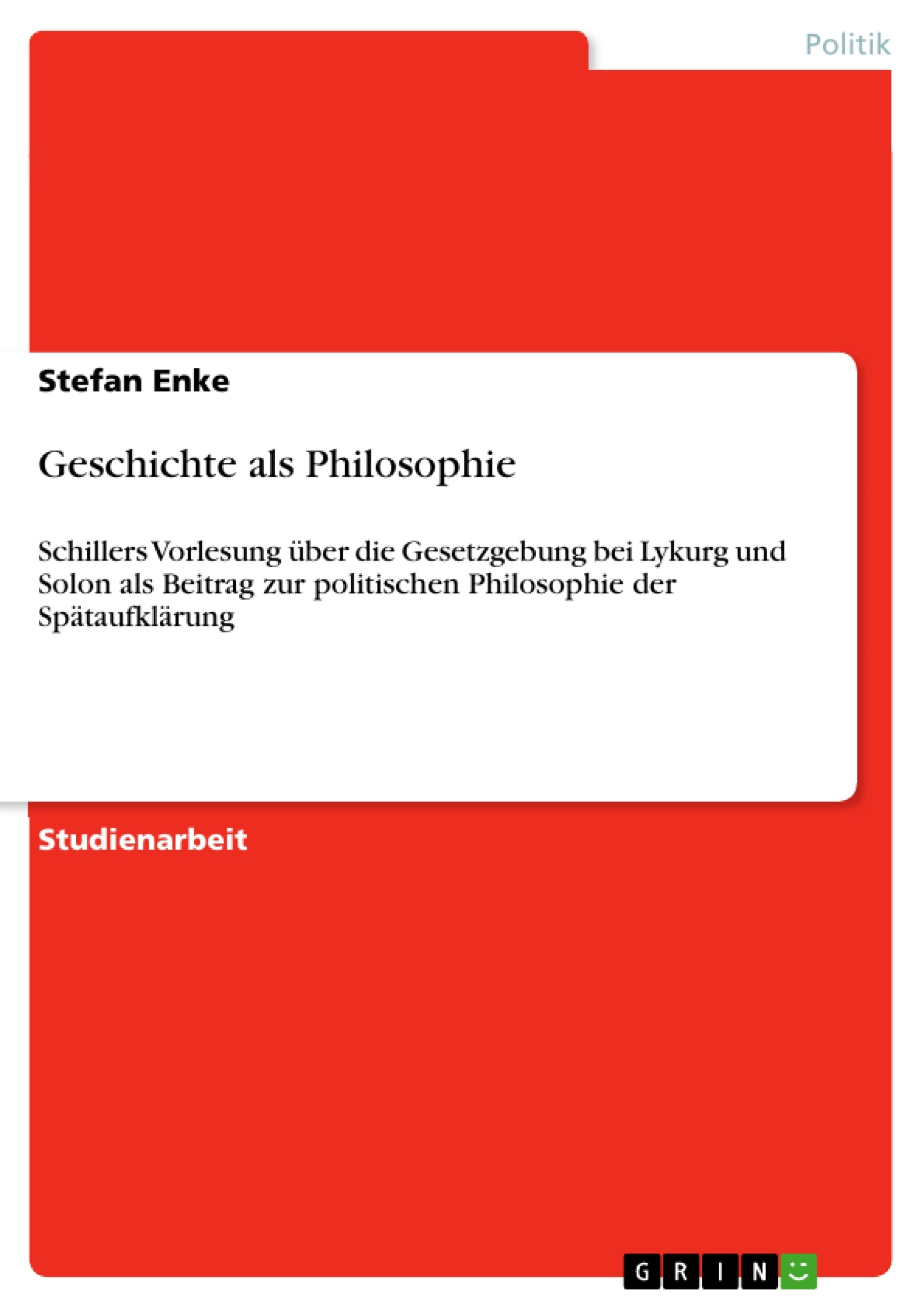Die Vorlesung Schillers zur „Gesetzgebung des Lykurgs und Solons“, die in der Zeit der Französischen Revolution gehalten und als Text herausgegeben wurde, gehört zu den Schriften, die bei der Rezeption des Dichters und Historikers wenig bis gar keine Beachtung finden. Obwohl der Text einige Begebenheiten der Antike behandelt, wird in dieser Arbeit gezeigt, dass er sich ebenso als eine Auseinandersetzung mit den Verhältnissen zu Schillers Lebzeiten lesen lässt. Schiller schließt mit dem besprochenen Text zweifellos an die staatstheoretischen Debatten des 18. Jahrhunderts an. Dabei nimmt er eine dezidiert eigene Stellung ein. Schiller präsentiert sich in dieser kleinen historischen Abhandlung ganz als ein politischer Denker der späten Aufklärung.
Es wird hier versucht die Vorstellung Schillers von einem schlechten und vom guten Staat dar. Außerdem wird gezeigt, wie sich Schiller mit diesen Ansichten in die Zeit Aufklärung einordnen lässt sowie welche Andeutungen Schillers als Anspielungen auf seine eigene Zeit verstanden werden können.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Der Schillersche Text
- Verdacht der Gräkophilie
- Universalgeschichtlicher Anspruch
- Philosophischer Text
- Der schlechte Staat
- Das spartanische Beispiel
- Naturzustand im Staat
- Tyrannische Königsherrschaft
- Anarchische Demokratie
- Der totalitäre Staat
- Der gute Staat
- Der oberste Zweck
- Erziehung zum Besseren
- Teilung der Gewalten
- Repräsentative Demokratie
- Organische Verfassung
- Gleichheit
- Der aufgeklärte Denker
- Fortschritt
- Vernunft begründet den Staat
- Volkssouveränität
- Der zeitgenössische Bezug
- Die Kritik der Verfassung
- Die Frage der Eigentumsverteilung
- Zwei gegenwartsbezogene Anekdoten?
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Der Text von Schiller analysiert die Gesetzgebung von Lykurg und Solon im Kontext der politischen Philosophie der Spätaufklärung. Er zielt darauf ab, durch den Vergleich der beiden griechischen Staatsmodelle ein besseres Verständnis von guten und schlechten Staatsformen zu entwickeln.
- Die Bedeutung der antiken Staatsmodelle für die politische Philosophie der Spätaufklärung
- Die Kritik an unkritischer Verklärung der Antike
- Die Rolle der Vernunft in der Staatsbildung
- Die Entwicklung eines idealen Staatsmodells
- Der zeitgenössische Bezug der Schillerschen Analyse
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung (Kapitel 1) führt in Schillers Vorlesung zur Gesetzgebung von Lykurg und Solon ein, die im August 1789 kurz nach Ausbruch der Französischen Revolution gehalten wurde. Der Text befasst sich mit der Frage, ob Schillers Analyse der antiken Staatsmodelle einen Bezug zur Debatte seiner Zeit hat. Die Analyse des Textes beginnt mit der Entkräftung des Verdachts der Gräkophilie (Kapitel 2.1). Schillers Geschichtsverständnis wird beleuchtet und die philosophische Dimension des Textes wird deutlich gemacht (Kapitel 2.2 und 2.3). Die Analyse der schlechten Staatsformen setzt bei der spartanischen Verfassung an (Kapitel 3.1). Schiller entwickelt seine Vorstellung von einem Naturzustand im Staat (Kapitel 3.2). Des Weiteren werden tyrannische Königsherrschaft und anarchische Demokratie als schlechte Staatsformen betrachtet (Kapitel 3.3 und 3.4). Schillers Kritik an einem totalitären Staat wird dargelegt (Kapitel 3.5). Im Anschluss werden Schillers Vorstellungen vom guten Staat behandelt (Kapitel 4), mit Fokus auf den obersten Zweck des Staates (Kapitel 4.1), Erziehung zum Besseren (Kapitel 4.2), Gewaltenteilung (Kapitel 4.3), repräsentativer Demokratie (Kapitel 4.4) und einer organischen Verfassung (Kapitel 4.5). Der Autor zeigt, wie sich Schillers Ansichten in die Aufklärung einordnen lassen (Kapitel 5). Schließlich werden die zeitgenössischen Bezüge von Schillers Text beleuchtet (Kapitel 6), insbesondere die Kritik an der Verfassung und die Frage der Eigentumsverteilung (Kapitel 6.1 und 6.2).
Schlüsselwörter (Keywords)
Schillers Vorlesung über die Gesetzgebung bei Lykurg und Solon beschäftigt sich mit zentralen Themen der politischen Philosophie der Spätaufklärung, wie zum Beispiel der Rolle der Vernunft, der Staatsbildung, der Staatsformen, der Gewaltenteilung, der Repräsentativen Demokratie und der Kritik an unkritischer Verklärung der Antike. Der Text analysiert die antiken Staatsmodelle im Hinblick auf ihre Relevanz für die Gegenwart und befasst sich mit den zeitgenössischen Debatten um die Verfassung, die Eigentumsverteilung und den Einfluss der Französischen Revolution auf das politische Denken in Europa.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Schillers Text über Lykurg und Solon?
Schiller vergleicht die antiken Gesetzgebungen von Sparta (Lykurg) und Athen (Solon), um philosophische Fragen über den idealen Staat und die Freiheit des Individuums zu diskutieren.
Warum kritisierte Schiller das spartanische Modell von Lykurg?
Obwohl Sparta stabil und mächtig war, sah Schiller darin einen "schlechten Staat", da er die individuelle Freiheit opferte und den Menschen zum reinen Werkzeug des Staates degradierte.
Was zeichnete Solons Gesetzgebung für Schiller aus?
Solon schuf einen "guten Staat", der auf Vernunft basierte, die Freiheit der Bürger achtete und die Entwicklung des Individuums als obersten Zweck des Staates ansah.
Welchen Bezug hat der Text zur Französischen Revolution?
Der Text entstand 1789. Schiller nutzte die antiken Beispiele als getarnte Auseinandersetzung mit den zeitgenössischen Debatten über Verfassung, Gewaltenteilung und Volkssouveränität.
Was war für Schiller der "oberste Zweck" des Staates?
Nicht der Staat selbst ist der Zweck, sondern der Mensch. Der Staat sollte lediglich die Bedingungen schaffen, unter denen sich die moralischen und geistigen Kräfte des Menschen entfalten können.
- Quote paper
- Stefan Enke (Author), 2011, Geschichte als Philosophie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169086