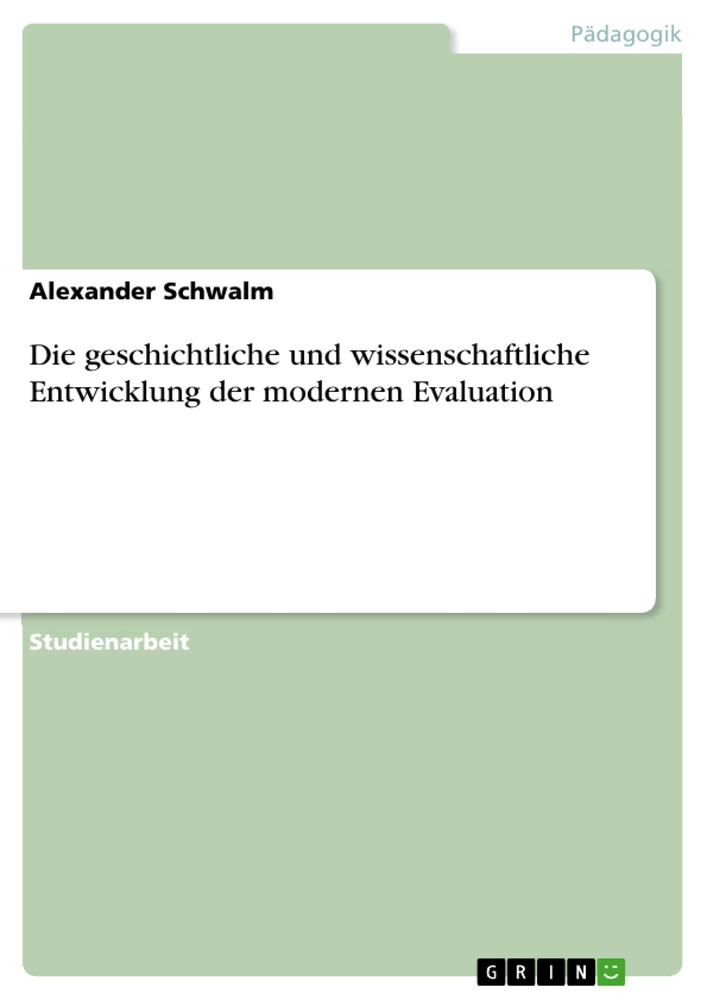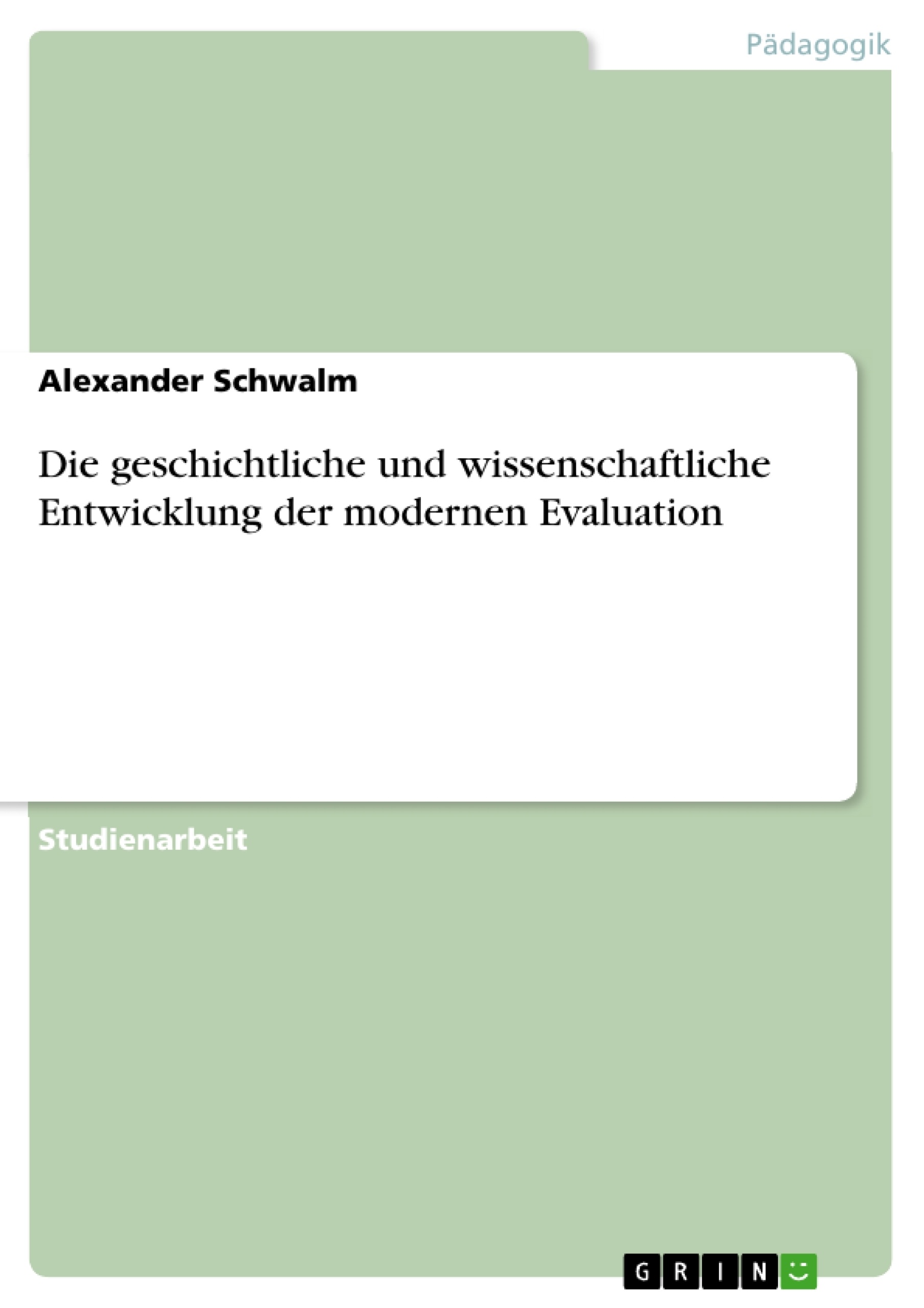Mit welchen Mitteln ist es möglich Vorgänge, Entwicklungen oder verschiedene Meinungen und Perspektiven von Personen in unserer Gesellschaft zu erfassen, zu analysieren und zu bewerten? Häufig lautet die Antwort hierauf: „Evaluation“. „Zur Erfassung und Beseitigung von Mängeln und Problemen, zur Optimierung von Organisationen und Projekten werden Evaluationen umfassend eingesetzt. Bei der Verwendung öffentlicher Gelder werden Evaluationen obligatorisch integriert, um sicherzustellen, dass systematisch erfasst werden kann, was geleistet und welche Wirkungen erzielt wurden“ (Wenzel, Ulrich 2003, S.9). Doch der Evaluation kommt heutzutage eine solche Vielzahl von Aufgaben und Einsatzgebieten zu, dass sie sich weiterentwickelt hat, und zu einem komplexen Verfahren mit unterschiedlichen Ansätzen geworden ist. Ich möchte in dieser Arbeit auf eben jene Entwicklung eingehen. Es soll v. a. herausgestellt werden, wie sich Evaluation in Richtung eines partizipativen und demokratischen Verfahrens weiterentwickelt hat, welches neue Perspektiven und Möglichkeiten für unsere Gesellschaft mit sich bringt. Als erstes soll geklärt werden, was Evaluation eigentlich ist, bzw. was unter diesem Begriff zu verstehen ist. Anschließend möchte ich einen Überblick über die geschichtliche Ent-wicklung der Evaluation geben um schließlich auf das Thema der modernen, professionellen Evaluation zu sprechen zu kommen. Hierbei sind zunächst die Verände-rungen im Evaluationsverständnis zu betrachten, die auch mit dem Verständnis der Evaluation von politischer Bildung einhergehen. Schließlich möchte ich die Evaluationsstandards der „Deutschen Gesellschaft für Evaluation“ (DeGEval) vorstellen. Anhand dieser relativ aktuellen Standards soll deutlich werden wie das Verständnis einer professionellen und modernen Evaluation aussieht, wobei auch ersichtlich wird, wie Elemente der partizipativen und demokratischen Evaluation Einfluss in diese Standards gefunden haben. Im Anschluss soll, sozusagen als Mündung des Voran-gegangenen, auf die Ansätze der partizipativen und demokratischen Evaluation selbst eingegangen werden. Diesen Punkt möchte ich letztendlich möglichst eindeutig im Hinblick auf Zielsetzungen und Vorgehensweisen behandeln, um die oben angesprochenen neuen Perspektiven und Möglichkeiten sowie den Nutzen dieser Evaluationsformen für unsere Gesellschaft deutlich werden zu lassen. Abschließend ist es mir noch ein Anliegen, in Reflexion meine eigene Meinung zu diesem Thema darzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Verständnis von Evaluation
- 2.1 Was ist Evaluation?
- 2.2 Die geschichtliche Entwicklung
- 3. Die moderne Evaluation - Anforderung und Herausforderung!
- 3.1 Veränderungen im Evaluationsverständnis
- 3.2 Die Evaluationsstandards
- 3.3 Partizipative und Demokratische Evaluation
- 4. Schlussbemerkung
- 5. Reflektionsbericht des Miniprojektes ,,FCFS vs. Prioritätenwahlverfahren & Super Digicampus"
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die geschichtliche und wissenschaftliche Entwicklung der modernen Evaluation. Ziel ist es, die Entwicklung der Evaluation hin zu einem partizipativen und demokratischen Verfahren aufzuzeigen und die damit verbundenen neuen Perspektiven und Möglichkeiten für die Gesellschaft zu beleuchten.
- Das Verständnis von Evaluation und dessen Wandel im Laufe der Zeit
- Die geschichtliche Entwicklung der Evaluationsmethoden
- Die Anforderungen und Herausforderungen der modernen Evaluation
- Evaluationsstandards und deren Bedeutung
- Partizipative und demokratische Evaluationsverfahren und deren Anwendung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Evaluation ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Mitteln zur Erfassung, Analyse und Bewertung von Vorgängen, Entwicklungen und Perspektiven in der Gesellschaft. Sie skizziert den Umfang der Arbeit und die einzelnen Kapitel, wobei der Fokus auf der Entwicklung der Evaluation hin zu partizipativen und demokratischen Verfahren liegt. Die Einleitung verweist auf die zunehmende Bedeutung von Evaluationen bei der Verwendung öffentlicher Gelder und die Notwendigkeit einer systematischen Erfassung von Leistungen und Wirkungen.
2. Das Verständnis von Evaluation: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Evaluation“ und beleuchtet dessen breite Anwendung in verschiedenen Bereichen. Es differenziert zwischen den vielfältigen Funktionen und Zielen von Evaluationen, abhängig von Institution, Aufgabenbereich und Gegenstand. Ein zentraler Aspekt ist die Gewinnung von Erkenntnis zur Optimierung und Entscheidungsfindung. Die Kapitel unterstreichen die Legitimations- und Optimierungsfunktionen der Evaluation und deren Abgrenzung von wissenschaftlicher Forschung. Schließlich wird die Komplexität von Evaluation, insbesondere im sozialen und Bildungsbereich, hervorgehoben, wo die Messbarkeit und objektive Bewertung von sozialen Prozessen eine große Herausforderung darstellen.
2.2 Die geschichtliche Entwicklung: Dieses Kapitel beschreibt die historische Entwicklung der Evaluation, beginnend mit der Bedeutung von Effektivitätskontrolle und Qualitätsmanagement seit der Industrialisierung. Es werden vier Phasen der Evaluation identifiziert, die jeweils die unterschiedliche Position des Evaluators verdeutlichen. Die erste Phase im 19. Jahrhundert konzentrierte sich auf die Messbarkeit von Abläufen und Kennzahlen (im schulischen Bereich: Leistungsüberprüfung). Spätere Phasen betonen die Praxisbeschreibung mit Optimierungsfunktion und die zunehmende Berücksichtigung von Praxisphänomenen, die nicht allein durch Messmethoden erfasst werden können.
3. Die moderne Evaluation - Anforderung und Herausforderung!: Dieses Kapitel befasst sich mit den Veränderungen im Evaluationsverständnis und den damit verbundenen Herausforderungen. Es werden die Evaluationsstandards der Deutschen Gesellschaft für Evaluation (DeGEval) vorgestellt, die als Beispiel für eine professionelle und moderne Evaluation dienen. Die Einbeziehung von Elementen der partizipativen und demokratischen Evaluation in diese Standards wird hervorgehoben. Der Fokus liegt auf den Ansätzen partizipativer und demokratischer Evaluation, deren Zielsetzungen und Vorgehensweisen mit dem Ziel, die neuen Perspektiven und Möglichkeiten sowie den Nutzen für die Gesellschaft zu verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Evaluation, Partizipative Evaluation, Demokratische Evaluation, Evaluationsstandards, geschichtliche Entwicklung, Evaluationsverständnis, Bildungsbereich, Optimierung, Methoden, Praxis.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text "Moderne Evaluation"
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über die moderne Evaluation. Er behandelt die historische Entwicklung des Evaluationsverständnisses, die Anforderungen und Herausforderungen der modernen Evaluation, Evaluationsstandards und insbesondere partizipative und demokratische Evaluationsverfahren.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einleitung; 2. Das Verständnis von Evaluation (inkl. 2.1 Was ist Evaluation? und 2.2 Die geschichtliche Entwicklung); 3. Die moderne Evaluation - Anforderung und Herausforderung! (inkl. 3.1 Veränderungen im Evaluationsverständnis, 3.2 Die Evaluationsstandards und 3.3 Partizipative und Demokratische Evaluation); 4. Schlussbemerkung; 5. Reflektionsbericht des Miniprojektes ,,FCFS vs. Prioritätenwahlverfahren & Super Digicampus".
Was ist das Hauptziel des Textes?
Das Hauptziel des Textes ist es, die Entwicklung der Evaluation hin zu einem partizipativen und demokratischen Verfahren aufzuzeigen und die damit verbundenen neuen Perspektiven und Möglichkeiten für die Gesellschaft zu beleuchten. Er untersucht die geschichtliche und wissenschaftliche Entwicklung der modernen Evaluation.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die wichtigsten Themenschwerpunkte sind: Das Verständnis von Evaluation und dessen Wandel, die geschichtliche Entwicklung der Evaluationsmethoden, die Anforderungen und Herausforderungen der modernen Evaluation, Evaluationsstandards und deren Bedeutung sowie partizipative und demokratische Evaluationsverfahren und deren Anwendung.
Wie wird das Verständnis von Evaluation im Text dargestellt?
Der Text definiert den Begriff „Evaluation“ und erläutert dessen breite Anwendung. Er differenziert zwischen den Funktionen und Zielen von Evaluationen und betont die Legitimations- und Optimierungsfunktionen. Die Komplexität von Evaluation, besonders im sozialen und Bildungsbereich, wird hervorgehoben.
Wie wird die geschichtliche Entwicklung der Evaluation beschrieben?
Der Text beschreibt die historische Entwicklung der Evaluation von der Effektivitätskontrolle und dem Qualitätsmanagement der Industrialisierung bis hin zu modernen, partizipativen Ansätzen. Es werden verschiedene Phasen identifiziert, die die unterschiedliche Position des Evaluators verdeutlichen.
Welche Rolle spielen Evaluationsstandards im Text?
Der Text stellt die Evaluationsstandards der Deutschen Gesellschaft für Evaluation (DeGEval) als Beispiel für professionelle und moderne Evaluation vor. Die Einbeziehung partizipativer und demokratischer Elemente in diese Standards wird hervorgehoben.
Was versteht der Text unter partizipativer und demokratischer Evaluation?
Der Text konzentriert sich auf die Ansätze partizipativer und demokratischer Evaluation, deren Zielsetzungen und Vorgehensweisen, um die neuen Perspektiven und Möglichkeiten sowie den Nutzen für die Gesellschaft zu verdeutlichen.
Welche Schlüsselwörter sind im Text relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Evaluation, Partizipative Evaluation, Demokratische Evaluation, Evaluationsstandards, geschichtliche Entwicklung, Evaluationsverständnis, Bildungsbereich, Optimierung, Methoden und Praxis.
- Arbeit zitieren
- Alexander Schwalm (Autor:in), 2010, Die geschichtliche und wissenschaftliche Entwicklung der modernen Evaluation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169110