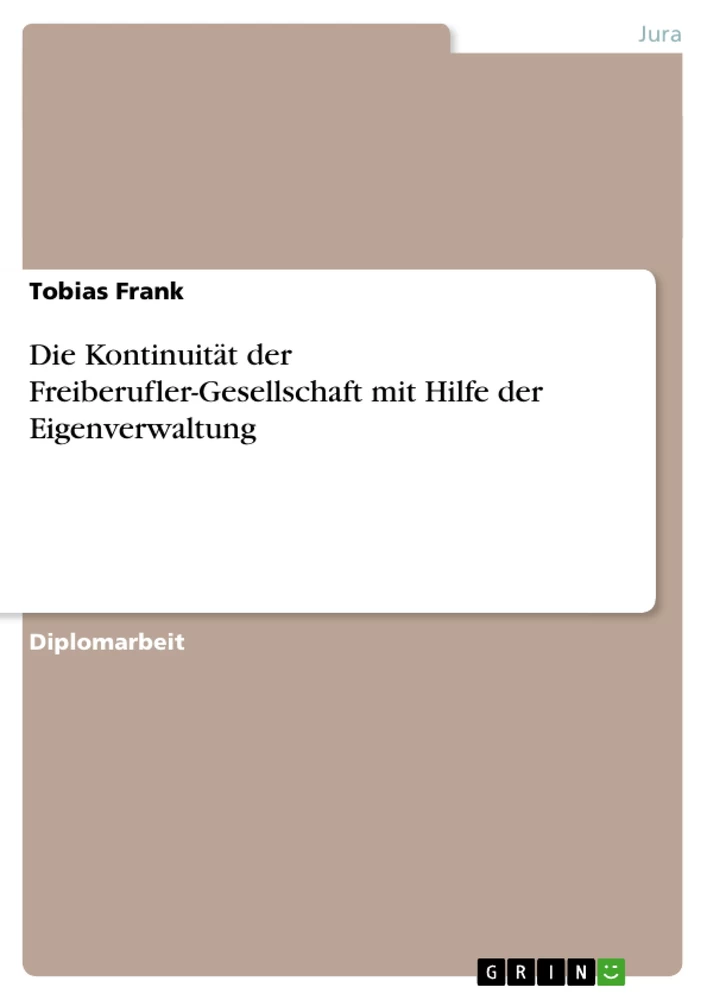Um die Kontinuität der Gesellschaft zu erleichtern, hat der Gesetzgeber, in Anlehnung an die VglO und dem U.S.-amerikanischen Insolvenzrecht, das Institut der Eigenverwaltung in die InsO eingeführt. Im Gegensatz zum Regelinsolvenzverfahren wird es dem Schuldner bei der Eigenverwaltung ermöglicht, das Insolvenzverfahren selbst durchzuführen. Der Schuldner übt die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über die Insolvenzmasse aus und wird dabei von einem Sachwalter überwacht. Ziel dieser Arbeit ist es, die Kontinuität der Freiberufler-Gesellschaft anhand der Eigenverwaltung aufzuzeigen. Es wird zunächst ein Einblick in die verschiedenen Erscheinungsformen der Freiberufler-Gesellschaft gegeben. Hierbei wird explizit auf die GbR, die PartG sowie auf die GmbH eingegangen. Anschließend wird auf die Besonderheiten dieser Gesellschaftsformen in Hinblick auf die freiberufliche Tätigkeit hingewiesen. Nach der Erörterung der gesellschaftsrechtlichen Kontinuität und die mit der Sanierung im Einklang stehenden Vorteile wird das Institut der Eigenverwaltung ausführlich dargestellt. Anschließend wird auf spezielle Reorganisationsmaßnahmen in Bezug auf die Eigenverwaltung sowie der Umgang mit den vorläufigen Sicherungsmaßnahmen aufgezeigt. Eine kritische Analyse als auch die Frage der momentan noch mangelnden Akzeptanz in der Praxis werden im Anschluss erörtert. Zum Schluss werden die steuerlichen Aspekte einer Kontinuität und berufsrechtliche Fragestellungen einer insolventen Ärzte-GmbH diskutiert. Der Verfasser vermittelt mit der Aufbereitung der aktuellen Gesetzessituation neben praxisorientierter Befunde tiefere Einblicke in die nach wie vor bestehenden Probleme und Bedenken, mit denen sich Rechtsprechung und Wissenschaft im Spannungsfeld zwischen Gläubigerschutz und Sanierungschancen weiter werden beschäftigen müssen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- A. Einleitung
- B. Die Freiberufler-Gesellschaft
- I. Begriffsdefinition eines Freiberuflers
- II. Begriffsdefinition und Haftung der GbR
- III. Begriffsdefinition und Haftung der PartG
- IV. Begriffsdefinition und Haftung der GmbH
- V. Besonderheiten einer Freiberufler-Gesellschaft
- C. Gesellschaftsrechtliche Aspekte der Kontinuität
- I. Auflösungspflicht
- 1. GbR
- 2. PartG
- 3. GmbH
- II. Fortsetzung der aufgelösten Gesellschaft
- 1. GbR
- 2. PartG
- 3. GmbH
- D. Die Vorteile der Sanierung einer Freiberufler-Gesellschaft
- I. Der Verlauf der Diskussion über die Eigenverwaltung
- 1. Betriebswirtschaftliche Betrachtungsweise
- 2. Volkswirtschaftliche Betrachtungsweise
- E. Das Institut der Eigenverwaltung
- I. Die Entwicklung der Eigenverwaltung
- 1. Das U.S.-amerikanische Vorbild
- 2. Die Vergleichsordnung
- II. Der gegenwärtige Gesetzesentwurf zur Eigenverwaltung
- 1. Auswirkungen des Gesetzesentwurfs
- a. Lockerung der materiellen Voraussetzungen
- b. Änderungen im Eröffnungsverfahren
- 2. Vorbereitung einer Sanierung
- 3. Kritische Beurteilung
- III. Die Voraussetzungen für die Eigenverwaltung
- 1. Antrag des Schuldners
- 2. Zustimmung des Gläubigers bei Fremdantrag
- 3. Keine Gläubigerbenachteiligung/keine Verzögerung des Verfahrens
- IV. Die Rechte, Pflichten und Haftung des Eigenverwalters
- 1. Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis
- 2. Beschränkung der Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis
- 3. Wahlrecht des Eigenverwalters
- 4. Mittelentnahme aus der Insolvenzmasse zur Lebensführung
- 5. Insolvenztypische Aufgaben und Pflichten
- 6. Erstellung eines Insolvenzplans
- 7. Sonstige Mitwirkungspflichten
- 8. Haftung des Eigenverwalters
- a. Haftung gemäß §§ 270 Abs. 1 S. 2, 60 Abs. 1 Inso
- b. Bereicherungs-, Ersatzaus- und Ersatzabsonderungsansprüche
- c. Schadensersatzanspruch aus § 823 Abs. 1 BGB
- d. Schadensersatzanspruch aus § 823 Abs. 2 BGB i. V. m. einem Schutzgesetz
- e. Schadensersatzanspruch aus § 826 BGB
- f. Haftung analog § 60 Abs. 1 InsO
- 9. Fazit
- V. Rechtsstellung des Sachwalters
- 1. Die Bestellung und die Anforderungen an den Sachwalter
- 2. Wechsel des Sachwalters
- 3. Aufsicht des Insolvenzgerichts
- VI. Aufgaben, Befugnisse und Haftung des Sachwalters
- 1. Überprüfung der wirtschaftlichen Lage des Schuldners
- 2. Überwachungspflicht
- 3. Mitteilungspflicht
- 4. Insolvenzrechtliche Haftung des Sachwalters
- VII. Kompetenzen des Gläubigerausschusses
- 1. Entscheidungen von besonderer Bedeutung
- 2. Rechtsfolgen fehlender Zustimmung
- F. Die Eigenverwaltung im Ablauf einer Reorganisation
- I. Antrag auf Insolvenzverfahrenseröffnung und Eigenverwaltung
- 1. Insolvenzeröffnungsantrag bei drohender Zahlungsunfähigkeit
- 2. Insolvenzeröffnungsantrag bei Überschuldung
- 3. Vorteile der frühen Verfahrenseröffnung
- a. Vorteile bei der Anordnung der Eigenverwaltung
- b. Wesentliche Sanierungserleichterungen
- II. Fortführung der Gesellschaft
- III. Insolvenzplanverfahren
- IV. Aufhebung des Insolvenzverfahrens
- G. Vorläufige Sicherungsmaßnahmen während des Eröffnungsverfahrens
- I. Problemlage
- II. Vorläufige Sicherungsmaßnahmen
- 1. Vorläufige Eigenverwaltung
- a. Meinungsstreit
- b. Ergebnis
- 2. Vorläufige Postsperre
- 3. Betriebsstilllegung
- J. Kritische Analyse der Eigenverwaltung
- I. Vorteile der Eigenverwaltung bei einer Freiberufler-Gesellschaft
- 1. Kostenersparnis
- 2. Verfahrensdauerverkürzung
- 3. Kenntnisse und Erfahrungen der Geschäftsleitung
- 4. Motivation der Mitarbeiter
- 5. Aufrechterhaltung des laufenden Geschäfts
- 6. Geringerer Imageschaden des Schuldners
- 7. Vermeidung einer Kollision zwischen Insolvenzordnung und Berufsrecht
- 8. Anreiz zum Stellen des rechtzeitigen Eröffnungsantrags
- II. Risiken der Eigenverwaltung bei einer Freiberufler-Gesellschaft
- 1. Interessensgegensätze
- 2. Manipulationsmöglichkeiten des Schuldners
- a. Zweckentfremdung von liquiden Mitteln
- b. Sachwidrige Ausübung des Wahlrechts für gegenseitige Verträge
- 3. Bestreiten angemeldeter Forderungen
- 4. Einfluss von Banken
- 5. Verzögerung der Gläubigerbefriedigung
- 6. Geringere Sicherung im Eröffnungsverfahren
- H. Gründe der mangelnden Akzeptanz in der Praxis
- I. Allgemeines Misstrauen gegenüber der Eigenverwaltung
- 1. Ungehemmter Einsatz als Sanierungsmittel
- 2. Interessensgegensatz zwischen Schuldner und Gläubiger
- 3. Benachteiligung von Kleingläubigern
- II. Zurückhaltende Anordnung der Eigenverwaltung
- 1. Informationsdefizit auf Seiten des Schuldners
- 2. Restriktive Einstellung der Insolvenzgerichte
- I. Steuerrechtliche Aspekte der Kontinuität
- 1. Problematik
- 2. Historische Entwicklung
- 3. Freiberufler-Personengesellschaften
- 4. Freiberufler-Kapitalgesellschaften
- a. Körperschaftsteuer
- b. Gewerbesteuer
- J. Kollision zwischen Insolvenzrecht und Berufsrecht
- I. Allgemein
- II. Berufsrechtliche Kollision am Beispiel einer Ärzte-GmbH
- 1. Einflussnahme des Insolvenzverwalters
- 2. Verwertbarkeit der Patientenkartei
- 3. Resümee
- K. Schlussgedanke
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Frage, wie die Kontinuität einer Freiberufler-Gesellschaft im Falle einer Insolvenz mithilfe der Eigenverwaltung gewährleistet werden kann. Ziel ist es, die rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte der Eigenverwaltung in diesem Kontext zu analysieren und die Funktionsfähigkeit dieses Instruments für Freiberufler zu bewerten.
- Die Rechtsform der Freiberufler-Gesellschaft und deren spezifische Merkmale
- Die Herausforderungen der Kontinuität einer Freiberufler-Gesellschaft im Insolvenzfall
- Die Funktionsweise der Eigenverwaltung als Sanierungsinstrument
- Die rechtlichen und wirtschaftlichen Vorteile und Risiken der Eigenverwaltung für Freiberufler
- Die Interaktion zwischen Insolvenzrecht und Berufsrecht im Kontext der Eigenverwaltung
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Arbeit beginnt mit einer Definition der Freiberufler-Gesellschaft und beleuchtet die verschiedenen Rechtsformen, die für diese Gesellschaftsform relevant sind, wie GbR, PartG und GmbH. Anschließend werden die gesellschaftsrechtlichen Aspekte der Kontinuität im Insolvenzfall untersucht, wobei die Auflösungspflicht und die Fortsetzungsmöglichkeiten der Gesellschaften im Vordergrund stehen. Die Arbeit führt dann die Vorteile der Sanierung einer Freiberufler-Gesellschaft durch Eigenverwaltung aus und erklärt den Verlauf der Diskussion über dieses Institut sowohl aus betriebswirtschaftlicher als auch volkswirtschaftlicher Perspektive.
Im weiteren Verlauf werden die Entwicklung und der aktuelle Gesetzesentwurf zur Eigenverwaltung vorgestellt, einschließlich der Auswirkungen und der kritischen Beurteilung dieses Instruments. Die Voraussetzungen für die Eigenverwaltung, die Rechte, Pflichten und die Haftung des Eigenverwalters werden detailliert erläutert. Darüber hinaus werden die Rechtsstellung und die Aufgaben des Sachwalters sowie die Kompetenzen des Gläubigerausschusses beleuchtet.
Das sechste Kapitel beleuchtet die Eigenverwaltung im Ablauf einer Reorganisation, beginnend mit dem Antrag auf Insolvenzverfahrenseröffnung und Eigenverwaltung. Die Vorteile der frühen Verfahrenseröffnung werden dabei hervorgehoben. Anschließend wird die Fortführung der Gesellschaft, das Insolvenzplanverfahren und die Aufhebung des Insolvenzverfahrens besprochen. Das siebte Kapitel befasst sich mit den vorläufigen Sicherungsmaßnahmen während des Eröffnungsverfahrens, wie der vorläufigen Eigenverwaltung, der vorläufigen Postsperre und der Betriebsstilllegung.
Das achte Kapitel bietet eine kritische Analyse der Eigenverwaltung und analysiert die Vorteile und Risiken dieses Instruments im Kontext einer Freiberufler-Gesellschaft. Die Gründe für die mangelnde Akzeptanz der Eigenverwaltung in der Praxis werden ebenfalls beleuchtet. Das neunte Kapitel untersucht die steuerrechtlichen Aspekte der Kontinuität einer Freiberufler-Gesellschaft im Insolvenzfall. Das zehnte Kapitel widmet sich der Kollision zwischen Insolvenzrecht und Berufsrecht, am Beispiel einer Ärzte-GmbH.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Diplomarbeit konzentriert sich auf die Themen Freiberufler-Gesellschaft, Insolvenz, Eigenverwaltung, Kontinuität, Sanierung, Gesellschaftsrecht, Berufsrecht, Steuerrecht und Reorganisation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Eigenverwaltung im Insolvenzverfahren?
Die Eigenverwaltung ermöglicht es dem Schuldner, das Insolvenzverfahren selbst durchzuführen und die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über die Masse zu behalten, anstatt sie an einen Insolvenzverwalter abzugeben. Er wird dabei von einem Sachwalter überwacht.
Welche Vorteile bietet die Eigenverwaltung für Freiberufler?
Zu den Vorteilen gehören die Kostenersparnis, eine kürzere Verfahrensdauer, der Erhalt des spezifischen Fachwissens der Geschäftsleitung, ein geringerer Imageschaden und die Vermeidung von Konflikten zwischen Insolvenzrecht und Berufsrecht.
Welche Rechtsformen für Freiberufler werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), die Partnerschaftsgesellschaft (PartG) sowie die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) im Kontext der Freiberufler-Tätigkeit.
Was ist die Aufgabe des Sachwalters?
Der Sachwalter überwacht die wirtschaftliche Lage des Schuldners, prüft dessen Geschäftsführung und stellt sicher, dass die Gläubiger durch die Eigenverwaltung nicht benachteiligt werden.
Welche Risiken birgt die Eigenverwaltung?
Risiken sind potenzielle Interessenkonflikte, Manipulationsmöglichkeiten durch den Schuldner (z. B. Zweckentfremdung von Mitteln) und eine möglicherweise geringere Sicherung der Gläubigerinteressen im Eröffnungsverfahren.
Wie kollidieren Insolvenzrecht und Berufsrecht bei Ärzten?
Ein Konfliktpunkt ist beispielsweise die Verwertbarkeit der Patientenkartei, die dem Datenschutz und der Schweigepflicht unterliegt, aber im Insolvenzfall einen wirtschaftlichen Wert darstellt.
- Quote paper
- Tobias Frank (Author), 2011, Die Kontinuität der Freiberufler-Gesellschaft mit Hilfe der Eigenverwaltung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169192