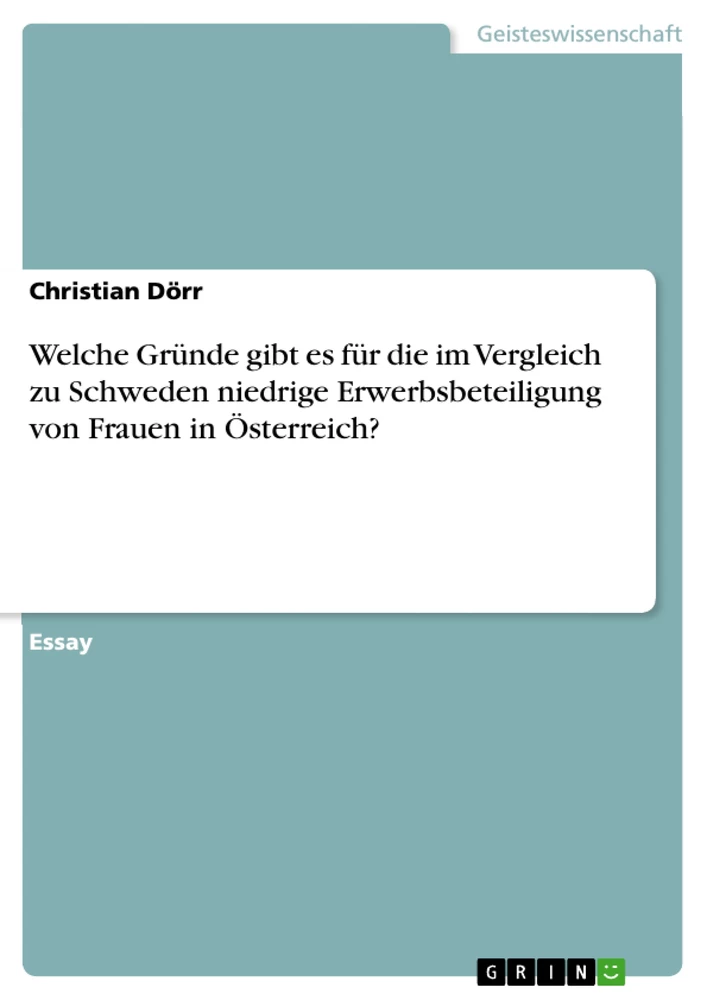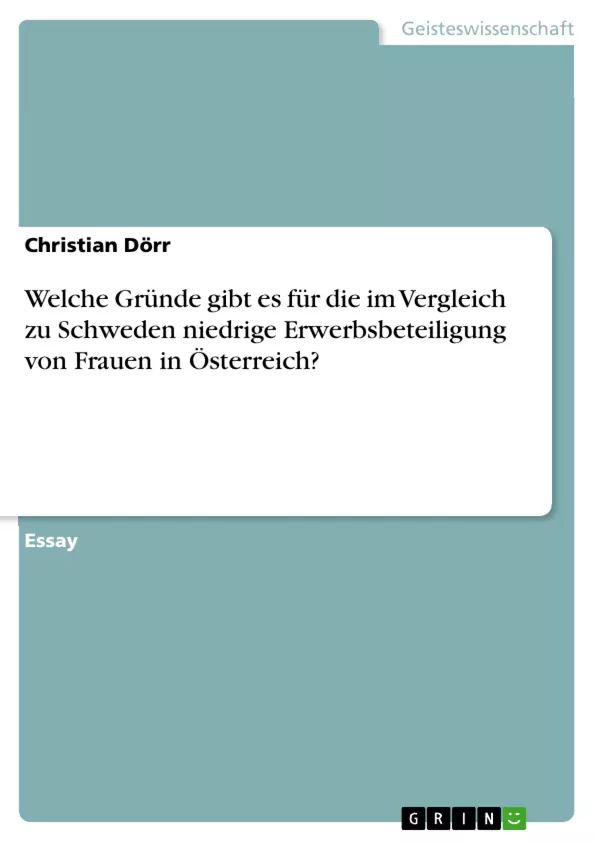Die Erwerbsquote der Frauen in Österreich lag 1985 bei 51% und die der schwedischen Frauen bei 50.1%.
~//~ Schweden betreibt eine Frauenarbeitspolitik, welche auf eine hohe Erwerbsbeteiligung von Frauen abzielt und dem gegenübergestellt Österreich eine traditionelle, konservative, geschlechtsabhängige Politik am Arbeitsmarkt.
~//~ In Schweden ist das „egalitarian employment model“ Takt angebend ~//~ Basierend auf diesen Daten erkennt man wieder das „breadwinner model“ von Österreich
~//~ Zusammenfassend meine ich drei Faktoren herauskristallisiert zu haben, welche die geringe Erwerbsbeteiligung von Frauen in Österreich im Vergleich zu Schweden erklären.
Inhaltsverzeichnis
- Welche Gründe gibt es für die im Vergleich zu Schweden niedrige Erwerbsbeteiligung von Frauen in Österreich?
- Erwerbsbeteiligung im Vergleich
- Die „heißeste Spur“ – Kinderbetreuung
- Österreich: „Breadwinner Model“
- Schweden: „Egalitarian Employment Model“
- Österreich: Das „Breadwinner Model“
- Schweden: Das „Egalitarian Employment Model“
- Karenzregelungen im Vergleich
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Gründe für die im Vergleich zu Schweden niedrigere Erwerbsbeteiligung von Frauen in Österreich. Sie beleuchtet die unterschiedlichen politischen Ansätze der beiden Länder in Bezug auf Kinderbetreuung, die traditionellen Geschlechterrollen und die Karenzmodelle.
- Erwerbsbeteiligung von Frauen in Österreich und Schweden im Vergleich
- Einfluss der Kinderbetreuung auf die Erwerbsbeteiligung von Frauen
- Vergleichende Analyse des „Breadwinner Model“ und des „Egalitarian Employment Model“
- Untersuchung der Karenzregelungen in Österreich und Schweden
- Relevanz der gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen für die Erwerbsbeteiligung von Frauen
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit einer Analyse der Erwerbsbeteiligung von Frauen in Österreich und Schweden im Vergleich. Es wird deutlich, dass Österreich im Vergleich zu Schweden eine deutlich geringere Erwerbsbeteiligung von Frauen aufweist.
Die Autorin konzentriert sich auf die Rolle der Kinderbetreuung als Schlüsselfaktor für die unterschiedlichen Erwerbsquoten. Es werden die verschiedenen politischen Ansätze in Österreich und Schweden beleuchtet. In Österreich dominiert das „Breadwinner Model“, das Frauen die Hauptverantwortung für Kindererziehung und -betreuung zuschreibt. In Schweden hingegen ist das „Egalitarian Employment Model“ vorherrschend, welches die Teilhabe beider Elternteile am Arbeitsleben fördert.
Der Text vergleicht die Karenzregelungen in den beiden Ländern und zeigt, wie sich diese auf die Erwerbsbeteiligung von Frauen auswirken.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themenfelder sind: Erwerbsbeteiligung, Frauen, Kinderbetreuung, Geschlechterrollen, „Breadwinner Model“, „Egalitarian Employment Model“, Karenzregelungen, Österreich, Schweden, politische Ansätze, gesellschaftliche Rahmenbedingungen.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Erwerbsbeteiligung von Frauen in Schweden höher als in Österreich?
Schweden fördert ein egalitäres Beschäftigungsmodell, während Österreich traditionell eher am konservativen "Breadwinner Model" festhält.
Was ist das "Breadwinner Model"?
Ein Gesellschaftsmodell, bei dem der Mann als Hauptverdiener gilt und der Frau primär die Verantwortung für Haushalt und Kindererziehung zugeschrieben wird.
Welche Rolle spielt die Kinderbetreuung beim Erwerbsverhalten?
In Schweden ermöglicht eine flächendeckende und staatlich geförderte Kinderbetreuung Frauen den schnellen Wiedereinstieg in den Beruf.
Wie unterscheiden sich die Karenzregelungen in beiden Ländern?
Die Arbeit zeigt auf, dass schwedische Regelungen stärker auf die Aufteilung der Elternzeit zwischen beiden Partnern abzielen als das österreichische System.
Gab es 1985 bereits große Unterschiede in der Erwerbsquote?
Interessanterweise lagen die Quoten 1985 mit ca. 51% (Österreich) und 50,1% (Schweden) noch nah beieinander, bevor sich die politischen Wege trennten.
- Citation du texte
- Christian Dörr (Auteur), 2010, Welche Gründe gibt es für die im Vergleich zu Schweden niedrige Erwerbsbeteiligung von Frauen in Österreich?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169213