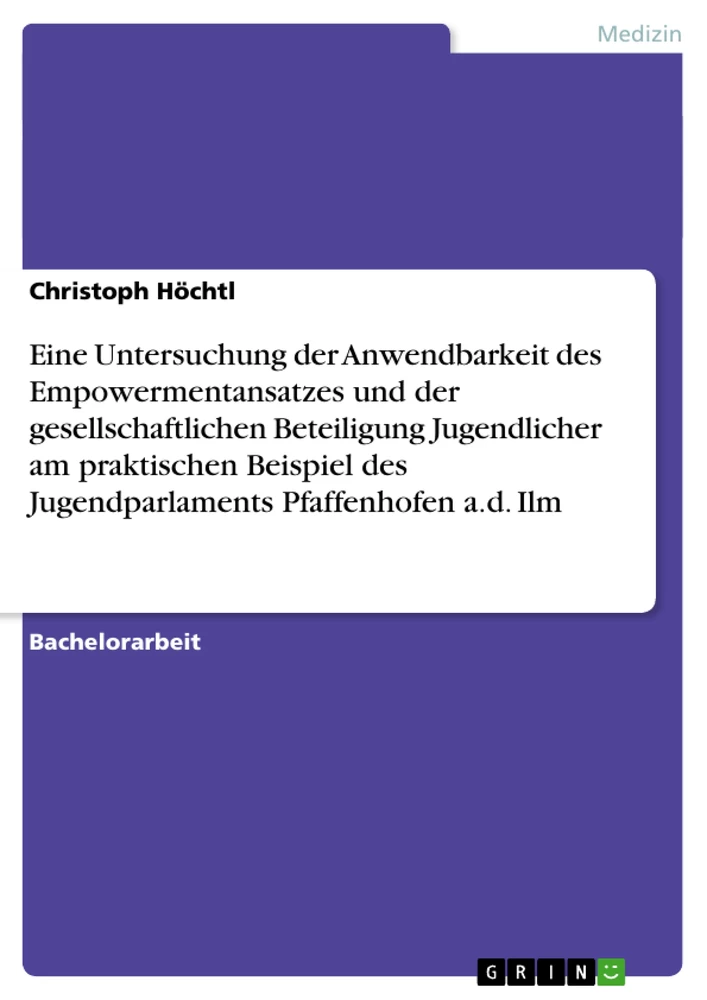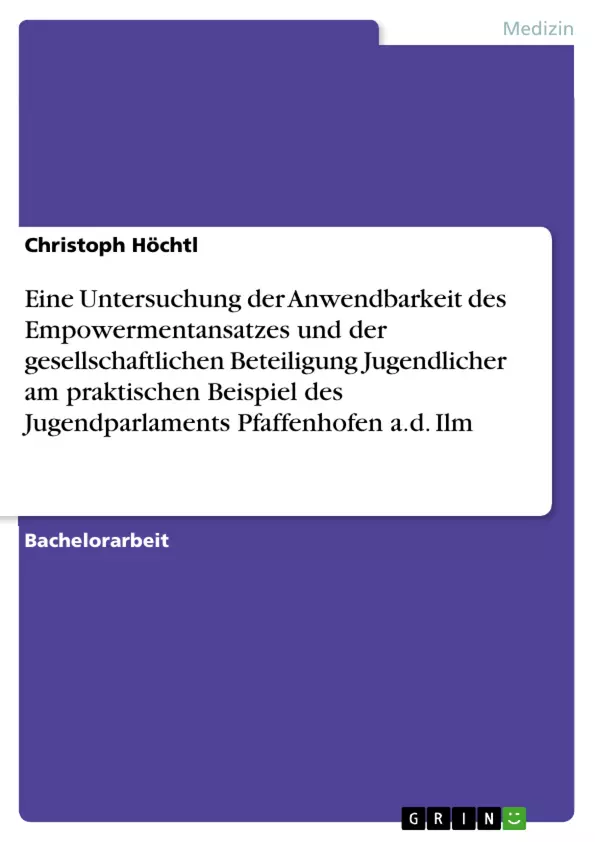Bei der vorliegenden Bachelorarbeit wird die Anwendbarkeit des Empowerment-Ansatzes in der Sozialen Arbeit mit Jugendlichen untersucht.
Hierfür wird das Beispiel des Jugendparlaments in Pfaffenhofen a.d.Ilm herangezogen, welches konzeptionell durch Sozialpädagogen der Stadtjugendpflege auf der Basis von Empowerment-Grundsätzen betreut wird.
Es gilt herauszufinden, ob und in welchem Umfang das Empowerment-Konzept in diesem Bereich das richtige Werkzeug ist und welche Effekte dadurch bisher erzielt wurden. Zudem interessiert sich die Untersuchung für die gesellschaftliche Beteiligung Jugendlicher und unter¬sucht diese ebenfalls anhand der Praxis des Jugendparlaments Pfaffenhofen a.d.Ilm.
Die Auswertung der Befragung aller bisherigen und jetzigen Mitglieder dieses Parlaments bestätigt in vielen Teilen den Empowerment-Ansatz als gut anwendbares Mittel in der Arbeit mit jungen Menschen, die sich an der Gesellschaft und der Politik einbringen wollen.
Zugleich muss darauf geachtet werden, dass das Thema Empowerment weit gefasst ist und noch viel diskutiert wird (vgl. Pankofer 2000, S. 18). Es gibt Schwierigkeiten bei der exakten Bestimmung des Inhalts dieses Konzeptes, auf die in dieser Arbeit hingewiesen werden. Dadurch, dass der Begriff Empowerment sehr viele Bereiche des Lebens und Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit abdecken kann, ist es nicht leicht, konkrete Grenzen dieses Konzepts zu setzen. Zentrale Aspekte des Konzepts, wie ein hohes Selbstwertgefühl, Durch-setzungsvermögen oder Problemlösungskompetenzen, finden sich ebenfalls in etlichen anderen Theorien, Konzepten und Methoden (nicht nur) in der sozialen Arbeit.
Um dem gewählten Thema und der Untersuchung näher zu kommen, wird in dieser Bachelorarbeit nach den einleitenden Worten im ersten Teil das Thema genauer bestimmt, vorgestellt und beschrieben. Im Anschluss wird das Empowerment-Konzept näher beleuchtet, mit all seinen zahlreichen Facetten. Es soll nicht nur klar definiert, sondern auch vom Inhalt und den möglichen anderen Anwendungsbereichen her dargestellt werden. Aufgrund der anhaltenden Diskussion um das Empowerment-Konstrukt wird eine Abgrenzung zu einer Theorie versucht und die Anwendbarkeit, wie auch das Konzept selbst, kritisch bewertet.
Im zweiten Teilbereich dieser Arbeit geht es um die gesellschaftliche Beteiligung Jugendlicher, d.h. um deren Partizipation am gesellschaftlichen und politischen Leben.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1 Einleitung
- 1.1 Motivation zu dieser Arbeit
- 1.2 Einführung in das Thema und Erläuterungen der Forschungsfragen
- 1.3 Anwendbarkeit des Empowermentansatzes beim Jugendparlament Pfaffenhofen und Begriffsnäherung
- 2 Empowerment und dessen Anwendbarkeit und Anwendung
- 2.1 Begriffsklärung und Definition von Empowerment
- 2.2 Zusammengefasste Geschichte des Empowermentansatzes
- 2.3 Inhalte und Ziele des Ansatzes
- 2.4 Ebenen des Empowermentansatzes
- 2.4.1 Individuelle Ebene
- 2.4.2 Ebene von Gruppen und Organisationen
- 2.4.3 Strukturelle Ebene
- 2.5 Ressourcen im Zusammenhang mit Empowerment
- 2.5.1 Strukturelle Ressourcen
- 2.5.2 Personale Ressourcen
- 2.5.3 Soziale Ressourcen
- 2.6 Anwendungsbereiche und Beispiele
- 2.7 Abgrenzung zu einer Theorie und kritische Bewertung
- 3 Gesellschaftliche Beteiligung / Partizipation und deren Anwendbarkeit
- 3.1 Definition
- 3.2 Verbindung zum Empowerment-Ansatz
- 3.3 Bewertung des Jugendparlaments als Mittel der gesellschaftlichen Beteiligung im Hinblick auf Empowerment
- 4 Jugendparlament Pfaffenhofen a.d.Ilm
- 4.1 Kurzüberblick und Zahlen über die Stadt Pfaffenhofen a.d.Ilm
- 4.2 Formeller Aufbau und rechtliche Grundlage
- 4.3 Geschichte des Jugendparlaments Pfaffenhofen
- 4.4 Betreuung durch die Stadtjugendpflege
- 5 Empirische Untersuchung und Darstellung der Ergebnisse
- 5.1 Hypothesen dieser Untersuchung
- 5.2 Begriffsbestimmungen
- 5.2.1 Jugendliche
- 5.2.2 Betreuung durch die Stadtjugendpflege
- 5.3 Zielgruppe der Befragung
- 5.4 Inhalt und Aufbau des Fragebogens
- 5.4.1 Nähere Angaben zum Fragebogen
- 5.4.2 Auflistung der Fragen und Indikatoren
- 5.5 Zusammenfassung der Untersuchungsmethode
- 5.5.1 Erhebungsart
- 5.5.2 Auswertung
- 5.5.3 Erreichen der Zielgruppe
- 5.6 Ergebnisse - Darstellung der Auswertung
- 5.6.1 Nähere Darstellung der Umfrageteilnehmer – Demographische Daten
- 5.6.2 Bewertung der Betreuung durch die Stadtjugendpflege
- 5.6.3 Angaben zur Bedeutung des Empowerment-Ansatzes
- 5.6.4 Zusammenhänge und weitere Details zur Wirksamkeit des Empowerment-Ansatzes
- 5.7 Zusammenfassende Ergebnisdarstellung
- 6 Diskussion dieser Arbeit, der angewandten Erhebung und Auswertung
- 6.1 Bewertung: Erhebungsmethode und Fragebogen der Untersuchung
- 6.2 Probleme bei der Stichprobe
- 6.3 Allgemeine Kritik an dieser Arbeit
- 7 Persönliches Schlusswort und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Bachelorarbeit analysiert die Anwendbarkeit des Empowermentansatzes in der Sozialen Arbeit mit Jugendlichen am Beispiel des Jugendparlaments Pfaffenhofen a.d.Ilm. Die Studie zielt darauf ab, die Effektivität des Empowerment-Konzepts in diesem Kontext zu beleuchten und dessen Relevanz für die gesellschaftliche Beteiligung junger Menschen zu untersuchen.
- Anwendbarkeit des Empowermentansatzes in der Praxis
- Bedeutung von Empowerment für die Förderung der Selbstwirksamkeit und Teilhabe von Jugendlichen
- Rolle des Jugendparlaments als Plattform für gesellschaftliche Beteiligung
- Analyse der Wirksamkeit des Empowermentansatzes anhand empirischer Daten
- Kritik und Reflexion des Empowerment-Konzepts und dessen Anwendung im Kontext der Jugendbeteiligung
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert die Motivation sowie die Forschungsfragen. Das zweite Kapitel widmet sich dem Empowerment-Ansatz, definiert ihn und beleuchtet seine Inhalte, Ziele und Anwendungsmöglichkeiten. Im dritten Kapitel wird die gesellschaftliche Beteiligung Jugendlicher behandelt, wobei die Verbindung zum Empowerment-Ansatz und dessen Bedeutung für die Jugendbeteiligung diskutiert werden. Das vierte Kapitel stellt das Jugendparlament Pfaffenhofen a.d.Ilm als konkretes Beispiel vor und beleuchtet dessen Geschichte, Aufbau und Organisation. Der fünfte Teil präsentiert die empirische Untersuchung, die Ergebnisse der Befragung aller bisherigen und jetzigen Jugendparlamentarier in Pfaffenhofen. Dabei werden die Methodik der Erhebung und die Interpretation der Daten analysiert. Im sechsten Kapitel werden die Ergebnisse kritisch diskutiert und es werden Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten der Untersuchung aufgezeigt.
Schlüsselwörter (Keywords)
Empowerment, Jugendparlament, Gesellschaftliche Beteiligung, Partizipation, Soziale Arbeit, Jugendliche, Selbstwirksamkeit, Selbstbestimmung, Praxisforschung, empirische Untersuchung, Qualitative Forschung, Pfaffenhofen a.d.Ilm, Stadtjugendpflege.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Empowerment-Ansatz in der Sozialen Arbeit?
Empowerment zielt darauf ab, Menschen zu befähigen, ihre eigenen Stärken zu entdecken und ihre Lebensumstände selbstbestimmt zu gestalten.
Wie setzt das Jugendparlament Pfaffenhofen Empowerment um?
Durch die Begleitung der Stadtjugendpflege erhalten Jugendliche den Raum, politische Entscheidungen eigenständig zu treffen und Verantwortung für Projekte zu übernehmen.
Welche Ebenen des Empowerments gibt es?
Man unterscheidet die individuelle Ebene (Selbstwertgefühl), die Gruppenebene (Organisation) und die strukturelle Ebene (gesellschaftliche Rahmenbedingungen).
Was sind die Ergebnisse der Befragung in Pfaffenhofen?
Die Mehrheit der Mitglieder bestätigt, dass der Ansatz ihre Problemlösungskompetenz und ihr Durchsetzungsvermögen gestärkt hat.
Welche Kritik gibt es am Empowerment-Begriff?
Kritisiert wird oft die Unschärfe des Begriffs, da er sehr viele Bereiche abdeckt und sich teilweise mit anderen pädagogischen Theorien überschneidet.
- Quote paper
- Christoph Höchtl (Author), 2009, Eine Untersuchung der Anwendbarkeit des Empowermentansatzes und der gesellschaftlichen Beteiligung Jugendlicher am praktischen Beispiel des Jugendparlaments Pfaffenhofen a.d. Ilm , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169214