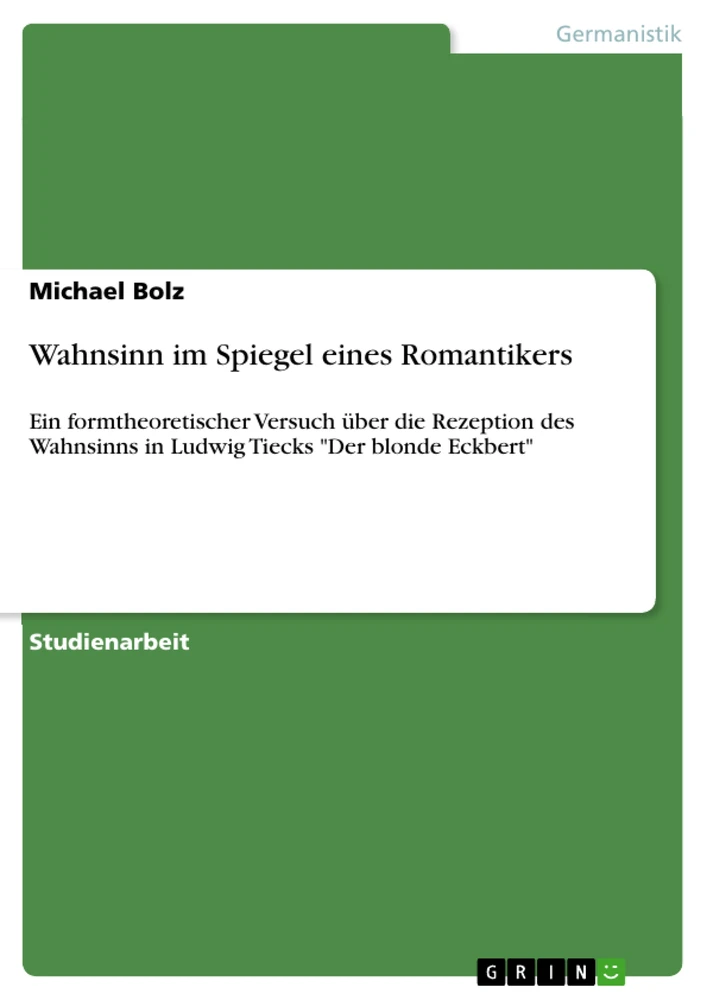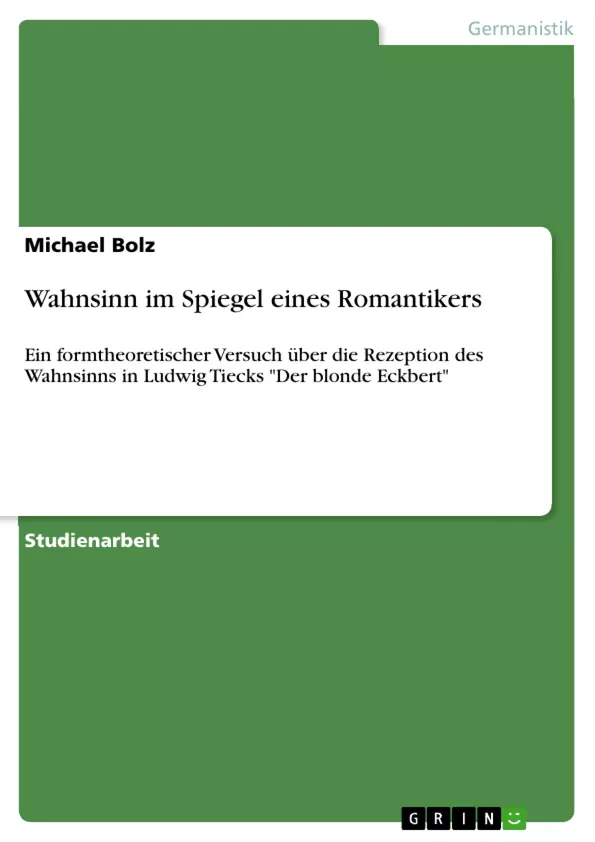Um sich Tiecks Wissen, seiner Transformationsleistung und Darstellung des Wahnsinns in seinen Werken annähern zu können, ist es vorab nötig sich zu fragen, wie er sich das „Wie“ des Vorhandenseins des alten und des ihm gegenwärtigen Wahnsinns beantwortet hat.
Tieck spielte mit der Substanz des kulturellen Bewusstseins und Wissens seiner Gegenwart und reintegrierte in Folge seiner Interpretation der literarischen Vergangenheit den Wahnsinn in sein schriftstellerisches Schaffen und Werk. Er erfand das Wunderbare. Er reintegrierte den vergangenen Wahnsinn, der in Folge der kulturellen Entwicklung und eines epistemologischen Bruches im 17./18.
Jahrhundert von der bürgerlichen Vernunft stigmatisiert – pathologisiert und ausgegrenzt – worden war in einer neuen literarischen Form. Es gelang ihm in einer, über seine Zeit hinaus weisenden Arbeit, die trotz allem „Kind seiner Zeit“ geblieben ist, einen dreifach gegliederten Entwurf vom Wahnsinn zu entwickeln, dem er über die romantische Literatur einen Platz in der bürgerlichen Kultur schuf und sicherte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- έτчμоλoуíα - eine kleine Begriffsgeschichte
- Wahnsinn im 16. und 17. Jahrhundert
- Wahnsinn im 18. und 19. Jahrhundert
- Die Theorie des Wunderbaren
- ,„Der blonde Eckbert“ - vom Ende des Anfangs
- Conclusio: Wahnsinn im Spiegel eines Romantikers
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminarsarbeit befasst sich mit Ludwig Tiecks literarischen Innovationen im 19. Jahrhundert und analysiert, wie er das Konzept des "Wunderbaren" entwickelte, um die Rezeption des Wahnsinns in seinem Werk „Der blonde Eckbert“ zu gestalten. Die Arbeit untersucht, wie Tieck das Thema Wahnsinn in seine literarische Praxis integriert und inwiefern diese Integration mit den historischen und kulturellen Kontexten des Wahnsinns in der Renaissance verbunden ist.
- Rezeption des Wahnsinns in der Literatur
- Ludwig Tiecks literarische Innovationen
- Das Konzept des "Wunderbaren" im 19. Jahrhundert
- Die Rolle des Wahnsinns in „Der blonde Eckbert“
- Die historische und kulturelle Bedeutung des Wahnsinns
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Ludwig Tiecks Beschäftigung mit dem Wahnsinn und die Entwicklung seines Konzepts des "Wunderbaren" vor. Sie beleuchtet Tiecks literarische Inspirationen in der Renaissance und untersucht, wie er das Thema Wahnsinn in seine Werke integriert. Die Arbeit geht auf den Experimentcharakter von Tiecks frühen Schriften ein und zeigt auf, dass er nicht nur eine handwerkliche Technik, sondern eine neue literarische Form für den Wahnsinn erschloss. Der Vergleich von historischem und gegenwärtigem Wahnsinn wird als eine geschichts- und literaturwissenschaftliche Leistung Tiecks hervorgehoben.
Das zweite Kapitel widmet sich der Begriffserklärung des Wahnsinns und zeichnet einen historischen Überblick über seine Bedeutung im 16. und 17. Jahrhundert sowie im 18. und 19. Jahrhundert nach. Es wird beleuchtet, wie sich das Verständnis des Wahnsinns von einer "Geisteskrankheit" hin zu einem Ausdruck für Unvernunft und Nicht-Vernunft entwickelte.
Kapitel drei widmet sich der Theorie des Wunderbaren und untersucht insbesondere die Novelle „Der blonde Eckbert“ als Beispiel für Tiecks literarische Innovation. Das Kapitel analysiert die Struktur der Novelle und zeigt auf, wie Tieck den Wahnsinn in die literarische Form integriert.
Schlüsselwörter
Wahnsinn, Literatur, Ludwig Tieck, "Der blonde Eckbert", Romantisches, Wunderbares, Renaissance, Geisteskrankheit, Unvernunft, Kulturgeschichte, Literaturwissenschaft, Geschichte, Geschichte des Wahnsinns
Häufig gestellte Fragen
Wie stellt Ludwig Tieck den Wahnsinn in seinen Werken dar?
Tieck integriert den Wahnsinn nicht als bloße Krankheit, sondern als Teil des "Wunderbaren", das die Grenzen zwischen Realität und Einbildung verwischt.
Was ist das Konzept des "Wunderbaren"?
Es ist eine literarische Form, die Unheimliches und Fantastisches in die bürgerliche Welt einbrechen lässt und so den Wahnsinn ästhetisch erfahrbar macht.
Welche Rolle spielt die Novelle "Der blonde Eckbert"?
In dieser Novelle wird der Wahnsinn durch die Aufdeckung verdrängter Schuld und die Auflösung der zeitlichen und räumlichen Ordnung dargestellt.
Wie veränderte sich der Begriff des Wahnsinns historisch?
Vom 16. Jahrhundert bis zur Romantik wandelte sich das Verständnis von einer religiös-dämonischen Deutung hin zu einer pathologisierten "Unvernunft" der Aufklärung.
Warum gilt Tieck als "Kind seiner Zeit" und zugleich als Wegweiser?
Er nutzt das Wissen seiner Zeit über Psychologie, weist aber durch seine moderne Erzählweise bereits auf spätere literarische Strömungen hin.
Was ist der "epistemologische Bruch" im 17./18. Jahrhundert?
Es ist der Wandel im Wissenssystem, durch den der Wahnsinn von der Vernunft ausgegrenzt und als rein medizinisches Problem stigmatisiert wurde.
- Citation du texte
- Michael Bolz (Auteur), 2011, Wahnsinn im Spiegel eines Romantikers, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169259