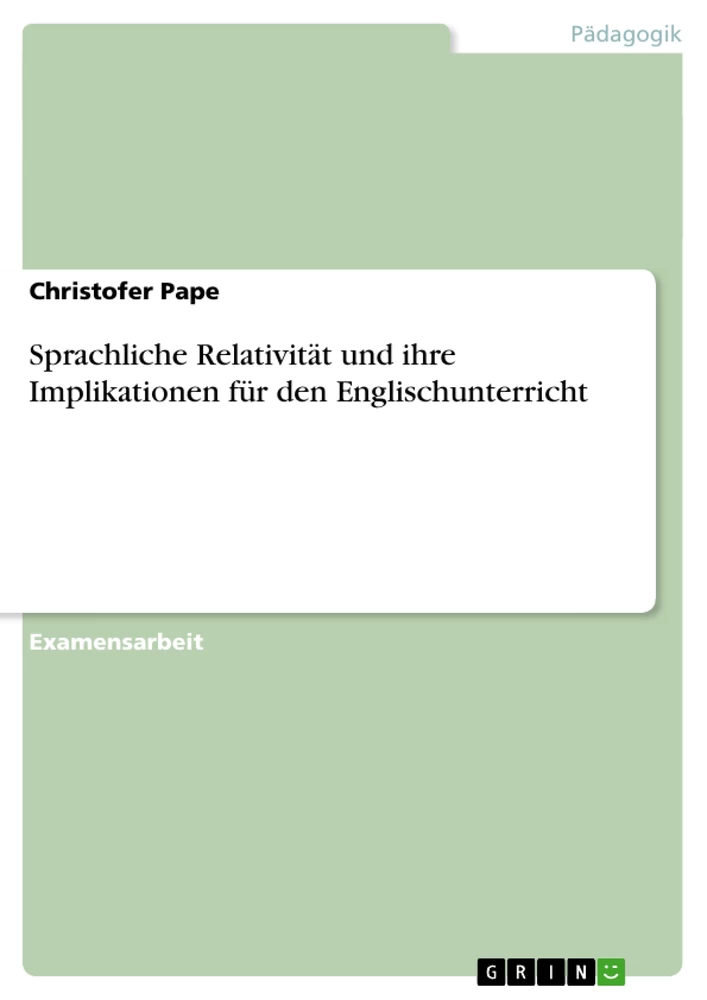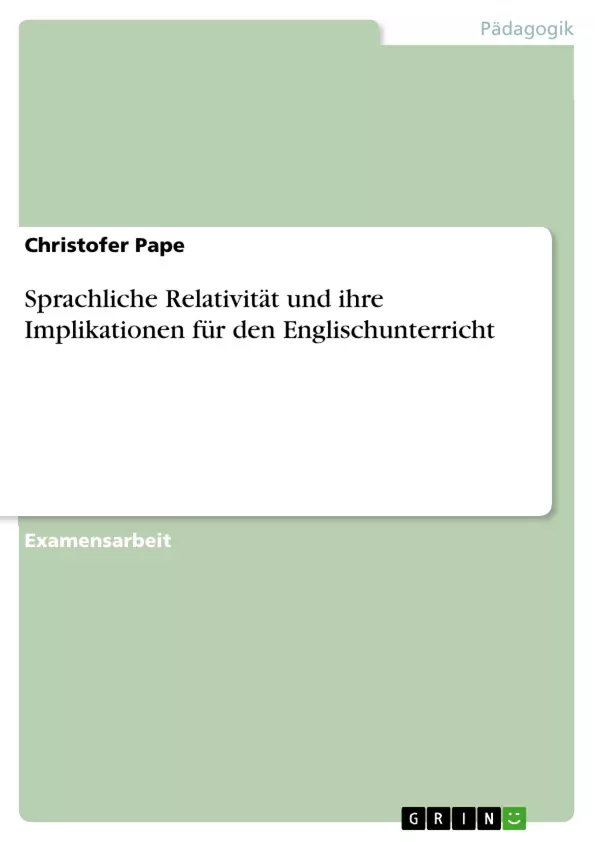Über die Akzeptanz sprachlicher Relativität im späteren 20. Jahrhundert bemerken Gentner & Goldin-Meadow (2003): „Admitting any sympathy for, or even curiosity about, this possibility was tantamount to declaring oneself to be either a simpleton or a lunatic“ (3). Spätestens ab den 1990er Jahren darf man jedoch ein neues Interesse an der Thematik, eine „Whorf-Renaissance“ (Werlen 2002: 248), konstatieren. Die Quintessenz dieser neueren Forschungslinie wird in einem Sammelband von Bowerman & Levinson (2001) prägnant auf den Punkt gebracht: „Some very moderate form of ’Whorfianism’ may be unavoidable“ (13).
In dieser Arbeit sollen mögliche Auswirkungen dieser Whorf-Renaissance auf den Englischunterricht im deutschsprachigen Raum erörtert werden.
[ca. 100 Titel in der Literaturliste]
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- I. Teil: Sprachliche Relativität
- 1. Die Entdeckung sprachlicher Relativität
- 1.1 Frühe Vorgänger
- 1.2 Wilhelm von Humboldt
- 1.3 Benjamin Lee Whorf
- 1.4 Whorfs Rezeption
- 2. Kritik an sprachlicher Relativität
- 2.1 Sprachdeterminismus und Politik
- 2.2 Banalität
- 2.3 Mentalese
- 3. Sprache und Kognition
- 3.1 Sprache als soziales Phänomen
- 3.2 Sprache als grundlegende kombinatorische Fähigkeit
- 4. Die Whorf-Renaissance
- 4.1 Lautwahrnehmung
- 4.2 Genus
- 4.3 Raumkognition
- 4.4 S-Sprachen und V-Sprachen
- 5. Thinking for Speaking
- II. Teil: Implikationen für den Englischunterricht
- 6. Thinking L1 for Speaking L2?
- 7. Sprachliche Relativität und Englischunterricht
- 7.1 Stanley
- 7.2 Alptekin & Alptekin
- 7.3 Scheu
- 7.4 Lee
- 7.5 Niemeier
- 7.6 Zusammenfassung
- 8. Die Rolle der Muttersprache(n)
- 8.1 Exkurs: Die kommunikative Wende im Englischunterricht
- 8.2 Die Muttersprache in der modernen kommunikativen Didaktik
- 8.3 Herkunftssprachen
- 9. Interkulturelle Kompetenz
- 10. Language awareness
- 11. Kognitive Linguistik und sprachliche Relativität
- 11.1 Konzeptuelle Metaphern
- 11.2 Konzeptuelle Metaphern im Fremdsprachenunterricht
- Fazit
- Sprachliche Relativität: Einfluss der Muttersprache auf das Denken
- Kritik an der Sapir-Whorf-Hypothese: Sprachdeterminismus und seine Grenzen
- Sprache und Kognition: Die Rolle der Sprache im Aufbau kognitiver Fähigkeiten
- Die Whorf-Renaissance: Neues Interesse an der Verbindung zwischen Sprache und Denken
- Implikationen für den Englischunterricht: Bedeutung sprachlicher Relativität für den Fremdsprachenunterricht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit untersucht den Einfluss der Theorie der sprachlichen Relativität auf den Englischunterricht im deutschsprachigen Raum. Ziel ist es, die historische Entwicklung der Theorie und ihre Kritik aufzuzeigen, um anschließend die Relevanz des Themas für die Fremdsprachendidaktik zu beleuchten.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung gibt einen Überblick über die Theorie der sprachlichen Relativität und ihre Bedeutung für den Englischunterricht. Im ersten Kapitel wird die historische Entwicklung der Theorie von ihren frühen Vorläufern bis zu Benjamin Lee Whorf beleuchtet. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Kritik an der Hypothese und ihren verschiedenen Formen. Das dritte Kapitel untersucht die Rolle der Sprache in der Entwicklung kognitiver Fähigkeiten. Das vierte Kapitel beleuchtet die Whorf-Renaissance und aktuelle Forschungsergebnisse zur Verbindung zwischen Sprache und Denken. Die Kapitel 5-11 behandeln die Implikationen dieser Erkenntnisse für den Englischunterricht.
Schlüsselwörter (Keywords)
Sprachliche Relativität, Sapir-Whorf-Hypothese, Sprachdeterminismus, Sprache und Kognition, Muttersprache, Englischunterricht, Fremdsprachendidaktik, interkulturelle Kompetenz, language awareness, Kognitive Linguistik, Konzeptuelle Metaphern.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die Sapir-Whorf-Hypothese?
Sie postuliert, dass die Struktur der Muttersprache das Denken und die Weltanschauung der Sprecher beeinflusst (sprachliche Relativität).
Was versteht man unter der "Whorf-Renaissance"?
Seit den 1990er Jahren gibt es ein neues wissenschaftliches Interesse an der Verbindung zwischen Sprache und Kognition, das über radikalen Sprachdeterminismus hinausgeht.
Welche Implikationen hat sprachliche Relativität für den Englischunterricht?
Lehrer müssen berücksichtigen, dass Lernende Konzepte ihrer Muttersprache (L1) auf die Zielsprache (L2) übertragen ("Thinking for Speaking") und interkulturelle Kompetenz fördern.
Was sind konzeptuelle Metaphern?
Es sind kognitive Strukturen, durch die wir abstrakte Konzepte mithilfe von konkreten Erfahrungen verstehen, was im Fremdsprachenerwerb eine große Rolle spielt.
Was bedeutet "Language Awareness"?
Es bezeichnet das Bewusstsein für die Funktionsweise von Sprache und deren Einfluss auf die Wahrnehmung, ein wichtiges Ziel moderner Fremdsprachendidaktik.
- Citation du texte
- Christofer Pape (Auteur), 2010, Sprachliche Relativität und ihre Implikationen für den Englischunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169274