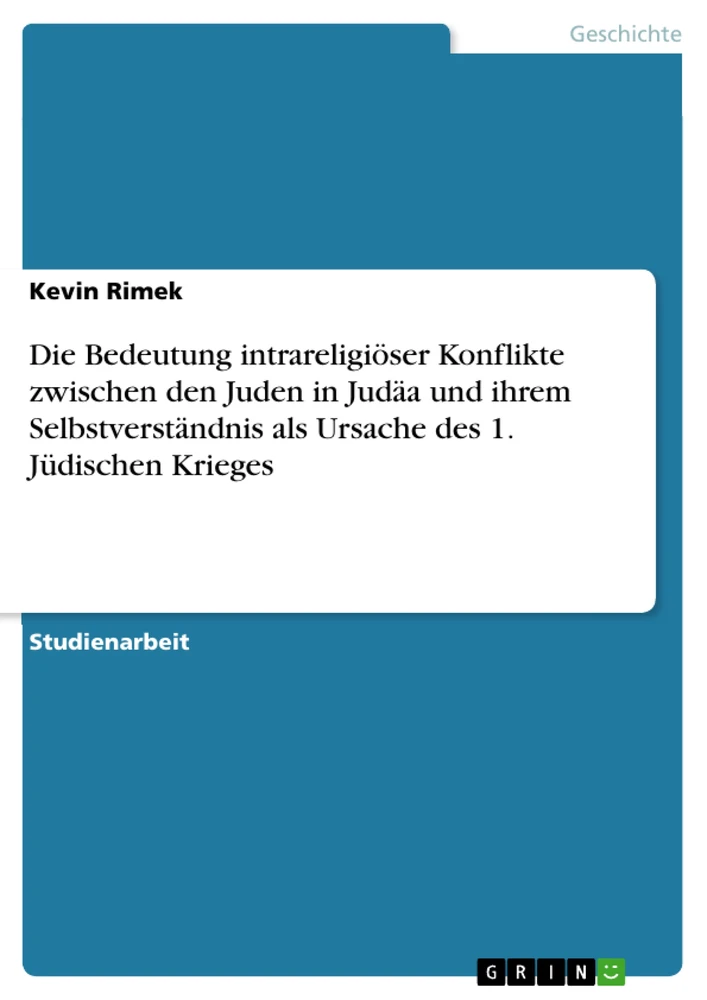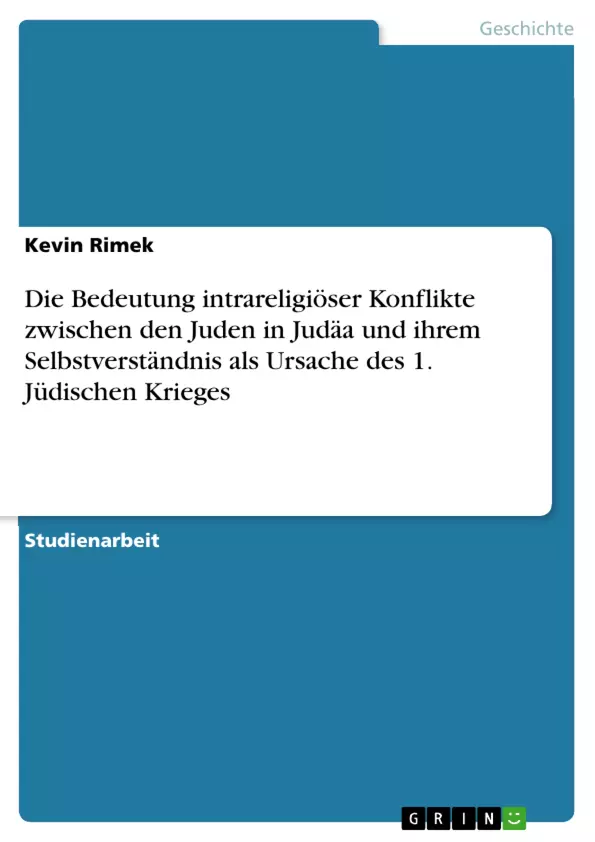„Jüdisch – Sein bedingt fast von selbst, dass man sich auf sich selbst besinnen, zu den ererbten Traditionen und Werten stehen, eben partikular sein (und entsprechende Anfeindungen in Kauf nehmen) muss. Die Alternative wäre Anpassung, Assimilation an die Umwelt, gegebenenfalls bis zur Ununterscheidbarkeit.“ (Dietrich, Walter: Israel und die Völker in der Hebräischen Bibel, S.8) So beschreibt W. Dietrich die beiden maßgeblichen Richtungen, in die sich die jüdische Religion seit der Fremdbeherrschung durch die Perser differenzierte. Sie sind das Ergebnis einer Entwicklung, welche sowohl mit intrareligiösen Konflikten, als auch der Selbstbetrachtung der Juden in Verbindung steht.
Die vorliegende Hausarbeit untersucht das Zusammenwirken dieser Faktoren mit Blick auf die dadurch resultierenden innen – und außenpolitischen Folgen zwischen Römern und Juden in Judäa vor Beginn des Ersten Jüdischen Krieges. So sollen die in dieser Hausarbeit gewonnenen Erkenntnisse eine Antwort auf die Frage leisten, ob und inwieweit die jüdische Religion mit ihrer Selbstbetrachtung und den internen Konflikten als Ursache für jenen Krieg genannt werden kann.
Die Hausarbeit verschafft zunächst einen Überblick über wesentliche Elemente des jüdischen Glaubens und damit ebenso über das Selbstverständnis der Juden. Im Folgenden wird die Ausdifferenzierung der jüdischen Gesellschaft (wobei hier der Schwerpunkt auf die Entwicklungen während der persischen Herrschaft gelegt wurde) und deren gegensätzlichen Auswirkungen auf die jüdische Gesellschaft in Form von Isolation und Assimilation in der hellenistisch – römischen Zeit betrachtet. Als eine Folge wird dabei die Herausbildung verschiedener religiöser Strömungen benannt, welche anschließend überblicksartig betrachtet werden. Im weiteren Verlauf werden die aus der Ausdifferenzierung resultierenden Ansprüche dieser Strömungen betrachtet und deren Auswirkungen für die römisch – jüdischen Beziehungen untersucht. Abschließend werden die aus der Betrachtung gewonnenen Erkenntnisse zur kritischen Hinterfragung der Darstellung des Josephus angewendet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das jüdische Selbstverständnis
- Die Ausdifferenzierung der jüdischen Gesellschaft
- Gegensatz zwischen politischer und kultureller Isolation und Assimilation in der hellenisch-römischen Zeit
- Bedeutende religiöse Strömungen im Judentum
- Judäa und seine Herrscher – religiös definierte Bedingungen der Akzeptanz
- Betrachtung der römischen Herrschaft in Judäa unter religiösen Gesichtspunkten
- Wertung zur Vorbetrachtung des Josephus über den Jüdischen Krieg
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Zusammenspiel von intrareligiösen Konflikten und dem jüdischen Selbstverständnis als mögliche Ursachen des Ersten Jüdischen Krieges. Sie analysiert die innen- und außenpolitischen Folgen dieses Zusammenspiels zwischen Römern und Juden in Judäa. Die Arbeit zielt darauf ab, die Rolle der jüdischen Religion und ihrer internen Konflikte im Kontext des Krieges zu bewerten.
- Das jüdische Selbstverständnis und seine Entwicklung
- Die Ausdifferenzierung der jüdischen Gesellschaft unter fremder Herrschaft
- Der Einfluss religiöser Strömungen auf die Beziehungen zwischen Juden und Römern
- Die Rolle der römischen Herrschaft in Judäa
- Eine kritische Auseinandersetzung mit Josephus' Darstellung des Jüdischen Krieges
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die zentrale Forschungsfrage: Inwieweit trugen intrareligiöse Konflikte und das jüdische Selbstverständnis zum Ausbruch des Ersten Jüdischen Krieges bei? Sie benennt die wichtigsten Quellen (Josephus) und deren Problematik, betont die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit römischen Tendenzen in Josephus' Werk, und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Das jüdische Selbstverständnis: Dieses Kapitel erörtert das jüdische Selbstverständnis, geprägt vom Erwählungsglauben und dem Endzeitglauben im Kontext eines gottgewollten Geschichtsverlaufs. Es beschreibt die Schwierigkeiten der Durchsetzung der Mosetora und die daraus resultierende Zentralisierung und Isolation des Judentums, die sowohl religiöse als auch politische Aspekte umfasst. Die Isolation führte zu negativen Interpretationen durch die Umwelt und zu Spannungen mit den jeweiligen Fremdherrschern.
Die Ausdifferenzierung der jüdischen Gesellschaft: Dieses Kapitel analysiert die Ausdifferenzierung der jüdischen Gesellschaft, insbesondere während der persischen Herrschaft. Es beleuchtet die gegensätzlichen Auswirkungen dieser Ausdifferenzierung in Form von Isolation und Assimilation in der hellenistisch-römischen Zeit. Der Fokus liegt auf den Entwicklungen und deren Folgen für die jüdische Gesellschaft und deren Beziehungen zur Umwelt.
Gegensatz zwischen politischer und kultureller Isolation und Assimilation in der hellenisch-römischen Zeit: Dieses Kapitel untersucht den Spannungsbogen zwischen Isolation und Assimilation innerhalb der jüdischen Gesellschaft während der hellenistisch-römischen Periode. Es analysiert, wie diese gegensätzlichen Tendenzen die interne Dynamik und die Beziehungen zu den herrschenden Mächten beeinflussten. Die Reformen von Königen wie Hiskija und Josija werden als Beispiele für Versuche der kulturellen und religiösen Bewahrung diskutiert. Die Auswirkungen der Seleukidenherrschaft und deren Auswirkungen auf den Tempel in Jerusalem werden beleuchtet.
Bedeutende religiöse Strömungen im Judentum: Der Abschnitt gibt einen Überblick über die verschiedenen religiösen Strömungen innerhalb des Judentums, die durch die Ausdifferenzierung entstanden sind. Es werden die unterschiedlichen Glaubensauffassungen und Praktiken dieser Strömungen skizziert, ohne auf einzelne Strömungen im Detail einzugehen.
Judäa und seine Herrscher – religiös definierte Bedingungen der Akzeptanz: Hier wird die Beziehung zwischen den religiösen Ansprüchen der verschiedenen jüdischen Strömungen und der römischen Herrschaft in Judäa analysiert. Es wird untersucht, wie religiöse Überzeugungen und Forderungen die Akzeptanz oder Ablehnung der römischen Herrschaft beeinflussten und umgekehrt.
Betrachtung der römischen Herrschaft in Judäa unter religiösen Gesichtspunkten: Dieses Kapitel analysiert die römische Herrschaft in Judäa aus einer religiösen Perspektive. Es untersucht, wie die religiösen Überzeugungen und Praktiken der Juden die Beziehung zu den römischen Besatzern beeinflussten, und umgekehrt wie die römische Politik die religiöse Praxis der Juden tangierte. Die Spannungen zwischen religiöser Autonomie und römischer Herrschaft werden diskutiert.
Wertung zur Vorbetrachtung des Josephus über den Jüdischen Krieg: Dieser Abschnitt befasst sich mit einer kritischen Bewertung von Josephus' Darstellung des Jüdischen Krieges. Die Arbeit untersucht mögliche Verzerrungen aufgrund seiner Position als römischer Kollaborateur und dessen Einfluss auf seine Darstellung der Ereignisse. Die subjektive Sichtweise Josephus' wird berücksichtigt und analysiert.
Schlüsselwörter
Jüdischer Krieg, Judäa, Römische Herrschaft, Jüdisches Selbstverständnis, Intrareligiöse Konflikte, Josephus, Mosetora, Erwählungsglaube, Endzeitglaube, Assimilation, Isolation, Religiöse Strömungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Jüdischer Krieg und jüdisches Selbstverständnis
Was ist der Gegenstand der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Ursachen des Ersten Jüdischen Krieges. Im Mittelpunkt steht das Zusammenspiel von innerjüdischen Konflikten und dem jüdischen Selbstverständnis als mögliche Auslöser des Krieges und dessen innen- und außenpolitische Folgen.
Welche Hauptthemen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das jüdische Selbstverständnis, die Ausdifferenzierung der jüdischen Gesellschaft unter fremder Herrschaft, den Einfluss religiöser Strömungen auf die Beziehungen zwischen Juden und Römern, die Rolle der römischen Herrschaft in Judäa und eine kritische Auseinandersetzung mit Josephus' Darstellung des Jüdischen Krieges.
Welche Quellen werden verwendet?
Die wichtigste Quelle ist das Werk des Josephus. Die Arbeit betont jedoch die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit Josephus' Darstellung aufgrund seiner Position als römischer Kollaborateur und der damit verbundenen möglichen Verzerrungen.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zum jüdischen Selbstverständnis, zur Ausdifferenzierung der jüdischen Gesellschaft, zum Spannungsfeld von Isolation und Assimilation in der hellenistisch-römischen Zeit, zu bedeutenden religiösen Strömungen im Judentum, zur Beziehung zwischen jüdischen religiösen Ansprüchen und römischer Herrschaft, zur römischen Herrschaft aus religiöser Perspektive, einer kritischen Betrachtung von Josephus' Werk und einer Zusammenfassung. Ein Inhaltsverzeichnis und Schlüsselwörter sind ebenfalls enthalten.
Welches ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Inwieweit trugen intrareligiöse Konflikte und das jüdische Selbstverständnis zum Ausbruch des Ersten Jüdischen Krieges bei?
Welche Rolle spielt das jüdische Selbstverständnis?
Die Arbeit untersucht, wie das jüdische Selbstverständnis, geprägt von Erwählungsglauben und Endzeitglauben, die Beziehungen zu den Römern und die internen Konflikte beeinflusste. Die Schwierigkeiten der Durchsetzung der Mosetora und die daraus resultierende Zentralisierung und Isolation des Judentums werden analysiert.
Wie wird die Ausdifferenzierung der jüdischen Gesellschaft dargestellt?
Die Ausdifferenzierung der jüdischen Gesellschaft, insbesondere während der persischen und hellenistisch-römischen Herrschaft, wird analysiert, wobei die gegensätzlichen Auswirkungen von Isolation und Assimilation im Fokus stehen.
Welche Bedeutung haben die religiösen Strömungen im Judentum?
Die Arbeit gibt einen Überblick über verschiedene religiöse Strömungen im Judentum und deren unterschiedliche Glaubensauffassungen und Praktiken, ohne auf einzelne Strömungen im Detail einzugehen. Der Einfluss dieser Strömungen auf die Beziehungen zwischen Juden und Römern wird untersucht.
Wie wird die römische Herrschaft in Judäa betrachtet?
Die römische Herrschaft wird aus religiöser Perspektive analysiert. Es wird untersucht, wie religiöse Überzeugungen und Praktiken der Juden die Beziehungen zu den Römern beeinflussten und umgekehrt, wie die römische Politik die religiöse Praxis der Juden tangierte.
Wie wird Josephus' Werk bewertet?
Josephus' Darstellung des Jüdischen Krieges wird kritisch bewertet, wobei mögliche Verzerrungen aufgrund seiner Position als römischer Kollaborateur berücksichtigt werden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Jüdischer Krieg, Judäa, Römische Herrschaft, Jüdisches Selbstverständnis, Intrareligiöse Konflikte, Josephus, Mosetora, Erwählungsglaube, Endzeitglaube, Assimilation, Isolation, Religiöse Strömungen.
- Quote paper
- Kevin Rimek (Author), 2011, Die Bedeutung intrareligiöser Konflikte zwischen den Juden in Judäa und ihrem Selbstverständnis als Ursache des 1. Jüdischen Krieges, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169287