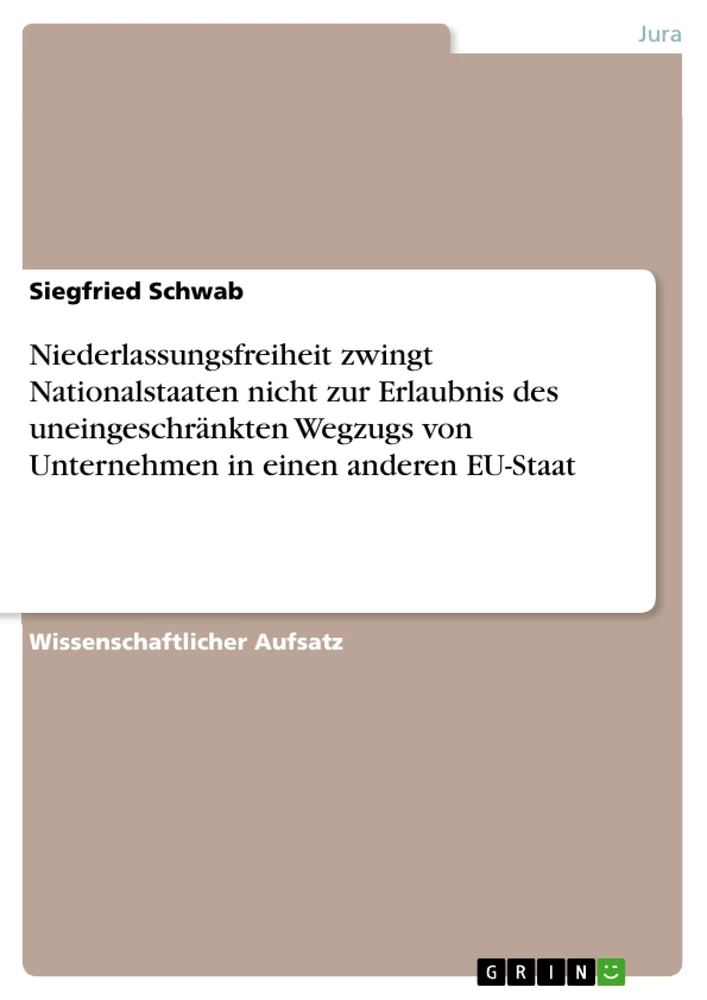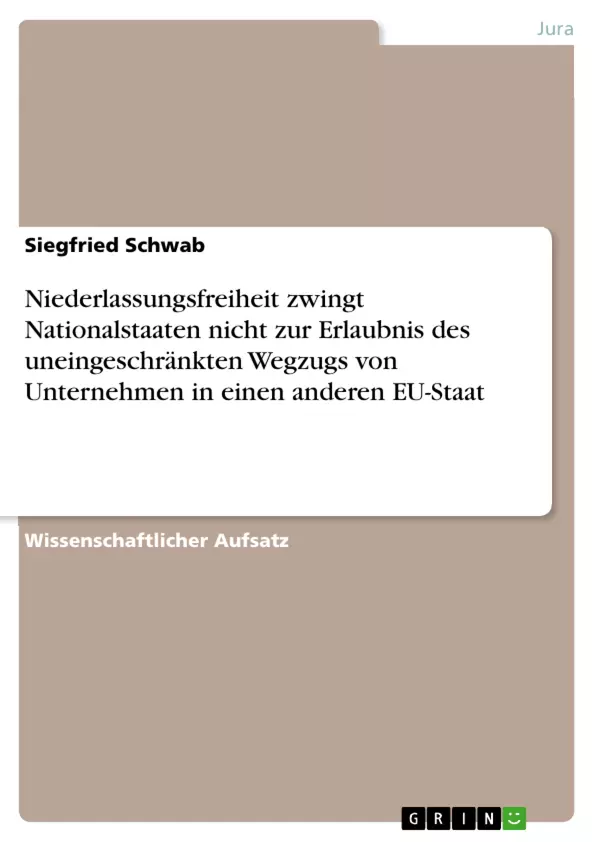Ein Gericht wie das vorlegende, bei dem eine Berufung gegen die Entscheidung eines mit der Führung des Handelsregisters betrauten Gerichts anhängig ist, das einen Antrag auf Änderung einer Angabe in diesem Register abgelehnt hat, ist als Gericht anzusehen, das nach Art. 234 EG (jetzt Art. 267) zur Vorlage eines Vorabentscheidungsersuchens befugt ist, obwohl weder die Entscheidung des Handelsregistergerichts in einem streitigen Verfahren ergeht noch die Prüfung der Berufung durch das vorlegende Gericht in einem solchen erfolgt. Art. 234 Abs. 2 EG ist bei nationalen Rechtsvorschriften über das Recht, gegen eine Entscheidung, mit der ein Vorabentscheidungsersuchen vorgelegt wird, Rechtsmittel einzulegen, dass die mit dieser Vertragsbestimmung den nationalen Gerichten eingeräumte Befugnis zur Anrufung des Gerichtshofs nicht durch die Anwendung dieser Rechtsvorschriften in Frage gestellt werden darf, nach denen das Rechtsmittelgericht die Entscheidung, mit der die Vorlage eines Vorabentscheidungsersuchens an den Gerichtshof beschlossen wird, abändern, außer Kraft setzen und dem Gericht, das diese Entscheidung erlassen hat, aufgeben kann, das nationale Verfahren, das ausgesetzt worden war, fortzusetzen. Die Art. 43 EG und 48 EG sind beim gegenwärtigen Stand des Gemeinschaftsrechts so auszulegen, dass sie Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats nicht entgegenstehen, die es einer nach dem nationalen Recht dieses Mitgliedstaats gegründeten Gesellschaft verwehren, ihren Sitz in einen anderen Mitgliedstaat zu verlegen und dabei ihre Eigenschaft als Gesellschaft des nationalen Rechts des Mitgliedstaats, nach dessen Recht sie gegründet wurde, zu behalten. Die zentrale Überlegung des Gerichtshofs geht dahin, dass es nach dem Wortlaut des Artikels 48 EG grundsätzlich in der Kompetenz der Mitgliedstaaten liegt zu bestimmen, unter
welchen Voraussetzungen und Bedingungen eine Gesellschaft nach jeweils inländischem Recht wirksam gegründet werden und fortbestehen kann. Zu diesen Bedingungen gehört auch die erforderliche Inlandsverknüpfung der Gesellschaft.
Inhaltsverzeichnis
- Niederlassungsfreiheit zwingt Nationalstaaten nicht zur Erlaubnis des uneingeschränkten Wegzugs von Unternehmen in einen anderen EU-Staat
- Die Europäische Niederlassungsfreiheit schützt nicht die grenzüberschreitende Verlegung der Hauptverwaltung unter Beibehaltung der Eigenschaft als Gesellschaft des bisherigen Heimatstaates.
- Art. 43, 48 EG gewährleistet die Eintragung einer Zweigniederlassung einer Gesellschaft, auch wenn diese im Gründungsland keine Geschäftstätigkeit entfaltet und zum Zweck der Umgehung von Anforderungen des nationalen Gesellschaftsrechts gegründet wird.
- Es stellt keinen Missbrauch der Niederlassungsfreiheit dar, eine Gesellschaft auswärtig zu gründen, weil das dortige Recht vorteilhafter ist oder scheint.
- Die Niederlassungsfreiheit gebietet, die Rechts- und Parteifähigkeit einer Gesellschaft nach dem Recht ihres Gründungsstaats anzuerkennen.
- Vorschriften für unwirksam, die Regeln über ein Mindestkapital und die Haftung der Geschäftsführer speziell für Gesellschaften vorsehen.
- Der EuGH hält die Daily Mail-Entscheidung aufrecht, die weithin als überholt angesehen worden war.
- Das Europarecht enthält keine Vorschriften, die die Mitgliedstaaten daran hindern, Wegzugsbeschränkungen für Gesellschaften aufzustellen, die nach ihrem nationalen Recht gegründet worden sind, ihren Sitz aber in einen anderen Mitgliedstaat verlegen wollen.
- Jede Gesellschaft lebt von der Verknüpfung mit einer bestimmten Rechtsordnung.
- Der Verlust des Anknüpfungselementes bei grenzüberschreitendem Wegzug darf nicht mit Auflösung und Liquidation der Gesellschaft sanktioniert werden.
- Die Entscheidung erlaubt die Sitzverlegung unter Änderung des Gesellschaftsstatuts, stellt hingegen die Sitzverlegung unter Wahrung des Statuts in die Hoheit der Mitgliedstaaten.
- Die Niederlassungsfreiheit des EG-Vertrags ist vom EuGH in mehreren bemerkenswerten Entscheidungen grundsätzlich und weitreichend durchgesetzt worden.
- Die Gewährleistung der Mobilität der Gesellschaften ist ein wesentlicher Bestandteil eines funktionierenden Binnenmarktes.
- Für deutsche Gesellschaften hat die Cartesio- Entscheidung nach der jüngsten GmbH- und Aktienrechtsnovelle keine Auswirkungen.
- Personengesellschaften müssen auch nach deutschem Recht ihre Hauptverwaltung im Inland haben.
- Ausgangsverfahren und Vorlagefragen
- Cartesio
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Frage, ob die Niederlassungsfreiheit des EU-Rechts Unternehmen zwingt, den uneingeschränkten Wegzug in einen anderen EU-Staat zu erlauben. Er untersucht die rechtlichen Grundlagen und die Entwicklung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in diesem Bereich.
- Die Grenzen der Niederlassungsfreiheit für Unternehmen
- Die Rolle des nationalen Gesellschaftsrechts
- Die Bedeutung der Rechtsprechung des EuGH
- Die Auswirkungen auf die Mobilität von Unternehmen innerhalb der EU
- Der Schutz der Identität von Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text untersucht die Niederlassungsfreiheit im Kontext des EU-Rechts. Er zeigt, dass die Niederlassungsfreiheit zwar die Gründung von Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Agenturen in anderen Mitgliedstaaten ermöglicht, jedoch keinen Anspruch auf uneingeschränkten Wegzug von Unternehmen aus ihrem Gründungsstaat gewährt. Der EuGH hat in mehreren Entscheidungen betont, dass die Mitgliedstaaten das Recht haben, bestimmte Beschränkungen für den Wegzug von Unternehmen aufzustellen, um die Identität und die Rechtsform des Unternehmens zu schützen.
Die Entscheidungen des EuGH in den Fällen Centros, Überseering und Inspire Art werden detailliert analysiert. Der Text beleuchtet, wie diese Entscheidungen die Interpretation der Niederlassungsfreiheit beeinflusst haben und welche Konsequenzen sie für die Mobilität von Unternehmen haben.
Darüber hinaus wird die Rechtsprechung des EuGH im Fall Cartesio, der die Frage der Sitzverlegung von Unternehmen behandelt, eingehend betrachtet. Der EuGH hat in diesem Fall deutlich gemacht, dass die Niederlassungsfreiheit nicht zwingt, eine Gesellschaft als Gesellschaft des Gründungsstaates auch nach Verlegung des Sitzes anzuerkennen.
Schlüsselwörter
Niederlassungsfreiheit, EU-Recht, Gesellschaften, Wegzug, Sitzverlegung, Hauptverwaltung, Gründungsstaat, Rechtsform, Identität, EuGH, Rechtsprechung, Cartesio, Centros, Überseering, Inspire Art, Daily Mail, Mobilität, Binnenmarkt, nationalstaatliches Recht, Rechtsordnung, Anknüpfungselemente, Satzungssitz, Verwaltungssitz.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt das Cartesio-Urteil des EuGH?
Dass Mitgliedstaaten den Wegzug einer Gesellschaft unter Beibehaltung ihrer Rechtsform beschränken dürfen, wenn die Inlandsverknüpfung verloren geht.
Schützt die Niederlassungsfreiheit die grenzüberschreitende Sitzverlegung?
Sie schützt die Gründung von Zweigniederlassungen, gebietet aber nicht zwingend, dass ein Staat den Wegzug unter Wahrung des bisherigen Statuts erlauben muss.
Was ist der Unterschied zwischen Satzungssitz und Verwaltungssitz?
Der Satzungssitz ist der rechtlich eingetragene Ort, während der Verwaltungssitz dort ist, wo die tatsächlichen Geschäfte geführt werden.
Darf man eine Gesellschaft im Ausland gründen, um heimisches Recht zu umgehen?
Ja, laut EuGH stellt es keinen Missbrauch der Niederlassungsfreiheit dar, eine Gesellschaft dort zu gründen, wo das Recht vorteilhafter erscheint (z.B. Centros-Fall).
Hat die Entscheidung Auswirkungen auf deutsche GmbHs?
Nach jüngsten Reformen (GmbH-Novelle) hat Cartesio für deutsche Kapitalgesellschaften geringe Auswirkungen, da die Mobilität gesetzlich gestärkt wurde.
- Citar trabajo
- Prof. Dr. Dr. Siegfried Schwab (Autor), 2011, Niederlassungsfreiheit zwingt Nationalstaaten nicht zur Erlaubnis des uneingeschränkten Wegzugs von Unternehmen in einen anderen EU-Staat, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169333